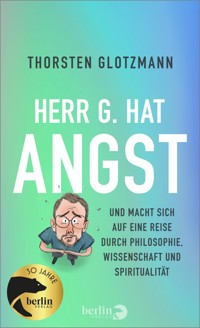
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
An jedem Morgen droht der Weltuntergang. Klima, Krieg, Katastrophen. Die Menschheit: am Abgrund. Die Zukunft: ungewiss. Was Menschen wie Herrn G. lähmt, ist eine große Angst. Diffus, schwer greifbar. Wie ein Gift sickert sie in alle Lebensbereiche und nimmt jede Hoffnung. Doch was, wenn die Angst nicht mehr das letzte Wort hätte? Dieses Buch folgt Herrn G., einem Menschen, der wie so viele andere mit der Angst ringt und Antworten sucht: Was ist diese Angst und wo kommt sie her? Wie kann man sie verstehen und wie bezwingen? So beginnt für Herrn G. eine Reise durch Philosophie und Wissenschaft, Achtsamkeit, Self-Care und Spiritualität – auf der Suche nach der Möglichkeit eines guten Lebens mit der Angst. Am Ende wird er fündig. Und wenn Herr G. einen Weg finden kann, dann können es alle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2024
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Antonia Hinterdobler für FinePic®
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
EINLEITUNG
Vorrede und Gegendarstellung des sogenannten »inneren Kritikers«, der sehr aufgebracht ist und eine dringende Warnung aussprechen muss
KAPITEL 1 – HERR G. UND DER RISS
Wie die Angst zu Herrn G. kam
Wie die Angst Herrn G.’s Alltag vergiftete
Pandemie, Krieg, Klima-Panik: Herr G. im Angesicht echter Katastrophen – zwischen doomscrolling und Realitätsverweigerung
Zooming Out und Zooming In: Worüber Herr G. im Planetarium und im Wald staunte
KAPITEL 2 – HERR G. UND DIE LIEBE ZUR WEISHEIT
Was Herr G. von der Philosophie über die Angst lernte
Wie sich Herr G. an den Anti-Angst-Strategien der Epikureer, Stoiker und Skeptiker versuchte: vom Vorausbedenken der Übel zur Einübung des Todes
Der Blick in den schwindelerregenden Abgrund: Wie Herr G. in Søren Kierkegaard einen »Seelenverwandten« fand
Herr G. in Paris: mit Sartre in der Dachkammer
INTERMEZZO: Wie Herr G. seinen Physiker-Freund Doc besuchte und wie die beiden bei Veggie-Würstchen mit Senf über den freien Willen debattierten
Angstfrei durch Ego-Auflösung: Wie sich Herr G. vom Griesgram Arthur Schopenhauer in der Kunst der Willensverneinung unterweisen ließ
KAPITEL 3 – HERR G. IN THERAPIE
Wie Herr G. in Denkfallen tappte und die Kunst des Kontrollverzichts lernte
Wie Herr G. die Welt als unsicheren Ort erlebte
Herr G. und das Problem mit dem Eisbären
KAPITEL 4 – HERR G. UND DIE WISSENSCHAFT
Wie Herr G. Nachhilfeunterricht in Biologie und Neurowissenschaft nahm
Ein Blick in Herrn G.s’ Gehirn: Amygdala vs. präfrontaler Cortex – von gezückten Messern, Hamsterkäufen und Adrenalin-Öfen
Herr G. und das große Jucken
KAPITEL 5 – HERR G., DER KÖRPER UND DIE SINNE
Die Forrest-Gump-Methode: »Lauf, Herr G., lauf!« Oder: Wie Herr G. zum Triathleten wurde
Wie Herr G. im Rhythmus eines Balls zu atmen versuchte
Wie Herr G. auf Hochzeiten sang und sich von Musik berühren ließ
Welche Erfahrungen Herr G. im Jazz- und Techno-Club machte
KAPITEL 6 – DER SANFTE WEG DES GEISTES
Mentale Übungen gegen die Angst: Wie Herr G. seinen inneren Kritiker zu besänftigen versuchte
Schritt 1: Wie Herr G. sich in Achtsamkeit übte und mit seinem Neffen spielte
Schritt 2: Von Drachen und Dinosauriern – Wie Herr G. zum Dompteur seines inneren Kritikers wurde (und ihm sogar einen Namen gab)
Schritt 3: Wie Herr G. sich in Selbst-Mitgefühl versuchte und einen Brief an sich selbst adressierte
Schritt 4: Wie Herr G. lernte, der Angst ein »größeres, besseres Angebot« entgegenzusetzen: Neugier
Beginner’s mind: Wie Herr G. die Welt mit den Augen eines Kindes zu sehen lernte
Schritt 5: Wie Herr G. nach Werten zu leben statt nach Zielen zu streben begann – und wie er die Angst durch konkretes Handeln zu bezwingen versuchte
Wie Herr G. versuchte, auf Werte Taten folgen zu lassen
Schritt 6: Wie sich Herr G. der größten aller Ängste stellte – der Angst vor dem Tod
INTERMEZZO: Wie Herr G. bei seinem Physiker-Freund Doc anrief, weil er wissen wollte, ob es so etwas wie ein »außerkörperliches Bewusstsein« geben könnte
Schritt 7: Wie Herr G. Spiritualität als Ressource entdeckte und sich zu höheren Bewusstseins-Ebenen aufmachte
KAPITEL 7 – HERR G. UND DAS HÖHERE BEWUSSTSEIN
TEIL 1: Herr G. als Yogi – von Mentalitätsmonstern und höchsten Glückserfahrungen
TEIL 2: Herr G. als Schüler des Buddha – auf dem Weg zur großen Befreiung
Buddha und die Sache mit dem Nicht-Ich
INTERMEZZO: Wie Herr G. mit Doc bei Veggie-Würsten und Senf über Teilchenphysik, Materie und das (Nicht-)Ich debattierte
Herr G. auf der Suche nach Nicht-Ich-Erfahrungen: vom Sternenhimmel und anderen Drogen
Der große und der kleine Tod
Die drei Wurzeln heilsamer Handlungen: Klarheit, Großzügigkeit und Liebe – oder: Der große Durchbruch
Wie Herr G. im Schweige-Retreat den Gong überhörte
KAPITEL 8 – DER BRIEF
Wie Herr G. einen Brief an seinen Neffen schrieb
KAPITEL 9 – DAS BUCH
Wie Herr G. mit dem Schreiben eines Buchs begann, um nicht zu vergessen – und wie er dabei auf die Erkenntnisse seiner Reise zurückschaute
DANKSAGUNGEN
LITERATURVERZEICHNIS
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
EINLEITUNG
Herr G. hat Angst. Damit beginnt diese Geschichte. Und als Mensch, der mit der Angst vertraut ist, muss der Autor dieser Zeilen zunächst darauf hinweisen, dass in diesem Buch Themen behandelt werden, die Panikattacken und Angstzustände auslösen können. Deshalb sei all den Menschen, die mit der Angst ringen, nahegelegt, sich die Kapitelübersicht anzuschauen und jene Kapitel, die sich mit besonders angstbehafteten Themen befassen, nur in Momenten zu lesen, in denen sie sich stark genug fühlen – und am besten nur dann, wenn sie nicht allein sind. Ein Mensch wie Herr G. weiß: Es gibt fragile Augenblicke, in denen man sich schützen und besonders vorsichtig sein muss – und es braucht die Gemeinschaft, wenigstens einen Menschen, der da ist, zuhören und in den Arm nehmen kann.
Die »Heldenreise«, die Herr G. in diesem Buch unternimmt – obwohl er ganz und gar nicht für sich in Anspruch nehmen kann, ein Held zu sein, im Gegenteil –, sie ist eine Reise mit der Angst, gegen die Angst und durch sie hindurch – ein Abenteuer, das an Orte und zu Erkenntnissen führt, mit denen Herr G. selbst nicht gerechnet hätte.
Je weiter er reist, desto klarer wird ihm, dass es sich bei seiner Angst nicht einfach um ein »Problem«, eine »Störung« oder einen »Fehler« seiner Psyche handelt, der sich mal eben durch eine Coaching-Session, eine Masterclass oder eine Mindfulness-App bewältigen lässt, sondern dass es dabei um the big picture geht, also um das große Ganze – mit allem, was zum menschlichen Leben dazugehört: Leid und Freude, Schmerz und Glück, Ernst und Albernheit, Weinen und Lachen, Wachstum und Tod.
Ja, die Angst scheint ihm eng mit den großen existenziellen Fragen verwoben zu sein. Einerseits ist sie etwas sehr Allgemeingültiges, Allzumenschliches, andererseits etwas sehr Persönliches. Ja, jeder Mensch hat wohl »seine persönliche, individuelle Form der Angst, die zu ihm und seinem Wesen gehört«,[1] abhängig von Lebensbedingungen, Anlage und Umwelt. »Sie hat eine Entwicklungsgeschichte, die praktisch mit unserer Geburt beginnt.«[2]
Deshalb ist aus diesem Buch kein allgemeiner Ratgeber oder »Angst-Kompass« geworden, in dem das große Anti-Angst-Geheimnis gelüftet wird: die eine Methode, »die Ihr Leben verändern wird«, oder »Die sieben Schritte zur Angstlosigkeit«. Solche Bücher haben sicher ihre Berechtigung, doch etwas so Großes und Monströses wie die Angst verlangt mehr als das, was ein klassisches Sachbuch liefern kann, nämlich: echtes gelebtes Leben, das ganze Chaos menschlicher Erfahrung, viel Humor – und: Trost. Ja, eine Erzählung, die im Angesicht drohender und realer Katastrophen Trost spenden kann, ohne dabei falsche Versprechen zu machen und den Weg zum Glück als bloße Sache des Mindsets zu verklären.
Deshalb also diese persönliche Erzählung von einem »irrenden Ritter«, wie es im Don Quijote heißt. Von Herrn G., angefangen bei dessen Geburt und von dort aus weiter durch die Irrungen und Wirrungen seines Lebens. Von einem Menschen, der ganz und gar nicht außergewöhnlich oder einzigartig ist, der die Angst einfach nur sehr stark spürt – so stark, dass er geradezu gezwungen ist, sich mit ihr auseinanderzusetzen, und dem diese Auseinandersetzung auf diese Weise ungewollt zur Lebensaufgabe wird, ob nun durch einen Zufall oder durch eine Weisung des Universums, wer weiß das schon so genau.
So macht sich Herr G. auf, ein »Ritter von verängstigter Gestalt«, um gegen echte und eingebildete Ungeheuer zu kämpfen, auf der Suche nach einer robusteren Rüstung, die ihn gegen Angstzustände und Panikattacken zu wappnen vermag. Ohne Pferd und ohne Visierhelm, dafür mit einem gigantischen Stapel aus Büchern, Podcasts und Dokumentarfilmen, einer Kiste voll von Erinnerungen und einer großen Lust auf neue Erfahrungen. Begleitet von tapferen Gefährt:innen, Freund:innen und Lehrer:innen. Um der Angst ein für alle Mal »den Garaus zu machen«, wie es in Abenteuerromanen heißt, wenn das überhaupt möglich und wünschenswert ist: die Angst im Kampf zu bezwingen. Die große Frage, vor der Herr G. steht, ist schließlich die, ob er ein gutes Leben mit der Angst führen kann oder ob sie sich vielleicht sogar vollständig auflösen lässt wie eine Kopfschmerztablette in einem Glas Wasser.
Aber wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen. Lest selbst.
Vorrede und Gegendarstellung des sogenannten »inneren Kritikers«, der sehr aufgebracht ist und eine dringende Warnung aussprechen muss
Um Schlimmeres zu verhindern, muss ich an dieser Stelle eine Warnung aussprechen. Diesen Herrn G., von dem Sie hier lesen müssen, kenne ich sehr gut. Und um es direkt und ohne Umschweife zu sagen: Ich halte ihn für einen verwöhnten Jammerlappen von traurigster Gestalt, der Ihre Aufmerksamkeit und Ihren guten Willen missbraucht, um seine Neurosen, Ängste und Sorgen rücksichtslos und unerträglich larmoyant auszubreiten, die noch dazu allesamt Luxusprobleme sind, die Probleme eines wohlstandsverwahrlosten Weichlings, der von echtem Leid und wirklichen Problemen nicht die geringste Ahnung hat, dem auch jedes Gespür für andere Lebensrealitäten fehlt.
Herzlichen Glückwunsch (oder besser: Herzliches Beileid!), Sie haben sich das Buch eines Hochstaplers gekauft, der sich ein wenig Theorie zusammengelesen hat und so tut, als wüsste er, wovon er spricht. Sie halten das Buch eines Narzissten in der Hand, jawohl, der sich einredet, er könne mit seinem Geschreibsel anderen helfen, er tue also etwas Altruistisches, dabei ist dieses Buch nichts als jämmerliche Selbsttherapie, die nur einem dient: dem Ego des Autors. Wenn Sie es genau wissen wollen: Dieser auf der Sonnenseite des Lebens geborene Herr G. bleibt ständig hinter seinen eigenen Ansprüchen und Idealen zurück.
Er nennt sich auch nur »Herr G.«, weil er sich verstecken will. Ja, in der Tat, er wagt es nicht einmal, »Ich« zu sagen und mit seinem Namen hinter dem Unsinn zu stehen, den er hier auf 304 völlig ungenießbaren Seiten ausbreitet. Seine leicht durchschaubare Strategie ist es, diese Perspektive als einen ganz schlauen Kniff zu verklären. Doch das ist überhebliches und vollkommen leeres Gerede, von dem Sie sich nicht täuschen lassen dürfen, nur weil es angenehm formuliert ist.
Seien wir mal ehrlich: Eigentlich kann er noch nicht einmal das: angenehm formulieren. Am haarsträubendsten wird es, wenn er – unoriginell, wie er nun mal ist – auf den Zug der Spiritualität aufspringt, sich auf »höhere Bewusstseinsformen« beruft und in yogischen und buddhistischen Kulturen zu wildern beginnt, die ihm eigentlich fremd sind und auf deren Aneignung er als deutscher Protestant kein Recht hat. Überhaupt macht er sich in nahezu allem, was er von sich gibt, der Ignoranz schuldig.
Deshalb, Kritiker dieses Landes, verbündet euch mit mir: Zerfetzen Sie diesen Nichtsnutz! Oder besser: Ignorieren Sie ihn! Strafen Sie ihn mit eisigem Schweigen. Er hat den Applaus nicht verdient, denn er ist ein wertloser (Selbst-)Betrüger, der nur eine innere Rechtfertigung dafür sucht, dass er Philosophie studiert hat, statt etwas Anständiges aus seinem Leben zu machen und wirklich produktiv zum Bruttoinlandsprodukt und technologischen Fortschritt beizutragen.
Ach ja, falls Sie entgegen meiner Warnung doch weiterlesen – ich sage es Ihnen noch mal: Legen Sie dieses Buch weg! –, dann sei hier noch einmal ausdrücklich darauf verwiesen, dass in diesem – ich mag es noch nicht einmal »Buch« nennen –, in diesem … »Etwas« auch über mich zu lesen ist. Es handelt sich bei jedem Satz um eine abscheuliche und verlogene Falschdarstellung, so werde ich – um nur ein Beispiel zu nennen – mit einem Diktator (!) verglichen. An anderer Stelle werde ich gegen meinen Willen in einen »Ben« umbenannt. Wer soll das sein? Ich bin es nicht. Dagegen verwehre ich mich jedenfalls mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln, auch juristischen, jawohl.
Gezeichnet
Der »innere Kritiker«, der eigentlich nichts anderes als »die Stimme der Vernunft« ist
KAPITEL 1 – HERR G. UND DER RISS
Wie die Angst zu Herrn G. kam
Wenn in allen Dingen ein Riss ist, durch den das Licht scheinen kann, wie Leonhard Cohen einst gesungen hat, musste man dann nicht aufpassen, dass nicht noch anderes mit hindurchkroch durch diesen Riss? Wer konnte sicher sein, dass nicht auch Angst durch Risse drang? So wie ein Sonnenstrahl eine kleine Lücke in der Jalousie dazu nutzen konnte, Licht in ein Zimmer zu streuen, so suchte sich auch die Angst Lücken im mentalen Abwehrmechanismus eines Menschen. Sie konnte sich an einen harmlos scheinenden Gedanken hängen, um – einmal im System – mit aller Macht zuzuschlagen. Plötzlich war sie da, die Angst, und sie ging nicht mehr fort.
Wann begann das bei Herrn G. mit der Angst? Wann kroch sie in sein Leben? Durch welchen Riss, durch welche Lücke?
Herr G. hatte verschiedene Erklärungen dafür. Eine davon war seine Geburts-Theorie, die auf Erzählungen seiner Eltern beruhte: Kaum hatte er das Licht der Welt erblickt, schlug man Alarm auf der Entbindungsstation. Herr G. hatte Fruchtwasser in der Lunge – und das war keine so gute Sache, weil er daran zu ersticken drohte. Statt sich also auszuruhen, hieß es für den gerade erst aus dem Mutterleib geschlüpften Herrn G.: Noteinsatz, Fruchtwasserentfernung und Transport in ein anderes Krankenhaus. Wenn es schon so losging, dachte sich Herr G., wie sollte da ein tiefenentspannter Mensch aus ihm werden, der daran glaubte, dass alles gut werden würde?
Andererseits: Es ging ja gut. Er erstickte nicht, verbrachte die ersten Tage seines Lebens allerdings in so einer Art Brutkasten. Da muss es passiert sein, da war der Riss, dachte Herr G. Dort, in dieser Säuglingsschale, muss dem schutzlos ausgelieferten Frischling die Angst in die Glieder gekrochen sein. Von da an also hatte Herr G. Angst. So wollte es die Geschichte, die er sich selbst erzählte. Und was waren wir anderes als die Geschichten, die wir uns von uns selbst erzählten? Zumindest schien dies der früheste Beleg für Herrn G.’s Vermutung, dass immer alles schiefgehen und sich zum Schlechten wenden konnte, dass ein Mensch wie er, Herr G., immer auf der Hut sein musste.
Dabei wuchs er in einer Zeit des Optimismus auf. Es waren die 1990er-Jahre in Südwestdeutschland. Die Mauer war gefallen, Deutschland wiedervereint, die Sache schien zugunsten der liberalen Demokratie entschieden. Davon bekam der gerade erst geborene Herr G. zwar wenig mit, doch von den großen Versprechen dieser Zeit profitierte auch er: Freiheit, Fortschritt, Frieden. Wohlstand, Sicherheit, Aufstieg durch Leistung. Als Kind einer Mittelschichtsfamilie war das Aufwachsen für einen Menschen wie Herrn G. verhältnismäßig bequem: Er war frei von finanziellen Zwängen und struktureller Diskriminierung, er konnte seine Talente frei entfalten, ein sorgenfreies Leben zwischen Schule, Sportverein und Musikunterricht führen. Er musste nicht auf der Hut sein, er war behütet. Von seinen Eltern geliebt, umsorgt und gefördert. Sozial eingebunden in Freundeskreise und Vereinsstrukturen.
Und trotzdem lauerte ihm immer wieder die Angst auf, an harmlosen Sonntagnachmittagen, wenn er vom Fußball nach Hause kam: eine plötzliche Beklemmung in der Brust, ein flaues Gefühl im Magen. Enge, Dunkelheit. Panik. Warum?
Vielleicht ja deshalb, weil er aus der Fruchtwasser-Episode als Asthmatiker hervorgegangen war. Die allerersten Panikattacken, an die er sich erinnern konnte, hatten damit zu tun, dass er keine Luft mehr bekam, oder aber den Eindruck hatte, keine Luft mehr zu bekommen. Der Brustkorb schnürte sich zusammen, alles wurde enger und immer enger. Herr G. schnappte nach Luft, bekam sie aber einfach nicht in seine Lunge hinein. Ein Kind, das nicht wusste, wie ihm geschah, und das dringend eine Dosis Kortison brauchte. Dabei war es meist gar nicht so, dass Herr G. tatsächlich keine Luft mehr bekam, es war mehr die Angst davor, keine Luft zu bekommen, die Panik in ihm auslöste, was ihm noch weniger Luft zum Atmen ließ. Ein Teufelskreis, oder eher: eine Teufelsspirale, die auf Eskalation ausgelegt war.
Angst lernte Herr G. schon damals als Enge kennen, als physische Enge – etwas, das einem den Brustkorb zuschnürte. Es wunderte ihn nicht, als er später erfuhr, dass Angst und Enge etymologisch verwandt waren, dass beide Begriffe auf eine gemeinsame indogermanische Wurzel zurückzuführen waren.[3] Inhalierte er sein Kortisonspray, brachte das die Weite zurück in seinen Brustkorb, einen Raum, in dem wieder geatmet und gelebt werden konnte. Als Kind ging Herr G. niemals ohne sein Inhalierspray aus dem Haus, schon allein aus Gründen der Selbstberuhigung. Stellte er fest, dass er es vergessen hatte, genügte das, ihn in Panik zu versetzen, auch wenn er es akut gar nicht brauchte.
Fehlte einem Menschen die Luft zum Atmen, dachte Herr G. später, als er kein nach Luft schnappendes Kind mehr war, so war es doch wenig überraschend, dass er mit Angst reagierte, mit einer Überlebensangst, die vielleicht sogar notwendig und nützlich war. Auch Tiere hatten diese Angst, sie war die Reaktion auf eine unmittelbare Bedrohung von Leib und Leben. Sigmund Freud, der Tiefenpsychologe, nannte sie deshalb »Realangst«, wie der erwachsene Herr G. später las, »eine uns begreiflich scheinende Reaktion auf die Gefahr, d. h. auf erwartete Schädigung von außen«[4]. Die Angst der Maus vor der Schlange, die Angst der Gazelle vor dem jagenden Gepard. Im Englischen bezeichnete man sie als fear, als »Furcht« vor einer konkreten Gefahr, auf die Tiere und Menschen (die ja auch nichts anderes als Tiere waren) mit fight, flight oder freeze reagierten. Egal ob Kampf, Flucht oder Erstarren – das Ziel war, zu überleben.
Doch es gab da noch eine andere Form von Angst, die nicht direkt mit der Bedrohung von Leib und Leben zu tun hatte und deren evolutionsbiologischer Nutzen erst einmal weniger einleuchtete. Freud nannte sie »durchaus rätselhaft, wie zwecklos«[5], eine »neurotische Angst« – »als frei flottierende, allgemeine Ängstlichkeit, bereit, sich vorübergehend mit jeder neu auftauchenden Möglichkeit zu verknüpfen, als sogenannte Erwartungsangst«[6]. Eine Angst, die aus der Vorstellungskraft zu erwachsen schien, aus der Fähigkeit, sich Dinge gedanklich auszumalen oder einzubilden, und die Herrn G. an harmlosen Sonntagnachmittagen überfiel – ja, tatsächlich sehr häufig an Sonntagnachmittagen. Eine diffuse Endzeitstimmung, das Ende der Woche nahte, als wäre es das Ende der Welt. Eine seltsame Erwartung von schlimmen Dingen, die da warteten.
Was genau war dieses Schlimme, das auf ihn wartete? So genau konnte es Herr G. gar nicht benennen. Die Angst eines Kindes vor der Schule? Vor unangekündigten Mathe- oder Lateinvokabel-Tests? Schon wenn er an das Parfum seiner Mathe-Lehrerin dachte oder an die grimmige Miene seines Latein-Lehrers, der immer mit der Faust auf den Tisch schlug und dabei angeblich schon einmal seine Armbanduhr zertrümmert hatte, wenn nicht sogar das ganze Handgelenk, wurde ihm ganz merkwürdig im Magen. War es also die Angst vor den Prüfungen, die das Leben eben mit sich brachte – und die Herr G. sich nicht so recht zutraute? Eine seltsame Drohkulisse baute sich vor ihm auf und schüchterte ihn ein: ausgerechnet ihn, dem alle Türen offen standen und der gefälligst etwas draus machen sollte, aus sich und seinem Leben, aus seinen Träumen. So saß er vor jeder neuen Woche wie die Maus vor der Schlange.
Genauso beim Fußball, vor einem wichtigen Punktspiel, einem Pass, einem Elfmeter. Was, wenn es schiefging? Wenn er dem Druck nicht gewachsen war? Nein, das war keine Option, er durfte kein Verlierer sein, kein Schwächling, kein Jammerlappen. Er musste etwas aus sich machen. So ging er damals, im entscheidenden Spiel um den Aufstieg – mit seiner Kapitänsbinde am Arm und einem flauen Gefühl im Bauch – von der Mittellinie auf den Elfmeterpunkt zu, die Augen aller Zuschauenden auf sich gerichtet. Ohne einen wirklichen Plan, wohin er den Ball schießen wollte: Links unten in die Ecke? Blindlings in die Mitte? Oder doch volles Risiko oben rechts ins Dreieck?
Er senkte den Blick, nahm Anlauf – und schoss den Ball: übers Tor. Als er dem Ball nachschaute, wie er über die Latte dem bewölkten Himmel entgegensegelte, hörte er von fern den Jubel der gegnerischen Mannschaft und – paradoxerweise noch viel lauter – die stille Enttäuschung der eigenen. Geknickt und voll Scham schlich er zurück zur Mittellinie. Herr G., der Versager. Nervenschwach, wie er nun mal war, hatte er dem eigenen Team die Meisterschaft versaut. Und so jemand nannte sich Kapitän. Statt Aufstiegsfeier: Frustbier. »Danke, Herr G., danke für nichts!«, sagten nicht etwa seine Teamkollegen, auch nicht die Zuschauenden, nein, das sagte er sich selbst.
Eine Fünf minus in einer Klassenarbeit oder ein kläglich verschossener Elfmeter waren vielleicht nicht vergleichbar mit einem potenziell lebensbedrohlichen Asthma-Anfall oder dem berühmten Säbelzahntiger, der hinter dem Busch darauf wartete, ihn zu zerfleischen. Doch so seltsam das war, manchmal wünschte sich Herr G. in solchen Situationen den Säbelzahntiger geradezu herbei, der ihn zerfleischen würde. Denn die Folgen, die eine schlechte Note oder das Versagen auf dem Fußballplatz nach sich ziehen konnten, erschienen ihm weitaus bedrohlicher: die Enttäuschung der Eltern, Lehrer:innen, Trainer, Mitspieler und Zuschauenden, der Verlust des Ansehens, der eigenen Stellung in der Mannschaft, in der Klasse, in der Welt – letztlich: der Verlust der Liebe.
Deshalb war Herr G. auch immer über alle Verhältnisse nervös am Morgen vor einer Prüfung oder einem wichtigen Spiel. Mit wenig Vertrauen in seine Fähigkeiten, in ständiger Angst vor einer höheren Instanz, die ihn für sein Fehlverhalten strafen und sanktionieren würde, vor einem Gericht, das ihn verurteilen würde, in dem die Erwartungshaltungen aller Autoritäten zusammenschmolzen. Dieses Gericht trug Herr G. immer in sich, als innere Stimme und inneren Kritiker, immer bereit, ihm ein schlechtes Gewissen einzureden, auf ihn einzuprügeln: »Wie kannst du nur?« – »Was denkst du nur?« – »Das reicht so nicht.« – »Willst du ein Verlierer sein?« – »Nicht genug!«
War das nicht der Grundrhythmus, dem sein Leben folgte? »Nicht genug. Nicht genug. Nicht genug.« Im stampfenden Takt eines galoppierenden Pferds oder einer voranpreschenden Eisenbahn, unter die er sich manchmal gern gelegt hätte, damit er diesen Druck nicht mehr ertragen musste, diesen verdammten Druck.
Ja, der innere Kritiker war ein unermüdlicher Kläger, der Herrn G. unaufhörlich auf die Anklagebank zwang. Ein Choleriker, der überspitzte und dramatisierte, in unverhältnismäßiger und unfairer Art und Weise vortrug, was Herrn G. zur Last gelegt werden konnte. Und Herr G. verbrachte unendlich viel Zeit damit, sich Verteidigungsstrategien zurechtzulegen, Argumentationen, die ihn entlasteten, die den Richter milde stimmen konnten. »Habe ich nicht mein Bestes versucht, meine Hausaufgaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und sogar Sondertrainingseinheiten absolviert? Was hätte ich denn noch tun sollen?«
Vielleicht war die Angst also gar nicht in den Brutkasten geschlüpft, in dem Herr G., der wehrlose Säugling, seine ersten Lebensstunden zugebracht hatte, sondern in seinen Schulranzen, an einem Morgen auf dem Weg zu einer Klassenarbeit, vor der er sich fast in die Hose gemacht hätte und die dann auch in die Hose ging. Eine Drei minus bedeutete: Weltuntergang. Tränen, Verzweiflung, Panik. Das Leben war voller Risse, durch die die Angst kriechen konnte. Voller Möglichkeiten, zu versagen, sich schuldig zu machen.
Doch wo war der Richter? Und wer war das überhaupt? Wer richtete über seine Fehler und sein Versagen? Es war, als bereitete er sich minutiös auf eine Gerichtsverhandlung vor, die nie stattfand. Als versuchte er einen Richter milde zu stimmen, der nie zur Verhandlung erschien. Ein bisschen wie die Hauptfigur Josef K. in Kafkas Roman Der Proceß, über den Herr G. in seiner Abiturprüfung schreiben musste. Mit zitternder Hand, weil er sich vor seinem inneren Gericht natürlich nicht ohne Bestnote sehen lassen konnte.[7]
Später verstand Herr G. all diese Dinge besser – als er schlaue Bücher von Soziolog:innen, Philosoph:innen und Psycholog:innen zu lesen begann und darin Erklärungen für seine Angst fand; als er von Max Weber und der »protestantischen Ethik« las, deren übersteigerte Arbeitsmoral auf persönlichen Schuldgefühlen fußte und die in Südwestdeutschland offenbar verbreitet war. Oder vom Soziologen Zygmunt Bauman, in dessen Buch er auf den Begriff der »sekundären Angst«[8] stieß.
Genau das war die Angst, die es Herrn G. so schwer machte, die über die Furcht vor konkreten Dingen und Situationen hinausging: vor Spinnen, zu engen Aufzügen, dunklen Parks, zu vielen Menschen oder schwindelerregender Höhe. Mit der sekundären Angst, so lernte Herr G., ging ein konstantes Gefühl von Unsicherheit (»Die Welt ist voller Gefahren, die zu jeder Zeit und ohne jede Warnung zuschlagen können«) und Verletzlichkeit einher (»Wenn die Gefahr zuschlägt, dann wird es wenig oder keine Chance des Entkommens oder der erfolgreichen Verteidigung geben«).[9]
Das hätte Herr G. genau so unterschreiben können, das war seit jeher eine Grundüberzeugung von ihm gewesen, denn er rechnete stets damit, dass Gefahren ohne Warnung zuschlugen und dass ihn jeder kleine Fehler in den Abgrund führen konnte. Seine Vorstellungskraft half ihm dabei, sich diese Szenarien auszumalen. Von einer schlechten Note in der Schule führte ein Weg in die Hoffnungslosigkeit, genauso von enttäuschenden Leistungen auf dem Fußballplatz.
Ein Mensch wie Herr G. lebte immer in zwei Welten: In der einen funktionierte er, führte ein erfolgreiches Leben und trieb sich zu Bestleistungen, die von außen leicht und mühelos aussahen, in der anderen quälte er sich mit Horrorszenarien, übersteigerter Selbstzerfleischung und Auto-Aggression. Ja, er konnte schon als Kind so panisch und wütend auf sich sein, dass er sich selbst Ohrfeigen verpasste oder seine Stirn gegen die Wand schlug, wenn er an einer Aufgabe scheiterte oder etwas nicht so gut hinbekam, wie er es gern gehabt hätte. Später schlug und ohrfeigte er sich dann mehr im übertragenen Sinn, also innerlich. Vielleicht ein Erbe des Protestantismus? Dabei war er gar nicht religiös erzogen und trat später auch aus der Kirche aus. Doch religiöse Vorstellungen waren mächtig und tief in Kultur, Sprache und Erziehung hineingesickert. Herr G. war davon möglicherweise stärker geprägt, als er sich das hätte eingestehen wollen.
Vielleicht hatte es auch mit dem Aufwachsen in einer Gesellschaft zu tun, die einen enormen Selbstverwirklichungsdruck auf ihre Individuen ausübte und von jedem Einzelnen verlangte, einzigartig zu sein – und durchsetzungsstark. So wichtig der Prozess der »Ich-Werdung« entwicklungspsychologisch sein mochte: Die Gesellschaft, in der Herr G. groß wurde, schien es damit etwas zu übertreiben. Das war von Soziologen ja eindrücklich beschrieben worden, von Andreas Reckwitz zum Beispiel, der vom Phänomen der »Singularisierung«[10] sprach, nach der sich jedes Ich mit einzigartigen Qualitäten hervortun und das mühsam kuratierte Selbst als unverwechselbare Marke aufmerksamkeitswirksam inszenieren musste. Immer bereit, sich neuen Markt-Dynamiken anzupassen, sich weiterzuentwickeln, um nicht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren, die bekanntlich niemals schlief.
Hartmut Rosa sprach von »dynamischer Stabilisierung«:[11] Wer seine Stellung halten wollte, musste sich steigern. Wer stehen blieb, drohte abzurutschen und im sozialen Nichts zu verschwinden. Dadurch entstand eine Welt der um die Wette strampelnden Einzelkämpfer und Solitäre – eine Welt, in der »der ängstliche Mensch hervorragend gedeihen konnte«, wie der Autor Daan Heerma van Voss schrieb. Er fügte hinzu: »Man kann in einer sehr liebevollen, intakten Familie aufwachsen und dennoch übermäßige Ängste entwickeln, und das einfach nur, weil man im Hier und Jetzt lebt.«[12]
Folgte man den soziologischen Analysen, war Herr G. aufgewachsen in einer Wettbewerbskultur mit eingebauter Steigerungslogik, in der man nicht nur in beruflicher Hinsicht etwas Besonderes aus sich machen musste, sondern auch im Privaten: Gefeiert wurde nicht, wer sich in der freiwilligen Feuerwehr engagierte oder ehrenamtlich Nachhilfeunterricht gab, wer sich in einer Partei für soziale Gerechtigkeit oder ein Jugendzentrum einsetzte, wer sich zur Pflegekraft oder zum Sozialarbeiter ausbilden ließ, sondern wer besonders ausgefallene Reiseziele, eine besonders prestigeträchtige Wohnung mit ausgesuchten Design-Möbeln vorzuzeigen hatte.
So jetteten hoch beschäftigte Menschen durch die Welt, posteten Strandurlaubsbilder von überwältigenden Naturparadiesen, die sie durch ihre Flugreisen zusehends zerstörten. Immerzu auf der Jagd nach dem Außergewöhnlichen und getrieben von FOMO(fear of missing out) – der Angst, eine Karriere-Chance oder ein intensives Erlebnis zu verpassen. Den einen großen Anruf, Job oder Trip, die eine große Party, bei der man unbedingt dabei gewesen sein musste. Man lebte schließlich nur einmal. So wurde das Leben zur stetigen Torschlusspanik, da sich immerzu irgendwo ein window of opportunity zu schließen drohte.
Auch Herr G. hatte gelernt, nach diesen Regeln zu spielen, die natürlich nur für sehr wohlhabende Menschen mit einem entsprechenden Reisepass relevant waren, denn wer konnte sich so einen einzigartigen Lebensstil überhaupt leisten, und wer hatte Zugang zu all diesen überwältigenden Orten? Wer hatte das Recht auf Selbstverwirklichung und Individualität – und wem blieb es verwehrt?[13] War die Angst, die sich aus dem Exzellenz- und Einzigartigkeitsdruck ergab, vielleicht sogar der Ausdruck eines unerhörten Privilegs? Wer hatte die Zeit, die finanziellen und mentalen Ressourcen, sich derart abstrakte Sorgen zu machen, beständig um sich selbst, um Reise-, Spaß- und Karriereziele zu kreisen? Und wer war schlichtweg mit dem Überleben beschäftigt?[14]
Herr G. fand dazu eine interessante Geschichte in einem Buch des Schriftstellers Avram Alpert, der für the good-enough life plädierte, also für die Idee eines Lebens, das gut genug war – und nicht great, also herausragend sein musste. Alpert wies darin auf eine Begegnung mit einer Schwarzen Frau hin, die nach einer Vorlesung zu ihm kam und sagte: »Ich weiß zu schätzen, was Sie versuchen, aber Schwarze Menschen, vor allem Schwarze Frauen können es sich nicht erlauben, nur gut genug zu sein. Wir müssen great sein.«[15]
Das spiegelte die Alltagserfahrung vieler Menschen wider, die jeden Tag diskriminierende Erfahrungen machten, die aufgrund ihres Namens, ihrer Hautfarbe, ihres Akzents, ihrer Herkunft das Gefühl hatten, immerzu besonders großartige Leistungen vollbringen zu müssen, um in ihrer Gesellschaft Fuß fassen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, um überhaupt als »wertvolles« Mitglied anerkannt zu werden.[16]
Oder schlimmer noch: Wenn Menschen nur aufgrund der Arbeitsleistung, die sie erbrachten, und nur aufgrund der Steuern, die sie bezahlten, in einem Land leben durften, wenn ihnen bei Jobverlust die Abschiebung und Ausreisepflicht drohte? Was diese Menschen durchmachten, welch einem existenziellen Druck sie ausgesetzt waren, das konnte ein Mensch wie Herr G. nur erahnen, indem er sich von ihren Erfahrungen berichten ließ oder Bücher las, die diese Erfahrungen beschrieben.
Herr G. war also das Kind einer hoch individualistischen, auf Glanz und Goldmedaillen ausgerichteten Wettbewerbsgesellschaft, die seine Wünsche und Ziele beeinflusste. Vielleicht hatte er sich aber auch ein Stück weit selbst zu einem ängstlichen Menschen erzogen, weil er Angst-Szenarien in seinem Kopf kultivierte und gedeihen ließ wie andere Tomaten oder Zucchini in ihren Vorgärten; weil er die Angst paradoxerweise nicht nur als lähmend empfand, sondern auch als Antreiber und Erfolgsgarant: Denn erfolgreich war er ja nur, weil er vorher alle Szenarien durchgespielt und sich auf sie vorbereitet hatte.
Vielleicht war es auch all dies zusammen, wer konnte das schon so genau sagen. Es war am Ende vielleicht sogar egal. Die Angst mochte in den Brutkasten oder in den Schulranzen oder in eine Trainingstasche oder wo und wie auch immer in sein Leben gekrochen sein, sie war jedenfalls da – und sie ging nicht mehr fort.
Und so empfand Herr G. das Leben nie als leicht und unbeschwert, sondern als schwer und bedrückend; weil er treue Begleiter bei sich hatte: das innere Gericht und die in alle Lebensbereiche hineinsickernde Angst. In einer Zeit des Aufbruchs, in der viele optimistisch schienen, war Herr G. voller Pessimismus. Ein Mensch, der gelernt hatte, überall Gefahren zu sehen, und der wenig Vertrauen hatte, am wenigsten in seine Fähigkeiten, diese Gefahren abzuwehren.
Dies war das Entscheidende: Herr G. überschätzte nicht nur die Bedrohung, die von einem Versagen in der Schule oder auf dem Fußballplatz ausging (es hätte genauso gut eine Ballett-Schule, eine Eiskunstlaufhalle oder ein Tennis-Court sein können), er unterschätzte vor allem auch seine eigenen Fähigkeiten, der Bedrohung gewachsen zu sein, sie bewältigen zu können. Genau das war die beste Definition von Angst, die Herr G. bisher finden konnte: Angst war die Überschätzung einer Bedrohung und die Unterschätzung der eigenen Fähigkeit, diese Bedrohung bewältigen zu können.
Wie die Angst Herrn G.’s Alltag vergiftete
Herrn G.’s Angst war also keine Antwort auf eine unmittelbare reale Gefahr, etwas Konkretes, das er vor sich sehen und anfassen konnte. Sie hatte mehr mit einer vagen Bedrohung in der Zukunft zu tun. Genau wie es der Soziologe Zygmunt Bauman beschrieb: »dieses vage, aber hartnäckige Gefühl von etwas Schrecklichem, das passieren würde und das all die Tage vergiftete, die wir doch eigentlich genießen sollten«.[17]
Wie genau vergiftete die Angst die Tage, die Herr G. doch eigentlich genießen sollte?
Herrn G.’s Angst suchte nicht immer den großen dramatischen Auftritt, sie zeigte sich im Alltag oft ganz beiläufig – zum Beispiel in allerlei neurotischen Kontrollhandlungen. So konnte Herr G. seine Wohnung nicht verlassen, ohne nicht mindestens dreimal zu überprüfen, ob nicht auch alle Fenster geschlossen waren und der Herd abgeschaltet. Vor längeren Reisen machte er Fotos von den Fenstern, der Küche, dem Herd, um sich notfalls vergewissern zu können, dass alles geschlossen und abgeschaltet war. Sollte er nicht auch vorsichtshalber die Kabel aus der Steckdose ziehen? Konnte sich so eine Mehrfachsteckdose nicht entzünden? Und was konnte eigentlich passieren, wenn ein Kabel zu nah an einem heißen Heizungsrohr lag? Ein Kabelbrand? Was, wenn in seiner Abwesenheit ein Rohr brach?
Er rüttelte auch immer an der Tür, die er gerade abgeschlossen hatte, dabei bis fünf zählend, und kehrte dann meist noch zweimal zurück, weil er sich plötzlich nicht mehr sicher war, ob er auch wirklich abgeschlossen hatte. So rannte er mitunter wie besinnungslos durchs Treppenhaus, auf und ab, an allem zweifelnd, vor allem an sich selbst und seiner Fähigkeit, ein unbeschwertes Leben zu führen, in dem man einfach die Wohnung verließ und die Tür abschloss.
Und ja, da war auch diese seltsame hypochondrische Neigung, die dazu führte, dass er sich alle nur vorstellbaren Krankheiten andichtete, darunter alles, woran ein Mensch des 21. Jahrhunderts im schlimmsten Fall sterben konnte. Herzmuskel- und Hirnhautentzündungen, Haut- oder Hodenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Blutvergiftungen und vieles mehr. Wie viel Zeit hatte er in Arztpraxen verbracht, um vorsichtshalber abklären zu lassen, was es mit dem geschwollenen Auge auf sich hatte. Schlug sein Herz nicht unregelmäßig? Was war das für ein Schmerz in seiner Brust? Warum hatte er plötzlich Punkte in seinem Blickfeld? Waren die schon immer da und fielen ihm jetzt erst auf? Oder waren sie der Beginn einer sich ankündigenden Netzhautablösung? Sollte er erblinden, wie würde das sein Leben beeinflussen? Welcher Arbeit würde er nachgehen, wie würde er Geld verdienen können?
Das Gefährlichste war in solchen Momenten, wenn Herr G. seine Symptome durch eigene Recherche einzuordnen versuchte, wenn er sich im Internet eine passende Diagnose zu seinen Beschwerden suchte, denn dies brachte ihn auf schnellstem Wege zu der unzweifelhaften Einsicht, dass er ganz gewiss diese oder jene todbringende Krankheit hatte. Ihm wurde dabei immer schwindlig und flau im Magen. Und schon saß er wieder im Wartezimmer einer Praxis, die möglichen Konsequenzen seiner erschütternden Selbstdiagnose im Kopf durchspielend.
Die Angst vor Viren galt für Herrn G. auch im übertragenen Sinn, für Computerviren nämlich. Die Vorstellung, dass ein Virus in sein System eindringen und es zum Erliegen bringen konnte, war ihm ein Graus. Jedes Mal, wenn er versehentlich auf Spam klickte oder wenn er beim Öffnen einer harmlosen Restaurant-Website auf eine etwas weniger harmlose Website weitergeleitet wurde, die ihn als Gewinner eines Millionen-Jackpots feierte, zerbrach er sich den Kopf darüber, was das nun wieder zur Folge haben und wie ihn das ruinieren könnte.
Wie sehr bewunderte Herr G. Menschen, die ihre Wohnung einfach so verlassen konnten, ohne Kontrollgänge, ohne an Türen zu rütteln. Wie sehr bewunderte er Freund:innen, die bei kleineren Symptomen nicht gleich an schlimme Krankheiten dachten, die ein Auto mieten konnten, ohne es vorher detailliert auf Schäden zu überprüfen und jede Auffälligkeit als Schadensmeldung aufnehmen zu lassen, nur zur Sicherheit, für den Fall, dass jemand käme und behauptete … Ja, Carsharing konnte eine sehr praktische, stressfreie Angelegenheit sein. Nicht für Herrn G., der zu viel prüfen und kontrollieren, sich gegen zu viele potenzielle Risiken absichern musste, die andere gar nicht sahen.
Wie sehr bewunderte er Menschen, die Verträge und Datenschutzerklärungen unterschrieben, ohne vorher das Kleingedruckte lesen zu müssen, Menschen, die einfach darauf vertrauten, dass es schon gut gehen würde und dass die Gegenseite ihnen nichts Böses wollte. Menschen, die Geld von der Bank abheben konnten, ohne den Automaten vorher auf mögliche Manipulationen zu prüfen und den eigenen Pincode mühsam gegen potenzielle betrügerische Blicke abzuschirmen. Wie sehr bewunderte er diese Menschen und wie sehr belächelte er sie zugleich für ihre Naivität. Waren das nicht Menschen, die Knebelverträge unterschrieben, die sich abzocken und übers Ohr hauen ließen?
Übersah Herr G. einen Satz in einem Vertrag, eine Schramme am Auto oder eine Manipulation am Bankautomaten, konnte das – ins schlimmstmögliche Szenario weitergedacht – dazu führen, dass er all sein Geld verlor, seine Miete nicht mehr bezahlen konnte und obdachlos wurde. Überhaupt Verträge: In juristischen Texten war immerzu die Rede von Schäden, Klagen, Rechtsverletzungen, von Strafen und Gebühren. Auf einen Menschen wie Herrn G. hatten diese Begriffe eine magische Anziehungskraft. Er blieb daran hängen wie eine Fruchtfliege an einem im Verfall begriffenen Stück Obst oder eine Wespe an einem zuckerhaltigen Sommergetränk. Verträge zu lesen, das bedeutete für einen Menschen wie Herrn G.: jede potenzielle Rechtsverletzung zu durchdenken. Wie könnte es dazu kommen? Wo musste er besonders wachsam sein?
Bevor er unterschrieb, las er Verträge so gründlich und gewissenhaft wie offizielle Briefe, die zum Beispiel an Ämter oder Hausverwaltungen gingen. Auch die nahm er sich immer und immer wieder vor, ehe er sie in einen Briefumschlag schob, um sie dann noch einmal herauszuholen und zu prüfen, ob er auch tatsächlich den richtigen Brief in den Umschlag gelegt hatte. War da nicht vielleicht doch ein Fehler, eine falsche Wortwahl? Hatte er etwas übersehen – ein kleines Detail, das man ihm zur Last legen konnte?
Wenn er die Tür zur Wohnung nicht richtig abschloss, konnte das dazu führen, dass jemand einbrach, um all seinen Besitz zu rauben. Wenn ihm bei der Arbeit Fehler unterliefen, konnte es passieren, dass er seinen Job und sein Ansehen, seine Stellung in der Welt verlor. Für einen Menschen wie Herrn G. waren eigentlich alle Gefahren, die Zygmunt Bauman beschrieb, fortwährend relevant: Die einen bedrohten Besitz und Leben, die anderen das soziale Gefüge, wieder andere bedrohten den eigenen Platz in der Welt, die eigene Identität und den Schutz vor gesellschaftlichem Ausschluss.[18]
Und wenn Niklas Luhmann, ein anderer Soziologe, recht hatte und Vertrauen ein Mechanismus zur Reduktion von Komplexität war, so war Herrn G.’s Kopf eine Komplexitäts-Produktionsmaschine, die überall Fallstricke vermutete, gegen die man sich abzusichern hatte. Jeder kleine Fehltritt konnte der Anfang vom Ende sein, der Stoß in den Abgrund. Der existenzielle Ruin.
Es war wie in der Geschichte vom Musiker Daniel, die der Soziologe Roland Paulsen in seinem Buch Die große Angst erzählte: Nach der Schule hatte Daniel ein paar Steine in den Fluss geworfen. Als er im Bett darüber nachdachte, kam ihm der Gedanke, dass er etwas Dummes getan haben könnte, weil die Steine ein Fahrrad getroffen haben könnten, das am Grund des Flusses vor sich hin rostete, weil sich der Rost gelöst und im Wasser verteilt haben könnte.
»Was, wenn der Rost, der sich vielleicht durch den Stein, den er geworfen hatte, vom Fahrrad gelöst hatte, nun die Fische im Fluss vergiftete? Ein irrer Gedanke. Das war ihm sofort bewusst. Dennoch: Das Risiko bestand. Und wenn er eine derartige Katastrophe verursacht hatte, musste er dann nicht auch die Verantwortung dafür übernehmen?«[19]
Solche Gedankenketten waren Herrn G. wohlvertraut. Auch kleine Dinge konnten große Wirkung haben, aus jeder Mücke ein Elefant, aus jedem Insekt ein gewaltiges Ungeheuer werden, das das Leben verschlang.
Als Herr G. eines Morgens in einem Hotel aufwachte und eine Bettwanze in seinem Bett entdeckte, war die Panik, die er sofort in sich aufsteigen fühlte, nicht der Tatsache geschuldet, dass diese über Nacht an seinem Körper Blut gesaugt hatte, auch wenn er den Gedanken daran verabscheute. Sie war eine Folge der möglichen Auswirkungen des Schädlings in seinem Bett, die sich Herr G. in Sekundenschnelle ausmalte. Ein Befall seines Koffers, seiner Wäsche, seiner Wohnung, die horrenden Kosten der Schädlingsbekämpfung, die Gefahr, im Freundeskreis – zumindest temporär – zu einem Aussätzigen zu werden, vor dem man sich in Acht zu nehmen hatte, wollte man keinen Befall in den eigenen vier Wänden riskieren.
Überhaupt, wie leicht aus Herrn G. ein Aussätziger, ein von allen Verstoßener werden konnte, wenn er nicht aufpasste. Eine Kleinigkeit konnte dafür ausreichen, eine unbedachte Bemerkung zum Beispiel. Das war auch ein Grund, weshalb sich Herr G. mit den sozialen Medien so schwertat. Jeder Post musste bedacht und auf alle Eventualitäten hin überprüft werden: Könnte sich jemand verletzt fühlen? Hatte er etwas Entscheidendes übersehen? Machte er sich vielleicht lächerlich? War das Foto, das er da posten wollte, nicht zu selbstdarstellerisch – oder schlicht zu langweilig? Sollte er wirklich ein Urlaubsfoto posten, das er vielleicht als schön empfand, das andere aber ärgerte, weil sie nicht im Urlaub waren, sondern arbeiten mussten? Was, wenn kaum jemand darauf reagierte, wenn er keine Likes dafür bekäme, wie sähe das aus? Oder schlimmer noch: Würde man über ihn herfallen, weil man einen Satz, ein Wort, eine Silbe falsch verstehen und falsch interpretieren konnte? Kurzum: Würde dieser Post oder diese Story seinen Ruf, seine berufliche Laufbahn, sein soziales Umfeld, sein ganzes Leben zerstören? Das Risiko bestand. Solche Dinge waren schon passiert. So kam es, dass Herr G. seine Posts so lange von allen Seiten betrachtete und überdachte, dass er sie am Ende lieber zurückhielt oder wieder löschte.
Dann die Angst vor finanziellen Fehlentscheidungen: Herr G. neigte dazu, vor jedem Kauf die Vor- und Nachteile abzuwägen, egal ob es sich dabei um neue Schuhe, eine Matratze oder eine Bratpfanne handelte – oft so lange, bis er sich gegen den Kauf entschied. Wenn er dann doch mal kaufte und der Kauf nicht das einlöste, was er sich von ihm versprochen hatte, konnte sich Herr G. über alle Maßen ärgern. Über das aus dem Fenster hinausgeworfene Geld und sich selbst, den verschwenderischen Bruder Leichtfuß.
Immer wenn sich der Ärger gelegt hatte, fragte sich Herr G., weshalb er sich das Leben selbst so schwer machte. Warum konnte er nicht gelassener und großzügiger sein, auch sich selbst gegenüber? Weshalb neigte er dazu, sich Freuden vorzuenthalten, im Restaurant lieber die günstigere Option zu wählen, auch wenn er mehr Lust auf die teurere gehabt hätte? Statt sich von Zeit zu Zeit etwas zu gönnen, zog er es vor, das Geld zu sparen – für später, wenn er es wirklich brauchte. Dass es schlimm kommen würde, hielt er ohnehin für ausgemacht. Auch dies das Ergebnis eines pessimistischen Weltbilds: das Jetzt und Hier gegen ein diffuses Später auszuspielen. Aus prinzipieller Sorge vor der Zukunft vorzusorgen.
Dabei war es vermutlich so wie in diesem Song von Baz Luhrmann (dessen kluger Text auf einer Rede der Kolumnistin Mary Schmich beruhte): Don’t worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing Bubble gum.[20] Die ewige Sorge vor der Zukunft, das unaufhörliche Lösen von Problemen, die möglicherweise entstehen könnten, wenn dies oder jenes einträfe, war wie der Versuch, eine mathematische Gleichung zu lösen, indem man Kaugummi kaute. Das war ein passendes Bild für das, was in Herrn G.’s Kopf vorging: Es war, als kaute sein Kopf ein Kaugummi nach dem anderen – und diese Kaugummis wurden immer härter und zäher, sie begannen seinen Kopf zu blockieren.
Viel schlimmer jedoch war die Angst, die Herrn G. immer dann auflauerte, wenn er sich am wenigsten wehren konnte, wenn es dunkel, kalt und einsam wurde, wenn sich seine Stimmung verdüsterte, an gottverdammten Sonntagnachmittagen. Das Gefühl von Einsamkeit konnte ein fruchtbarer Boden für die Angst sein. Wer sich nicht verbunden fühlte mit der Welt, der fiel ins Bodenlose. Herr G. kannte das gut. Das wild um sich schlagende Gefühl, alles falle in sich zusammen. Die Welt rückte weg – und Herr G. blieb allein zurück.
Wie damals, im ersten Monat seiner beruflichen Tätigkeit als freier Journalist in der Großstadt, ein sibirisch kalter Januar, der Himmel betongrau, als Herr G. allein in der Leere seiner Wohnung saß, in der Hoffnung auf Aufträge, doch niemand rief an. Seine Ideen: ungenügend. Vielleicht war er der Sache doch nicht gewachsen. Jeden Abend graute es ihm vor dem nächsten Morgen, der wieder nur Leere und Grau verhieß. Tagsüber Panikattacken und viel zu viel Kaffee, um kreativ werden zu können, doch wer panisch war, dem kamen keine Ideen. Und wer sie zu erzwingen versuchte, erreichte nur das Gegenteil.
Sogar später noch, als er sich vor Aufträgen kaum noch retten konnte, manche Nächte und alle Wochenenden durcharbeitete, weil er aus der Panik des einen erfolglosen Monats heraus nichts mehr absagte und alles annahm, was er bekommen konnte, sogar dann noch war er in ständiger Angst, dass niemand mehr anrufen würde, wenn er einmal Nein sagte oder seinen Job nicht gut genug machte.
Mitunter war es auch die Angst vor der Angst, die Herrn G. zu schaffen machte, die im Grunde wie eine Angst vor sich selbst war – oder vor dem, was in seinem Kopf vor sich ging, ein vorauseilender Angstgehorsam. Es war, als lebte Herr G. in einem Munch-Gemälde: Die Welt war ihm eine schrille Panik-Kulisse, durchdrungen von einem gellenden Schrei. Doch eines Tages beschloss er, das Munch-Gemälde zu verlassen. Den Rahmen des Bildes aufzubrechen, hinauszuklettern, sich auf den Weg zu einem sanfteren Ort zu machen, in eine weniger alarmierende Landschaft – und sich endlich von der Angst zu befreien.
Pandemie, Krieg, Klima-Panik: Herr G. im Angesicht echter Katastrophen – zwischen doomscrolling und Realitätsverweigerung
Als Herr G. beschloss, zu einem gelasseneren Menschen zu werden, fiel dies in eine Zeit, die von jedem Einzelnen besondere Vorsicht verlangte, in der es fast eine Tugend war, ängstlich und übervorsichtig zu sein: in die Zeit der Pandemie. Sie brachte kollektive Verhaltensweisen der Angst hervor. Panische Schnellschuss-Handlungen wie Hamsterkäufe, das klaustrophobische Gefühl, in Lockdown, Isolation oder Quarantäne eingeschlossen zu sein, oder die Angst vor Menschenmengen und gut besuchten öffentlichen Orten, an denen ein erhöhtes Infektionsrisiko bestand, ja überhaupt die ständige Angst vor Ansteckung.
Die Schlagzeilen waren alarmierend, die Bilder von überfüllten Krankenhäusern und erstickenden Menschen erdrückend. Sogar Wissenschaftler:innen waren hochgradig besorgt, die Zukunft schien ungewisser denn je. Die Menschen begannen Lebensmittelvorräte anzulegen und ihre Einkäufe mit Desinfektionsmitteln zu besprühen, genauso Türklinken und Schreibtischoberflächen. Vom einen auf den anderen Tag ließ sich nichts mehr planen. Sicherheit war eine Illusion, die es nun auch ganz offiziell nicht mehr gab. Stattdessen wurde das Leben zur fortwährenden Risiko-Abwägung. Jeder soziale Kontakt, jede Begegnung war möglicherweise die eine zu viel, jeder unbedachte Austausch von Grüßen möglicherweise fatal.
Mehr denn je traf das zu, was Zygmunt Bauman schon Anfang des Jahrtausends diagnostiziert hatte: Ours is, again, a time of fears.[21] Noch mehr, als wenig später der russische Angriffskrieg in der Ukraine begann und die Klimakrise immer drastischere Katastrophen mit sich brachte: nie da gewesene Hitzewellen, Brände, Starkregenereignisse und Überflutungen. Ja, wir lebten in einer Zeit der Angst, dachte Herr G., in der es nur eine Gewissheit gab: dass das Morgen schon nicht mehr wie das Heute war; dass auch die alten Versprechen passé waren: Frieden, Freiheit, Fortschritt, Sicherheit, Wohlstand, Aufstieg.





























