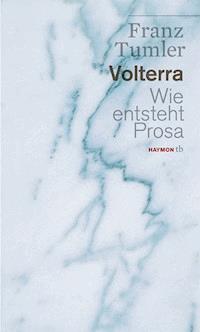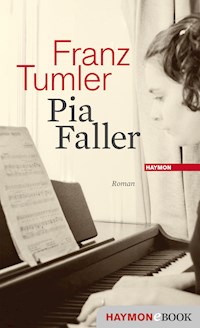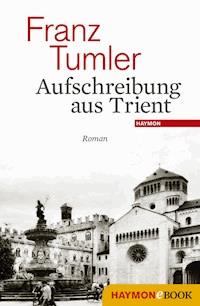Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In sprachlich einzigartigen Betrachtungen schildert einer der großen Autoren der deutschsprachigen Moderne seine Wahlheimat. Der Südtiroler Franz Tumler verbrachte die zweite Hälfte seines Lebens in Berlin. Dort teilte er den Kneipentisch mit Gottfried Benn, kam später mit Autoren wie Uwe Johnson, Günter Grass oder Peter Härtling zusammen. Seine Werke standen in einer Reihe mit den ihren. Dieser Band versammelt Essays, Erzählungen, Reportagen und Gedichte von Franz Tumler, die Berlin zum Thema haben, darunter auch unveröffentlichte Texte und Skizzen. Seine Themen sind vielfältig: von Zeit- und Alltagsgeschichte im geteilten Deutschland über das literarische Leben in Berlin bis zu Tumlers schriftstellerischer Wende hin zur erzählerischen Moderne, die für seine großen Romane stilbildend ist. In seinen Berliner Texten zeigt Franz Tumler im Kleinen, was seine Romane für Publikum und Kritik beispiellos gemacht hat - schlicht das Leben in ebenso kunstvoller wie sinnlicher Sprache.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Franz Tumler
Hier in Berlin,
wo ich wohne
Texte 1946 – 1991
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Toni Bernhart
Inhalt
Die Zeit der Einsicht
Ein kurzer Besuch in München
Berlin. Geist und Gesicht
Wintertage in Berlin
Muschel aus Traum
Die Dinge allein
Die Straße mit dem Auslieferungssalon
Auf der Autobahn
Hier in Berlin, wo ich wohne
Das Wort zum Tage
Berliner Tagebuch
Rede zur Enthüllung einer Gedenktafel für Gottfried Benn
Die letzte Woche vor Weihnachten
Die Schüsse auf Dutschke
Verringerung zu einem Stern
Stationen des Schreibens
Rede zum Gedenken Hans Scharoun
Berliner Fenster
Bild
Orte
Entwurf
Grunewald
Wohnung nahe der Stadtbahn
nur noch das Rauschen
Austausch
Aquarium Tegeler See
Chorin aufgesaugt
Nachwort
Textnachweise
Franz Tumler
Zum Autor
Impressum
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Die Zeit der Einsicht
1946, veröffentlicht 1952
Das Dasein, in dem keine Richtung und Entwicklung entschieden vorgreift, dauert schon sehr lange. Ich glaube, es wird noch länger dauern. Ich glaube, daß es sehr wichtig ist, wie einer die Zeit äußeren Stillstandes, diese Zeit des Aufenthaltes in einem Niemandsland gewissermaßen, nützt. Ich möchte sie benützen um Einsichten zu gewinnen weniger mit dem Verstand als mit dem ganzen Trachten meiner Person. Ich sage mir: in dem inneren Stand, in den ich mich jetzt bringe, werde ich später auf lange Zeit hin endgültig sein. Schon der Krieg war für mich eine solche Zeit der Einsicht, und nichts hätte sie mir mehr fördern können als die Abgeschiedenheit des Lebens damals; ich habe sie aufgesucht und mich zu ihr hingenötigt. Dann kam die andere Zeit; ich muß sie nochmals als einen Umstand wahrnehmen, der mich genauer das werden läßt, was ich werden soll. Zuweilen denke ich: je näher ich dem Nichts komme, umso unabhängiger und furchtloser kann ich sein. Manchmal aber fliegt mich eine Ahnung an, als wäre die Entschlossenheit zum Nichts heute schon eine veraltete Erscheinung, die noch fortgeistert in der Welt, während der wahre Ort des Menschen an anderem Punkte gegründet wird.Dann sage ich mir, ich dürfte den äußeren Dingen nicht zuviel Einfluß auf den inneren Kern der Person gestatten. Dies aber ist eine täglich zu leistende Arbeit und ist eine Frage der Gesundheit und Geduld im weitesten Sinne. Eine Handlung traue ich mir heute zu, wenn sie auf ein tägliches nahes Bedürfnis gerichtet ist. Wenn ich ein Ding, das außerhalb dieses Kreises liegt, betrachte, werde ich unsicher, gar, wenn ich Handlungen sehe, die aufs allgemeine gerichtet sind. Einer Macht, die im allgemeinen wirkt, mich anzuvertrauen, bin ich nicht fähig, weil ich sie nicht durchschauen kann wie mich selber.
Dies ist ein sehr schmaler Grund, auf dem ich stehe. Ich will versuchen, ihn mir im einzelnen Satz für Satz vorzustellen.
Das Dasein, sagte ich, in dem keine Richtung und Entwicklung vorgreift, dauert schon sehr lange, es wird noch länger dauern.
Ich sehe nicht, daß die zusammengeschlagene Welt wieder aufgebaut wird. Zwar strenge ich mich wie jedermann an, daß ich mich in dem Vorhandenen notdürftig einrichte, aber über das Dringende hinaus eine Einrichtung auf Dauer zu berechnen, dafür bringe ich die Zuversicht nicht auf, weil ich sehe, daß die Zeit einer solchen Absicht entgegen ist. Ich bin geneigt, diesen Zug der Zeit für ein Streben nach Umbau zu halten; eher ist mir davon gewiß, daß dieser Umbau noch einmal für jeden Zerstörung und Abbruch bedeuten kann.
Merkwürdig ist das Verhalten des einzelnen Menschen in dieser Lage. Er hat zwar genug von den überstandenen Schrecken und möchte Ruhe haben. Aber er weiß, daß es Ruhe nicht geben wird, und richtet sich darauf ein, neuen Schrecknissen zu begegnen. Er tut es ohne Widerstand und ohne zu zögern und auch ohne genau zu fragen, von wem die fortwährende Unruhe ausgeht, wo doch jeder nur die Ruhe wünscht.
In diesem Verhalten, scheint mir, beweist der einzelne Mensch, daß er die Art des Vorgangs richtig einschätzt; er schreibt ihn einem unablenkbaren Wettlauf zu.
Hier muß ich eine Anschauung anführen, die sich in mir über diese Dinge gebildet hat.
Ich sehe nicht, daß irgendwo Halt gemacht wird in einem Sinne, der das Wenige an Leben, das heil geblieben ist, schützt und bei diesem Wenigen anfängt. Im Gegenteil sehe ich, daß seit langem bestimmte Entwicklungen vorwärtsgetrieben werden, gleichgültig unter welcher Regierungsform und in wessen Namen sie geschehen. Es kommt mir so vor, als ob die Entwürfe der Staatsmänner und die Vorsätze der Völker dem wirkenden Geist der Geschichte nur zu Vorwänden dienen. Ich sehe ein unbekanntes Etwas am Werk, das abwechselnd die entgegengesetzten Strebungen als Mittel gebraucht, um eine umfassende Verwandlung des Menschen Schritt für Schritt zu vollziehen. Weil ich diese Einsicht habe, liegt mir wenig daran, der einen oder anderen Richtung zu helfen; gewiß ist mir vielmehr, daß alle Handlungen, gleich mit welcher Absicht sie begonnen werden, so einem Ziele beitragen, das von jeder Absicht unabhängig ist.
Davon eben kommt es, daß ich zögere, in einer bestimmten Entwicklung vorzugreifen. Ich bin mit der Schicksalsmacht in einem tieferen Grunde einverstanden und kann einem menschlichen Plan, den Geschicken zu steuern, kein Zutrauen schenken. Umgekehrt sogar muß ich mir eingestehen, daß ich den Gehalt dessen, was im Augenblick geschieht oder jüngst geschehen ist, gar nicht einsehen kann. Was dies betrifft, so ist es vielleicht möglich zu sagen, daß in der Zeit ab 1914 alle Völker in Europa sich vereinigt haben, ihre herkömmlichen Ordnungen zu vernichten, ihre Städte zu zerstören, die festen Menschen-Heimaten aufzulösen und die geschlossenen Volkskörper durcheinanderzumischen, wobei sie zuweilen entgegengesetzte Absichten bekundeten – und auch entgegengesetzte Handlungen ausführten –, aber trotzdem nicht weniger erfolgreich bei dieser Arbeit waren, zu der noch gehört, daß die Menschen sich entschlossen haben, in Armut zu leben: ohne feste Wohnungen, ohne Eigentum, ohne Sicherheit und Freizügigkeit der Person, welche Dinge alle sie zuerst durch Willkür, dann durch Verordnungen, die sich scheinbar notwendig ergaben, abgeschafft haben. Was aber eigentlich geschieht, indem dies alles sich vor unsern Augen vollzieht, können erst spätere Zeiten einsehen.
Ich glaube nun, daß es sehr wichtig ist, wie einer die Zeit äußeren Stillstandes, diese Zeit des Aufenthaltes in einem Niemandsland, nützt.
Falsch wäre es, in den Zeiten des Stillstandes gewaltsam nach Handlungen zu drängen. Jeder Erfolg wäre ein Scheinerfolg, jedes Ergebnis eine Einbildung. Besser ist es, auf solche Beruhigung zu verzichten, anstatt den Verstand zur Erzeugung des Scheinhaften zu gebrauchen. In höherem Rang stehen die Mittel, die dem menschlichen Leben Nähe und Wärme geben: Bescheidung, Häuslichkeit, der fromme, den kleinen Gewährungen des Täglichen zugewandte Sinn, die einfache Arbeit.
Dazu möchte ich sagen, daß ein Mensch, der körperlich arbeitet, für gewöhnlich nüchtern und zuverlässig urteilt; er kann mehrere Parteien hören. Der Fußbreit Bodens, den der Arbeiter mäht, die Schraube, die er in den Traktor eingesetzt hat, sind ihm wirklicher als eine zugespitzte Rede. Hier herrscht eine reinere Stimmung, die in jedem Fall die Kräfte spart.
Ich sagte, ich möchte diese Zeit benützen, um Einsichten zu gewinnen, weniger mit dem Verstand als mit dem ganzen Trachten meiner Person.
Dieser Vorsatz erfordert Ausdauer und Vorsicht. Die Einsichten, die gewonnen werden, sind zunächst oft nicht faßbar, aber die Ungeduld darüber muß hintangehalten werden. Jemand, der sich auf solche Weise vorbereitet, gleicht einem Manne, der in einer dunklen Kammer seine Kleidung auswählt. Er kann sich die Stücke anpassen, aber er kann sie nicht sehen. Wie er aussieht in ihnen, wird er erst gewahr werden, wenn er ans Licht tritt. In dem Beispiel ist vieles enthalten, was von unserer Lage zu sagen ist: die Unsicherheit, der wir ausgesetzt sind, ebenso wie die Wachsamkeit, die wir aufbringen müssen, aber auch die Möglichkeit der Überraschung, die wir uns bereiten können.
Ich sage mir: in dem inneren Stand, in den ich mich jetzt bringe, werde ich später auf lange Zeit hin endgültig sein.
Das kann eine Einbildung sein, ein Umweg, mit dem ich meine Zuversicht anfeuere. Aber der Satz entspricht der alten Wahrheit, daß jede Verwandlung schon vollzogen ist, ehe sie sichtbar wird, jedes Ding entschieden ist, ehe es geschieht. In der Art, wie einer stillhält, wird ausgemacht, was er später tun wird. Kein Augenblick ist gleichgültig, kein Einfall bleibt ohne Spur. In den Zeiten des Handelns ist Aufmerksamkeit weniger nötig als in den Zeiten, die der Handlung vorausgehen. Es gibt in unserem Leben jetzt keinen Tag, der unbewacht verstreicht.
Schon der Krieg war für mich eine solche Zeit der Einsicht, und nichts hätte sie mehr fördern können als die Abgeschiedenheit des Lebens damals; ich habe mich zu ihr hingenötigt.
Damals war es, daß ich jenes Einverstandensein, von dem zu Anfang die Rede war, gelernt habe, und daß es mich zu Freundwilligkeit und Einsamkeit gleichermaßen erzogen hat. Ich habe gelernt, daß die Menschlichkeit das einzige Gut ist, das mir in meinem Rang zu verteidigen zukommt, und daß mich nur das ehrenhafte Gewissen rechtfertigen kann, dem nichts hinzugefügt wird. Ich bin darum gegen die Hinzufügung von Meinungen, Überzeugungen und Glaubenssätzen abweisend geworden und habe mich an jenen Ort begeben, an den sie mir nicht nachgekommen sind. Je länger ich so mit den einfachen Leuten gelebt habe, bei einfachen Beschäftigungen und abgetrennt an entlegenen Punkten, desto unangefochtener dufte ich innen sein. Wenn ich heimgekommen war, bin ich hellhörig gewesen, und wenn ich dorthin wieder zurückgekehrt war, habe ich gewußt, wie ich gleich allen, mit denen ich das Leben geteilt habe, von dem weltlichen Stand fortgerückt worden bin in eine Art geistlichen Stands – wenn dieses Wort nicht mißzuverstehen ist; – und in ihm sind wir verblieben.
Dann kam die andere Zeit. Ich muß sie nochmals als einen Umstand wahrnehmen, der mich genauer das werden läßt, was ich werden soll.
Obwohl ich erschöpft war, wär ich bereit gewesen, in der gewonnenen Einsicht fortzufahren, wenn mir die Freiheit dazu gelassen worden wäre. Statt dessen hat eine veränderte Welt begonnen, jedem von uns Strafen auszuteilen für Dinge, von denen wir entweder niemals gehört oder denen wir längst abgesagt hatten. Es ist dadurch erreicht worden, daß wir uns mit dem Abgetanen noch einmal auseinandersetzen müssen, und weil uns zugleich neue Meinungen und Überzeugungen als unfehlbar vorgehalten wurden, waren wir gezwungen, unsere frühen verlassenen Meinungen und Überzeugungen hervorzuholen und zu prüfen, ob sie denn wirklich so schlecht gewesen waren. Insofern sind wir in Gefahr gekommen, daß wir im ganzen zurückgeworfen werden in Zustände, derer wir uns schon entledigt hatten, und diese Gefahr ist um so näher, als jenen alten Meinungen jeder Grund und jede Ehrenhaftigkeit überhaupt abgesprochen wurde und auf die Art ein lösendes und verständiges Gespräch unmöglich gemacht wird. Indessen habe ich erkannt, daß ein solches Gespräch nicht gewünscht wird, und habe gelernt, es auch von mir aus nicht mehr zu wünschen und statt dessen auf mich selber zu sehen, was aus mir wird in der Zeit.
Zuweilen denke ich: je näher ich dem Nichts komme, um so unabhängiger und furchtloser kann ich sein.
Dieser Weg ins Nichts ist der Weg des äußersten Widerstandes. Ein Umstand hält mich jetzt ab ihn zu gehen: es ist das schlechte Gefühl, daß die Verzweiflung ihn raten will, was dasselbe ist: daß die Unvernunft des Gegners ihn aufdrängt. In guten Augenblicken sage ich mir, daß in dieser unbelehrbaren Welt diesesmal endlich, um die Kette der Schuld zu enden, der Besiegte für den Sieger Vernunft oder zumindest eine Art verachtender Geduld haben müßte. Aber ein Gefühl auch sagt mir, daß es eine Entschlossenheit zum Nichts gibt, die unabhängig ist von den gestellten Bedingungen. Ich frage mich, ob ich mir diese Entschlossenheit zu eigen machen kann.
Manchmal nämlich fliegt mich jene Ahnung an, von der ich gesprochen habe: als wäre die Entschlossenheit zum Nichts heute schon eine veraltete Erscheinung, die noch fortgeistert in der Welt, während der wahre Ort des Menschen schon an anderem Punkte gegründet wird.
Hier stößt mir ein Gedanke noch auf, der mich schon lange beschäftigt, ohne daß ich weiß, ob er richtig ist. Ich möchte sagen, daß das Leben in mehreren Schichten gelebt wird. In der einen wird Leben immer wieder hervorgebracht so wie der bebaute Grund eines Mannes an den Grund seines Nachbarn stößt und das so fortgeht über Flüsse und Grenzen hinweg ohne Unterschied. Der Unterschied: die Grenzen und der Krieg, kommen aus einem andern zunächst unanschaulichen Reich, und sie werden gemacht von Menschen einer Art, die nicht dem nährenden unschuldigen Lebensgrund angehören, sondern den losgelösten Machtgründen eines erwachten, gegen Einbildungen empfindlichen Daseins. In diesem zweiten Dasein wird der Lebensvorrat verbraucht; es werden in ihm freilich auch die namentlichen Gestalten hervorgebracht, die fortdauern – als Zeugnisse vernichteten Lebens nur, aber doch als Gestalten: sie sind die weitblickenden weitschallenden Denkmäler eines ungeordneten, zwanghaft zufälligen und in Leidenschaften schuldhaften Ablaufes, den wir Geschichte nennen und der uns das Gedächtnis unseres Geschlechtes schafft.
Seit einiger Zeit nun spreche ich mir dieses Gefühl aus, als ob in den Gestalten der Geschichte und der Kunst etwas Unveränderliches, von den Bedingungen der Zeit, die sie hervorgebracht haben, Unabhängiges enthalten sei. Jetzt spüre ich manchmal, daß auch im Gegenwärtigen, einer Handlung etwa, die heute geschieht, nur ein gewisses Maß diesem Heute gehört. Aber die Beschaffenheit jenes dritten vertrauenerweckenden Teiles ahne ich kaum. Ich frage mich: Was ist er? Ich breche ab, weil ich diesen Weg weitergehen möchte ohne mit Worten vorwegzunehmen, was ich nicht erfühlt und erfahren habe.
Ein kurzer Besuch in München
um 1952
Ein kurzer Besuch in München belehrte mich, daß, anders als noch vor einem Jahr, die Menschen in Deutschland plötzlich sprechen. Das ist etwas Neues. Bis jetzt nämlich haben sie geschwiegen, – wahrscheinlich aus Instinkt für Selbsterhaltung; und die Auseinandersetzung über die Niederlage von 1945 fand bestenfalls in ungelesenen Zeitschriften statt. Nun erst, sieben Jahre nach Kriegsende, geht sie über ins Volk: überall, in den Eisenbahnzügen, den Gasthäusern, in zusammengewürfelter Gesellschaft, quirlen die Reden auf. Das ist ein Wendepunkt, und gern möchte man sich dazu stellen, denn die Auseinandersetzung darf nun nicht oberflächlich, sondern muß von Grund auf geführt werden. Der einzelne kann sich hierzu melden, er kann sich berichtigen lassen, er kann fragen und versuchen eine Antwort zu finden.
Ich glaube, die Deutschen haben von ihrer politischen Macht kam einmal einen guten Gebrauch gemacht. Fast sieht es so aus, als ob den Deutschen die äußere Macht etwas Fremdes wäre, das mit ihrer angeborenen Art nicht übereinstimmt. Es ist darum meine geringste Sorge, wenn ihnen die Möglichkeit Macht zu entfalten genommen wird. Nichts was zu ihrem Wesen gehört, wird ihnen damit genommen. Sie sind ein nach innen gekehrtes Volk, dem der Umstand, daß es Macht entfalten soll, die Seele verstört. Was sollte ihnen geschehen, wenn sie das Fremde ablegen und auf Macht verzichten? Immer noch bleiben sie, wenn sie nur am Leben bleiben, was sie sind, und verlieren nichts, und jetzt auch wird es von ihnen, ob sie zwischen Osten und Westen standhalten, abhängen, wie das Gesicht der Welt aussehen wird.
Die Deutschen bleiben auf dem wichtigsten Ort der Erde, weil auf dem mittleren Feld zwischen Westen und Osten.
Wenn sie keine Macht haben, aber dicht leben, werden sie die Kräfte sparen und mit reinem Gewissen dazu einen Vorsprung an Leben, an unwillkürlich wirkendem Gewicht gewinnen. Die Dinge, die sie mit solchem Gewicht gewonnen haben, sind ihnen immer erhalten geblieben; die Dinge, die sie mit Gewalt gewonnen haben, immer wieder verloren gegangen.
Die Deutschen gehören nicht zum Osten und nicht zum Westen, vielmehr: in ihnen begegnen sich Osten und Westen. Ihre großen Staaten: Preußen und Österreich, ungleiche Geschwister, waren Kinder aus dieser Vermählung, und eben sie erzeugt jenes unruhige Element in den Deutschen, wie Toynbee es nennt; er möchte es ihnen gern ausziehen, vielleicht auch: er möchte ihnen die schwere Last nehmen und sie zu germanischen Rheinuferstämmen wieder machen, die sie am Anfang ihrer Geschichte waren. Die Teilung Deutschlands an der Elbe könnte diese Folge haben, sie würde den Deutschen, die übrigbleiben, ein leichteres Leben gestatten, aber sie würde ihnen ihren Charakter nehmen. Hier droht den Deutschen die eigentliche Gefahr, ihr müssen sie widerstehen. Und die Natur hilft ihnen dabei, die Teilung wird nicht gelingen. Die große Ebene, die Kette der Wälder, die Waldesluft reicht noch immer vom Rhein bis nach China.
Vorerst müssen die Deutschen ihr Einzelnes, wie sie leiblich zusammenhängen, kräftigen, ohne daß sie teilnehmen an unsicheren Machterrungenschaften, die Kräfte nur verzehren. In ihren Bestand dürfen sie nicht den Westen aufnehmen; sie dürfen sich auch nicht dem Osten verschreiben; sie müssen trachten zu vermitteln zwischen Westen und Osten. Diese Vermittlung wird vielleicht bald von ihnen verlangt werden.
Dabei wird den Deutschen zustatten kommen, daß sie innen entschiedener verwandelt worden sind, als sie es wissen. Die Welt wird diese Verwandlung nicht zurückdrehen können.
Die Deutschen werden noch eine Weile hilflos ihre Aufgabe verkennen. Der Anstoß zu handeln wird ihnen von den andern Deutschen kommen, die aus dem nahen Osten ausgetrieben worden sind, sobald sie sich die einverleibt haben. Mit der Austreibung dieser Deutschen haben die slawischen Völker dem mittleren Deutschland Kräfte zugeführt, die nicht allein in der Zeitspanne nach dem Niederbruch unschätzbar sind. Sie haben ihm ebensosehr einen Dienst erwiesen als sie sich selber geschadet haben: sie werden durch den Verlust eines gewohnten Lebenszusammenhanges auf kurze Zeit abgelenkt, auf lange Zeit gelähmt sein.
Die Deutschen haben den Westen nicht verstanden, aber sie haben fest geglaubt, daß die alte Welt in Europa am Erliegen sei, wenn sie sich nicht vor sie stellten. Und weil sie die alte Welt erhalten wollten, haben sie sich dazu gebracht für den Westen zu kämpfen. Sie haben sich für diesen Kampf bereitgemacht mit Mitteln, die der alten Welt entgegengesetzt waren. Das konnten sie tun, weil ihre Führer bedenkenlos waren: sie gehorchten nicht den Vorschriften eines Standes, eines Glaubens, nicht einmal den beschränkten Vorschriften ihres eigenen Volkes; nicht umsonst entstammte Hitler dem merkwürdig zwielichtigen, wie von entkörperten Geistern erfüllten Raum, der sich an die Stelle des zerstörten habsburgischen Reiches gesetzt hat. Ihm bedeutete es nichts, sein Volk mit Eigenschaften auszurüsten, die es endlich ins Verhängnis geführt haben. Der waghalsige Versuch scheiterte, weil in ihm zwei Irrtümer vorkamen:
Im Innern zeigte sich, daß die Rüstzeuge einer vermeintlich neuen Menschenart nicht verwendet werden konnten. Widerstand, Unverständnis, Vorsicht in der Anwendung, die Meinung, sich alles äußerlich aneignen zu können, halfen zusammen, daß die innere Rüstung der Deutschen in einem halben Anlauf steckenblieb und zu einem groben Unfug entartete. Immerhin hat sie die unterschiedlichsten Kräfte in den Deutschen aufgestöbert und eine Zeitlang benützt. Sie hat damit den Umsturz der alten Werte innerhalb des deutschen Volkes planlos beschleunigt.
Von außen her aber gab die alte Welt sehr bald zu erkennen, daß sie nicht gesonnen sei sich von einem Volk verteidigen zu lassen, dem die Güter, die es verteidigen wollte, offensichtlich nichts galten, zumindest für die Dauer des Kampfes nicht. Den Deutschen solcherart zu mißtrauen war vielleicht vorausschauend gedacht; vielleicht auch entsprang die Ablehnung einem strengen Gewissen. Freilich konnte der gewissenhaft bleiben, der nicht verzweifelt zu sein brauchte.
So kam es zu dem Schauspiel, daß der Deutsche, der sich anschickte für seine Mitwohner das Haus zu verteidigen, ob er gleich keinen guten Platz in ihm hatte, von diesen andern Mitwohnern niedergestreckt und danach verhöhnt wurde.
Nun, da der Deutsche wieder aufstehen soll, versucht er sich klarzumachen, was geschehen ist. Sehr viele Gedanken bewegen ihn, weil sehr viel, Unvereinbares und Widersprechendes, geschehen ist. Man läßt ihn, der seine Schuld zwar bezahlt, aber wie im Schock kaum noch richtig begriffen hat, nicht zur Besinnung kommen. Es eilt sehr, die eifersüchtige Gottheit hat Langeweile, sie peitscht die Menschheit zu neuer Arbeit. Der Deutsche wischt sich eben noch den Staub aus den Augen, schon gibt man ihm auf der einen Seite zu verstehen, daß er nun wieder mit seinen Nachbarn zusammenhelfen könnte das alte Haus zu wahren. Auf der andern Seite fordert man ihn auf in ein neues Haus davonzuziehen, – es müßte ihm doch passen!
Die Entwicklung, die hier angedeutet ist, konnte jeder vorausahnen, der nicht wie die Herausgeber gewisser Zeitschriften mit der Umerziehung der Deutschen beschäftigt und darum gehalten war die Lage zu verkennen. Immerhin bietet sich auch heute noch die Möglichkeit Deutschland in eine Verfassung zu bringen, in der es willens und fähig ist zwischen Westen und Osten zu vermitteln. Die Vorzüge einer solchen Vermittlung werden beiden Teilen wahrscheinlich erst dann einleuchten, wenn die Chance dafür verpaßt ist.
Willens und fähig, – diese Frage haben sich auch die Deutschen von Grund auf zu stellen. Nicht mit Absicht, aber gezwungen von den andern jetzt, bleiben sie in ihrem Unglück das am tiefsten aufgewühlte Volk der Erde. Ich frage mich, wie groß der Kraftverlust ist, den sie erlitten haben. Werden sie noch eine zweite heilsame Rolle spielen können? Werden sie je zu einer ersten Rolle kommen, auf die hin sie angelegt sind, die ihnen aber durch ihre mißliche Geschichte vorenthalten worden ist? Welche Umwege werden sie einschlagen müssen, um das zu werden, was sie sein sollen? Welche Augenblicke waren es, in denen ihre Art am glücklichsten mit ihren Aufgaben und den Umständen der Zeit übereinstimmte? Läßt sich an dem schwierigen Ort, an dem die Deutschen wohnen, überhaupt ein Staat glückhaft begründen? Wie lange werden die Deutschen zurückgezogen leben müssen, damit sie sich wieder erholen? Werden sie nicht zu spät kommen, wenn die großen Entscheidungen getroffen werden? Ist es also vorbei mit ihnen? Oder ist die Zersetzung des volkhaften Bestandes, die den Deutschen droht, schon ein Fortschritt ins Zukünftige, derart, daß die Deutschen wider ihren Willen hier vorangehen und sich in eine vorteilhafte Verfassung bringen gegenüber andern Völkern, die zum Teil jetzt erst verspätet die überholten Feste völkischer Selbstfindung gespenstisch feiern? Werden die Deutschen, wenn schon nicht den äußeren Mitteln, so doch der Gemütsart nach insgesamt zu Partisanen gemacht? Und was ist dann von den Deutschen zu erwarten, wenn sie den aufgeopferten und mißhandelten Körper ihres Vaterlandes, der den andern immer anstößig gewesen ist, verlassen wie eine leere Hülse und sich in einer einstweilen noch nicht erkennbaren Ordnung zusammenfinden, in der sie unangreifbar und den Mächten der alten Welt fürchterlicher sein werden?
Aus dem allem wären Folgerungen zu ziehen, sie würden einander widersprechen. Der einzig mögliche Schluß ist der zuvor ausgesprochene: daß Deutschland wiederhergestellt werden und daß es vermitteln soll. Vielleicht ist es nötig nach innen zu schauen um zu erkennen, was dem einzelnen hier aufgegeben ist.
In der stets unvollkommenen Welt muß möglichst das Gute getan werden, ohne daß Aussicht ist die Welt vollkommen gut zu machen. Darum bleibt mir eine im Diesseits gegründete Ordnung der Menschen immer fragwürdig, und ich kann aus einer solchen Ordnung nicht Gesetze gewinnen, nach denen ich unbedingt zu handeln hätte. In dem Augenblick, in dem der Mensch von einer diesseitigen Ordnung, die er sich ausgedacht hat, glaubt, sie könne vollkommen sein, ist er versucht oder sogar verpflichtet sie unter allen Umständen zu erreichen, und schon wird er zugunsten dieser Ordnung jedes Mittel, das ihr dienen kann, für erlaubt halten, und sofort wird – das haben wir bei uns selber erfahren und gebüßt – jedes Unrecht möglich sein, weil es für entschuldigt gilt. Der Mensch aber wird dadurch von einem jenseitigen immerwährenden Bild der Vollkommenheit, nach dem er sich als Einzelner jeweils richten konnte, abgeschnitten, und es geschieht ihm, daß er nicht mehr Person ist in dem uns überlieferten Sinne, sondern nur soviel gilt, als er für eine irdisch zu erreichende Vollkommenheit nützlich ist. Er darf nicht ohne Rücksicht gut sein; die Freiheit unablässig das Göttliche zu befragen, ob er nicht irre, und als sein Ebenbild auf der Welt zu leben, steht ihm nicht zu. Ebensowenig gehören ihm dann Gewissen, Recht, Ehre, Schuld; auch hat er aufgehört im großen Sinne Schicksal zu haben.
Ich möchte nun glauben, daß die in der Welt nicht ursprüngliche, aber im Abendland vorgebildete Freiheit des Menschen von den Völkern des Ostens einmal doch verstanden werden wird, weil sie in ihrer Anlage nicht so sehr auf das Nützliche sehen wie wir.
Der Westen, der jetzt gewiß die freie Entscheidung des einzelnen Menschen verteidigt, wird es, wenn er in Lebensnot kommt, möglicherweise nicht mehr entschieden tun. Der Osten wird es vielleicht wieder tun, wenn er nur erkannt hat, daß die Welt vollkommen nicht gemacht werden kann, und daß es darum nicht angeht, den Menschen als Werkzeug für einen Plan zu nehmen, daß vielmehr dem einzelnen Menschen das Recht zurückgegeben werden muß, Gut und Böse im Angesicht des Göttlichen auseinanderzuhalten. Mit diesem Recht werden sich die Völker durchdringen müssen, die des Ostens um es zu gewinnen, die des Westens um es zu behalten, und wir in der Mitte vor allem, weil wir am meisten darauf hätten achten müssen.
Das ist im Ganzen eine Hoffnung auf lange Sicht, und man kann sagen: eine utopische Hoffnung, aber anders geht es nicht. Es ist eine Forderung, in der wir uns behaupten. Das Bild der Vollkommenheit könnte aus der Vorstellung, daß es jenseits liege, hereingeholt werden in den einzelnen Menschen: er muß in Ordnung sein, muß jedem Dinge, das auf ihn eindringt, sein Wesen lassen, es unverstellt nehmen, muß zuhören, dann ist der Himmel in ihm; jeden Augenblick kann er das Leben haben, muß es jeden Augenblick gewinnen.
Einstweilen freilich sehen wir die Welt mit den Trümmern des alten Deutschland und des alten Österreich beschäftigt. Der meiste Streit und Krieg unseres Zeitalters ist von Niederlage, Hybris und fortschreitendem Zerfall dieser Staaten gekommen, und gern möchten wir wissen, ob sie nicht in einer höheren Vernunft gegründet waren, weil ihr Fehlen die Unordnung immer wieder hervorruft, und ihr Untergang in Wahrheit der Untergang der alten Welt gewesen ist.
Das habe ich hingeschrieben, wie es mir das Gefühl eingegeben hat. Es ist Widerspruch darin, aber ich zeichne mir eher den Widerspruch auf, bevor ich mir eine Meinung zu eigen mache, bei der ich nicht bin.
Die Zeit, in der wir sind, hat mich das gelehrt: ich glaube, der Mensch kann erniedrigt, gezwungen und getötet werden, aber das Unverwesliche seines Daseins kann ihm nicht genommen werden, wenn er die Prüfung übersteht und willens ist es zu behaupten; und in dem Fall, möchte ich sagen, sind wir heute.
Berlin. Geist und Gesicht
Frau Susanne Gropp in Berlin gewidmet
1953
Denk ich an Deutschland
Aufzeichnungen – Frühjahr 1952
Die Schwierigkeit, über Berlin zu schreiben: man will das Besondere, das nicht schon hundertmal durch Reportage gezogen ist, festhalten. Aber umgekehrt ist auch für den Mann, der zum andernmal wiederkommt, das Allbekannte, wie das Jahr 1945 es hinterlassen hat, erschreckend und besonders genug. Da ist der Anblick des Tiergartenviertels, hier fanden Erdkämpfe statt, dementsprechend stellt es sich als reine Kriegslandschaft dar mit skelettierten Häusern, von denen nur die Schornsteine mit ein wenig Mauer ringsum aufragen. Hier und dort zieht ein Trecker an einem Seil und reißt eine solche Ruine um. In der Gegend der Technischen Hochschule, zwischen Bahnhof Zoo und Knie, rumpeln auf eingeplanktem Gelände die großen Schuttmühlen. Gröberer und feinerer Schutt häuft sich zu ockerfarbenen Gebirgen, Baggermaschinen schaufeln ihn in die Mischtrommeln, an den Rampen warten Lastwagen, die den ausgetrockneten Formstein zu den Baustellen abfahren. Fällt der Nordwind ein, trägt er den Staub von dort herüber auf die Glas- und Lichterstraße des Kurfürstendamms, der Spaziergänger reibt sich die Augen, und jeden Morgen liegt an der Kante des glattgeschliffenen Asphalts die feine Staubdüne wie Scheuersand.
Anders manche Ruinen der Friedrichstadt: sie lagen wenig unter Beschuß, sind vielmehr ausgebrannt und sehen nicht wie Skelette aus, sondern wie Schalentiere. Die grotesken Fassaden der Waren- und Zeitungshäuser aus der Zeit vor 1914 werfen ihre Schatten aus, aber dahinter ist nur unübersichtlich Stille und Öde, und den Mann, der Straße für Straße nichts anderes erblickt als das entleerte Gehäuse eines enggesponnenen City-Kerns, überfällt tiefere Beklemmung als in der Zone der bloßliegenden Vernichtung.
Es gehört viel Zuversicht dazu, sich vorzustellen, daß hier in fünfzig Jahren die Spuren des Krieges getilgt sein sollen. Freilich, in den unversehrten Vierteln, und nicht bloß in ihnen, stellt sich das Leben emsig wieder her. Will man den Eindruck nicht fälschen, muß man festhalten, daß es in einer solchen großen Stadt endlich doch nur zwei oder drei breite Striche der totalen Zerstörung gibt. Aber man tut gut daran, sich der antiken Städte zu erinnern, deren Ruinen noch heute sichtbar vor uns liegen. Die Zerstörung bedeutet dort vor anderthalb tausend Jahren auch den Untergang einer Welt, und das Leben kehrte nicht wieder. Daran erst entscheidet sich das Schicksal.
Die Frage für Berlin ist, ob das Leben, zu dem es gewachsen war, wiederkehren wird. Der Mann im Auto sagte: Wie finden Sie die Stadt? Sie waren ein Jahr nicht hier!
Ich sagte: Ein wenig erinnert sie mich nun an Wien. Das tat sie früher nicht. Ich weiß nicht, woher kommt das? Ich wollte mir den Eindruck klarmachen, da kam ich endlich auf etwas Besonderes. Zwei Dinge sind neu in Berlin. Die Stadt hat aus ihren Leiden einen Gewinn gezogen. Sie hat durch eine Kette mörderischen Zugriffs: Zerbombung, Eroberung, Teilung, Blockade, und man muß hier auch von der Schleifung des Schlosses sprechen, einem Akt, den man sich nicht anders vorzustellen hat, als wäre in Wien die Hofburg angebombt und dann geschleift worden zugunsten einer Tribüne aus Beton – sie hat durch diese Kette von Leiden etwas bekommen, das ihr früher gefehlt hat: jenen unverwechselbaren Zug historischer Würde, den ein gleichgültiger Ort niemals besitzt. Plötzlich hat sie ihn im Gesicht, und hat ihn auch in den Gesichtern ihrer Einwohner, eine erstaunliche Wendung, ein tieferes Leben.
Das zweite: Berlin war Hauptstadt eines großen Reiches. Einstweilen ist sie es nicht. Was Wien im Jahre 1918 erfahren hat, ist hier in anderer Weise 1945 geschehen. Verwunderlich bleibt es trotzdem, daß zwei so verschiedene Städte davon einander plötzlich ähneln. Das Wien der dreißiger Jahre wirkte ein wenig wie Venedig: von den Ringstraßengebäuden blätterte der Verputz, und sie dienten in dem zusammengeschrumpften Staat vergleichsweise lächerlich lokalen Agenden. Aber über die weiten Plätze wuchs nicht bloß die Stille abgelebten Lebens, sondern auch die Wehmut einer unauffälligen Vollendung, ein rührender Goldglanz, gemischt aus dem Fluidum von Schönheit, Skepsis und Leere. Berlin ist nach sieben Jahren noch nicht so weit. Aber schon heute besitzt es im Tiergarten einen Ort, an dem sich seine verarmte und vornehme Seele nicht weniger deutlich ausspricht als die Seele Wiens etwa im Blick vom oberen Belvedere.
Ein merkwürdiges Bild, das ich zeichnen möchte: Sand, Wasser und Weite, die drei Elemente der Stadt, waren hier übriggeblieben nach der Belagerung und dem Feuersturm von 1945. Inzwischen haben kleine Arbeitstrupps, Männer und Frauen, die überall vorgehen wie in schmalen Angriffsstreifen, die öde Fläche beinahe bewältigt. Jahr für Jahr seit der Blockade haben sie eingeebnet, ausgeräumt, gepflügt, gesät, gepflanzt, und nun ist es soweit, daß das Gras dichter kommt, die Stauden sich belauben, statt der gelben Wüste streckt sich also, da wir 1952 schreiben, ein hellgrüner Plan von den Böschungen der frühlingsklaren Gewässer. Aber immer noch geht die freie Durchsicht nach allen Richtungen hin, und fast möchte man wünschen, daß es so bliebe. Denn gegen die Schönheit des einzelnen, gegen Baumgruppen und beschattete Brücken, hat das Auge hier eine großartigere und nüchterne Schönheit eingetauscht in eben diesem Durchblick: Schaumkrone oder Wolkenflocke, lagert in der grünen Ferne der zarte helle Prospekt der Stadtränder. Nur die Flanke des Hansaviertels ist zu Schutthaufen eingestürzt, und die rotgelben Stadtbahnzüge, früher dort unsichtbar, sehen nun aus wie Fasane, die über dem Gras dahinpfeilen, die Eisenkähne der Binnenschiffer zwängen sich wie dicke Kröten in den Schleusen ein, der seidige Himmel nimmt das Bild zusammen: grünes Meer, weißrauchiges Ufer; der dünne Stadtlärm und ab und zu das kurze Blöken einer Dampfersirene dringen herüber.
Die Frage, ob Berlin seinen Rang behaupten kann, beschäftigt eifersüchtig die Gemüter. Die meisten abgesunkenen Städte Europas haben ihren Rang nicht deshalb verloren, weil sie zerstört worden, sondern weil sie in die Flaute der Provinz geraten sind. Berlin tut alles, um sich dagegen zu wehren. Es hat eine wichtige Schlacht, die harte Prüfung der Blockade im Jahre 1948, gewonnen. Nun folgen freilich noch immer Jahre der Hemmung und Bedrohung.
Als ich aus Österreich über die Grenze kam, wunderte ich mich über einen süddeutschen Kaufmann; er ärgerte sich darüber, daß irgendein Kongreß statt in dem bequemen Gehege der Bundesrepublik aus Prestigegründen, wie er sich ausdrückte, nun ausgerechnet in Berlin stattfinden solle – das kostet ein ganzes Flugzeug, sagte er, haben wir soviel Geld? Die Berliner mit ihrer Empfindlichkeit, vorneweg zu kommen, sind nicht mehr auszuhalten. Ich wurde rot, weil ich mich für den Mann schämte. Er sah es mir wohl an, er lenkte ein: Ja, gewiß, umgekehrt haben wir hier keine Ahnung von dem Kampf, der dort geführt wird. Eigentlich müßte jeder Deutsche aus dem Westen einmal im Jahr nach Berlin, um das zu sehen!
Ich mußte nachdenken. Von Österreich her war mir das Problem „Provinz gegen Weltstadt“ nicht fremd. Auch bei uns gibt es die tüchtigen mittleren Städte im Westen, sie können die große alte Stadt doch nicht überholen. Auch mit Fleiß und Geld kommen sie nicht auf gegen das noble Schicksal der Hauptstadt, der es noch immer nicht um Fremdenverkehr oder Wasserkraft, sondern um die metaphysische Haltbarkeit des Staates geht. Dieser Schritt zu höherem Beruf läßt sich nirgendwo erzwingen, und ich glaube, auch die westdeutschen Städte können ihn für Deutschland nicht leisten. Der Rang einer Hauptstadt wird bestimmt durch die Abwesenheit einer Art von ehrenwertem Patriotismus, der uns anheimelt.
Hier in Berlin ist die Stadt, anders als Wien, von der Teilung entscheidend betroffen. Freilich, einiges an dem Unterschied zwischen den zwei ungleichen Hälften ist nicht von heute. Es mag Zufall gewesen sein, aber in dem östlichen Sektor der Stadt liegt zwischen Brandenburger Tor und Kurfürstenbrücke all das, was einstmals den Staat vorgestellt hatte. In den westlichen Sektoren gibt es kaum dergleichen. Die Hälfte westlich des Tiergartens war schon immer auch westlich gefärbt, war Geschäftsviertel. Staat und Geld hatten in dieser Stadt seit jeher verschiedene Quartiere bezogen, nun sind die Quartiere getrennt, und die Unterschiede treten scharf hervor. Wer im Anschaulichen lebt, dem bleibt ein solches Bild haften. Mir erschien es plötzlich wie ein Sinnbild nicht bloß für die unglückliche Teilung der Stadt, sondern auch für die sehr unglückliche, verzerrende Teilung Deutschlands überhaupt. Ich ließ mich belehren von dem Bild, und ich mußte dabei wieder an meinen Kaufmann in Süddeutschland denken und an seinen redlichen Widerwillen gegen ein ihm unverständliches Prestige. In Wirklichkeit, so sagte ich mir nun, geht es hier um mehr als um Prestige. Der deutsche Westen, wenn er seine Seele nicht klein machen will, kann auf das freie spröde Berlin, er kann auch auf einen freien deutschen Osten nicht verzichten. Ohne die Kräfte, die in dieser jetzt abgetrennten Landschaft wohnen, wird er einen dauerhaften Staat niemals herstellen können. Mir waren überall, hüben und drüben, immer dieselben Gesichter begegnet, die ich von früher kannte, von Krieg und Frieden. Bei den Schaffnern der Straßenbahn, den Lastwagenfahrern, den Männern und Frauen in Schrebergärten, engen Wohnungen und Vorortzügen waren sie mir wach, freundlich und redlich entgegengekommen. Es läßt sich gewiß nicht leicht durchschauen, woher ein Volk seine Reserven zieht und wie weit in ihm Kraft und Ruhe unangetastet geblieben sind. Aber in manchem dieser Gesichter habe ich ein unzerstörtes Licht gesehen und ihm möchte ich vertrauen.
Unruhiger Abschied
Tagebuchblatt – Juni 1952
Ich sah neben einer Tankstelle unter freiem Himmel eine große schwarze Schultafel, auf ihr stand mit Kreide: Interzonenverkehr; links waren die drei Felder: Marienborn–Helmstedt, Juchhöh–Töpen und Boizenburg–Lauenburg; die Felder rechts waren durch eine Klammer zusammengefaßt und hier galt für alle drei Übergänge das Wort: normal.
Diese Tafel zeigt, dachte ich, wie die Berliner mit dem Komplex fertig werden. Sie machen sich präsent, was geschieht, aber sie stellen sich den Dingen weniger theoretisch als praktisch, sie bewahren also Ruhe.
Die Unruhe beginnt immer wieder einmal. Ende April 1952 kam sie von einem Zwischenfall im Luftkorridor. Davon blieb damals etwas zurück: Aufmerksamkeit, Spannung; sie waren wenige Tage später bei der Maikundgebung im Tiergarten deutlich zu spüren. Das war nun freilich eine einprägsame Szene: der Platz der Republik voll Menschen, vorn standen sie dicht gedrängt, hinten saßen sie in lockeren Gruppen im Gras oder wandelten umher, ein wenig sah es aus wie Osterspaziergang, vom Eise befreit. Die Kulissen indessen, die den Festplatz umrahmten, unterschieden sich höchst sonderbar voneinander: vorn war die Tribüne, auf ihr tauchten zwischen Tannengrün und Fahnen winzig die Redner auf. Hinten aber erhob sich die Ruine des Reichstags ohne Fahnen, doch ebenfalls mit leuchtenden Punkten, rot, khaki und weiß, besetzt. Wie auf einem Bühnengerüst nämlich hatten sich hier auf jeder Treppe und in jeder Fensterhöhle bis in die ausgebrannte Kuppel hinauf die englischen Soldaten eingenistet, hatten an diesem letzten Ort vor dem östlichen Sektor den Kordon gezogen. Und während von vorn die Reden kamen, während unten die Menge wogte, regte sich an dieser Dekoration im Rücken der Veranstaltung kaum mehr, als daß hier und da Ablösung kam oder ein Melder ging.
Man trifft immer nur einzelne Leute, sieht winzige Züge, läßt sich daraus ein Bild gewinnen? Ein Mann hat sein Haus an der Zonengrenze, er verspätet sich von dorther, sofort ist die Frau, die auf ihn wartet, unruhig: Vielleicht ist etwas passiert draußen? – Eine andere Person beschwichtigt. Eine dritte entdeckt das Heillose, gräßlich Alberne des Zustandes: Da ist also ein Mann vor zwanzig Jahren, sagen wir 1930, in eine bestimmte Straße gezogen. Und nun, so viele Jahre später, folgt für ihn daraus, daß ihm die Welt weiter offen steht, er kann reisen, wohin er will; und der andere, der eine Straße weiter wohnt, kann nicht einmal seine Tante von drüben sehen.