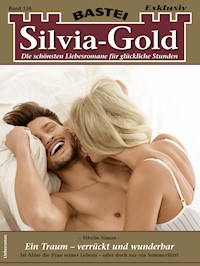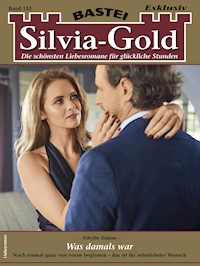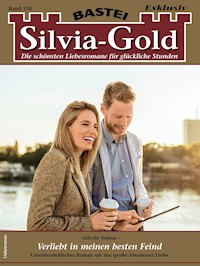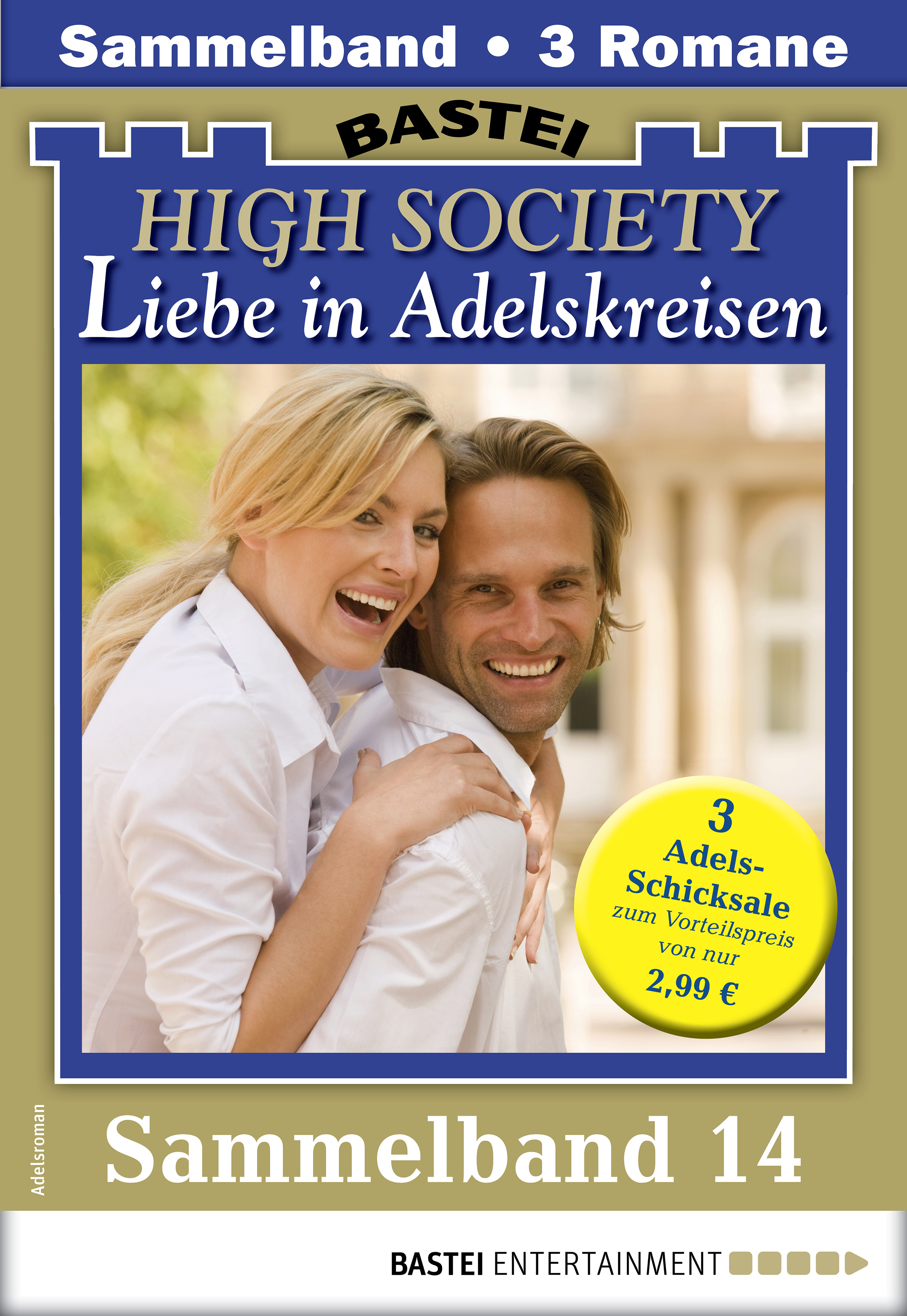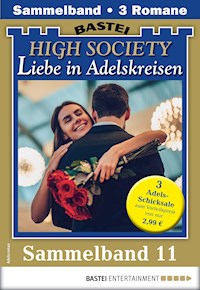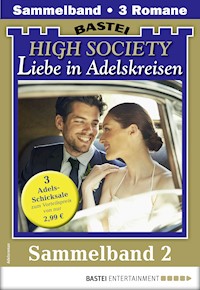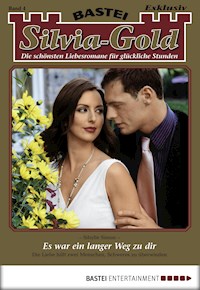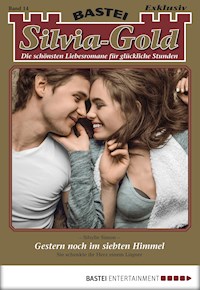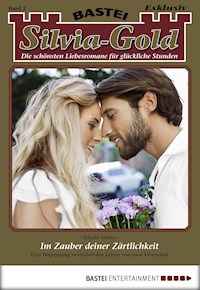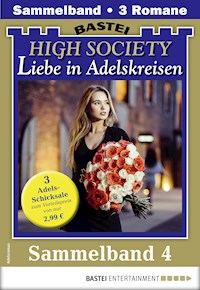
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
High Society - Liebe in Adelskreisen Sammelband
Leseglück für viele Stunden zum Sparpreis!
Es wird geliebt, gehasst, gewonnen und verloren. Werfen Sie einen Blick in die aufregende Welt der Reichen und Schönen und erleben Sie spannende Verwicklungen! Denn eins wird es in den feinen Kreisen garantiert nie: langweilig!
Was Frauen lieben und wovon sie heimlich träumen, davon erzählen die Romane in High Society - Liebe in Adelskreisen auf mitreißende Weise. Die perfekte Mischung aus Humor, Romantik, Drama und großen Gefühlen lässt den Alltag schon auf Seite 1 in weite Ferne rücken.
Dieser Sammelband enthält die folgenden Romane:
Silvia-Gold 4: Es war ein langer Weg zu dir
In Adelskreisen 31: Florianes Debüt auf Schloss Ludwigsruh
Fürsten-Roman 2431: Verliebt in den Chauffeur?
Der Inhalt dieses Sammelbands entspricht ca. 250 Taschenbuchseiten.
Jetzt herunterladen und sofort sparen und lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Impressum
BASTEI ENTERTAINMENT Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG Für die Originalausgaben: Copyright © 2015/2016 by Bastei Lübbe AG, Köln Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller Verantwortlich für den Inhalt Für diese Ausgabe: Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln Covermotiv von © iStockphoto: JANIFEST ISBN 978-3-7325-8243-3Sibylle Simon, Marion Alexi, Juliane Sartena
High Society 4 - Sammelband
Inhalt
Inhalt
Cover
Impressum
Es war ein langer Weg zu dir
Vorschau
Es war ein langer Weg zu dir
Die Liebe hilft zwei Menschen, Schweres zu überwinden
Von Sibylle Simon
Sie haben eine wunderbare Zeit miteinander verbracht, damals in Paris. Doch sie trennten sich in der Gewissheit, dass es für ihre Liebe keine Zukunft geben kann.
Ein fataler Irrtum, wie beide schmerzlich erkennen, als sie sich viele Jahre später wieder gegenüberstehen. Nichts hat sich an ihren Gefühlen geändert, die mit elementarer Wucht über sie hereinbrechen. Wie in einem Rausch erleben Leonie und Marius die nächsten Tage und Nächte, sie wollen nur das Jetzt genießen und nicht an morgen denken.
Dabei vergessen sie, dass es in ihrem Leben Menschen gibt, die auf ihre Rückkehr warten …
Es war windig und regnerisch in der Einkaufspaßage, in der Flohmarkthändler ihre Kisten und Kästen geöffnet und auf langen Tischen eine Unzahl an Trödel arrangiert hatten.
Clemens de Boer und seine bildschöne Begleiterin schlenderten schon zum dritten Mal durch die Passage, immer noch auf der Suche nach einem Schnäppchen, wie so viele andere Besucher des Marktes auch.
Der Flohmarkt fand in der Altstadt statt. In den engen, mit Kopfstein gepflasterten Gassen herrschte normalerweise kein Verkehr, weder von Menschen noch von Autos. Heute jedoch drängelten sich die Leute durch die schmalen Gassen, und die Autos parkten sogar im Halteverbot. Aber da dies eine Ausnahme war, nahm niemand Anstoß daran.
»Schenkst du mir die?« Clemens’ Begleiterin war vor einem Tisch mit Schmuck stehen geblieben und hielt ein Paar Kreolen hoch.
Er zögerte nur kurz, dann machte er, mit einem Blick auf die Turmuhr der nahen St. Katharinen-Kirche, eine lässige Handbewegung.
»Mit Vergnügen. Wie teuer sind die? Fünfzehn Euro? Ich zahle zwanzig, sie sind nämlich wirklich sehr schön. Aber nun muss ich weg, Liebling, ich habe eine Verabredung zum Essen.«
»Clemens, kann es sein, dass du mich betrügst?«, schmollte die junge Dame, während sie sich vom Verkäufer die Kreolen an den Ohrläppchen befestigen ließ.
Der junge Mann lachte. »Nur hin und wieder, ehrlich. Und wenn, dann immer nur mit derselben Frau, das weißt du doch.«
»Ich hasse dich, Clemens de Boer!«, rief ihm seine Begleiterin hinterher, doch ihre Stimme klang dabei höchst vergnügt, was man angesichts ihrer Worte kaum erwartet hätte.
***
Clemens de Boer, dessen Galerie nur einen Steinwurf entfernt vom »L’etoile« lag – jenem feinen französischen Restaurant, in dem er seine Verabredung hatte – war ein hochgewachsener, breitschultriger Mann von Mitte dreißig, dem man regelmäßige sportliche Aktivitäten, wie zum Beispiel Tennis und Rudern, deutlich ansah. Sein Gesicht war, obwohl die Frühlingssonne bisher kaum länger als ein, zwei Stunden am Tag geschienen hatte, deutlich gebräunt. Die Haut spannte sich straff über seinen Wangenknochen, während seine Augen in einem sehr intensiven Hellblau leuchteten.
Lässig betrat er jetzt das Restaurant und überließ seinen Trenchcoat einem herbeieilenden Ober. Sein Auftreten war das eines Menschen, der alle Probleme schon seit geraumer Zeit gelöst hatte.
Und genau diese Eigenschaft war es, die die junge Frau, die an einem der kleinen, runden Tische auf ihn wartete, am meisten an ihm schätzte.
Im »L’etoile« war es nie besonders hell, aber heute, an diesem späten Nachmittag Ende Februar, war es so fahl wie draußen in der Gasse. Die Deckenbeleuchtung warf nur spärliches Licht auf das polierte Holz der Tische und Stühle, während der Regen an den bunten Scheiben der Bleiglasfenster herunterströmte.
Es war nicht länger zu übersehen, dass dieser Regen Clemens reichlich mitgenommen hatte während seiner Wanderung über den Flohmarkt. Das blonde Haar – ein Erbe seiner holländischen Vorfahren – fiel ihm nass in die Stirn, während er hastig im Gehen weitere Regentropfen von seinem Jackettärmel wischte.
Die Frau, die sich erhob, um ihn zu umarmen und sich von ihm rechts und links auf die Wange küssen zu lassen, zuckte mit einem erschrockenen Lachen zurück.
»Du bist ja nass wie ein Hund, den man draußen vor der Tür vergessen hat! Und wie siehst du überhaupt aus?«
»Ja, wie denn?«, fragte er etwas matt zurück und sank auf den Stuhl ihr gegenüber.
»Tja, ich weiß nicht so recht«, meinte sie zögernd, während sie wieder Platz nahm. »Irgendwie … derangiert.«
»Irgendwie derangiert? Ich bin zu Tode erschöpft, nachdem man mich drei Stunden lang über diesen lächerlichen Flohmarkt getrieben hat, immerzu auf der Suche nach einem besonderen Geschenk für …«
»Für Alexandra?«, half die junge Frau weiter, als er innehielt, weil ihm der Name seiner Begleiterin ganz offensichtlich nicht einfallen wollte.
Er fuhr sich mit einer Hand durch das feuchte Haar und wirkte sekundenlang ratlos.
»N-nein … Die Rede ist von Jennifer. Ja, ich glaube, sie heißt Jennifer. Oder Jessica? Vielleicht auch Janine … Tut mir leid, ich hab’s vergessen. Du kennst mein miserables Namensgedächtnis.«
»Ja, ich weiß. Du nennst sie alle immer Liebling oder Darling, und das, mein lieber Clemens, wird dir eines Tages das Genick brechen. Auf Dauer kann das nicht gut gehen. Wieso musst du auch immer gleich jede Zufallsbekanntschaft mit nach Hause nehmen?«, wurde sein Gegenüber energisch. »Kannst du es nicht einfach mal bei einem Essen oder einem Drink belassen?«
»Ich hasse es, den Abend alleine in meiner Wohnung verbringen zu müssen.«
Die junge Frau, die ihm gegenübersaß und ihn angesichts dieser Antwort nachdenklich ansah, war schlank und von einer hinreißenden Attraktivität. Das dunkle, glatte Haar, in der Mitte gescheitelt, fiel ihr gleichmäßig und glänzend bis auf die Schultern. Ihr weinrotes Twinset mit dem kleinen Rollkragen, die schwarzen Jeans sowie die flachen Stiefel aus schwarzem Nappaleder verrieten Geschmack und Stil. Farbton und Schnitt passten zur Haar- und Augenfarbe, ebenso zum hellen Teint. Dennoch war ihre Ausstrahlung die einer zurückhaltenden Frau, die zwar weiß, dass sie gut aussieht, es aber nicht oft gesagt bekommt.
Clemens erwiderte ihren Blick jetzt niedergeschlagen.
»Du verabscheust mich, nicht wahr, Leo?«
Leonie Eicken, von ihren Freunden kurz Leo genannt, schüttelte den Kopf.
»Natürlich nicht! Wieso sollte ich? Dein Privatleben geht mich nichts an, Clemens. Du bist mein Freund, deine Freundschaft ist mir wichtig, ebenso dein Wohlergehen. Das allerdings riskierst du mit der gleichen Zielstrebigkeit, mit der die Lemminge sich von der Klippe ins Wasser stürzen, wenn du mit den Frauen in deinem Leben weiterhin so achtlos umgehst.«
Bei den letzten Worten war sie bereits wieder ernst geworden, doch weil Clemens Ernsthaftigkeit nicht lange ertrug, rettete er sich, indem er nach der Speisekarte griff.
»Hast du schon gewählt?«
Leonie kannte ihn gut genug, um ihre Strafpredigt nicht noch länger auszudehnen.
»Äh – nein. Aber vielleicht sollten wir uns wieder einmal ein Chateaubriand teilen, was meinst du?«
»Mit einem kräftigen Rotwein dazu?«, ergänzte Clemens erfreut. »Sehr gerne.«
Später, als sie aßen, fragte Leonie sehr beiläufig: »Was ist eigentlich aus deiner Freundin geworden? Hast du sie etwa im Regen stehen lassen?«
»Nenn sie nicht meine Freundin«, widersprach er ihr sofort. »Und, bitte, Leo, hör auf, dir Sorgen zu machen. Jennifer – oder Jessica – ist kein hilfloses Ding, in deren Leben ich wie der große, böse Wolf eingebrochen bin. Sie hat gewusst, was sie tut, und im Regen steht sie ganz sicher nicht. Ihr Porsche parkt gleich um die Ecke, und bevor ich sie verließ, habe ich ihr ein Paar wundervolle antike Kreolen geschenkt. Sie wären ein Vermögen wert gewesen, weil sie nämlich sehr alt und absolut echt waren. Aber der Verkäufer hat’s nicht gewusst, Jennifer sehr wohl. Das verriet schon die Zielstrebigkeit, mit der sie sich die Dinger ausgesucht hat.«
Leonie musste unwillkürlich schmunzeln. Mit der Gabel auf ihn zielend, erwiderte sie kopfschüttelnd: »Bewundernswert, wie es dir immer gelingt, mich zu überzeugen.«
Clemens grinste wie ein großer Junge. »Ich wusste, dass du mich verstehen würdest. – Wie war übrigens dein Tag heute?«
»Normal«, antwortete Leonie nach kurzem Zögern.
Normal, das hieß nichts anderes, als dass sie an diesem Tag keine nennenswerten Einnahmen gehabt hatte. Ihr kleiner Hutladen befand sich direkt neben Clemens’ Galerie. Fast fünf Jahre waren sie nun schon Nachbarn, und vom ersten Tag an hatten sie sich wie zwei gute, alte Freunde gefühlt.
Sie wussten alles voneinander, teilten alles miteinander. Fünf Jahre lang, wiederholte Clemens hin und wieder in Gedanken und staunte, denn so lange hatte er es noch nie mit einer Frau ausgehalten.
Aber Leonie war ja auch nicht irgendeine Frau. Sie war seine Freundin. Eine richtige Freundin und die Einzige, die er jemals gehabt hatte.
»Also keinen einzigen Hut verkauft?«, erkundigte er sich mitfühlend und blickte dabei nicht von seinem Teller auf.
Leonie runzelte die Stirn. »Nein … jedenfalls nicht richtig. Eine Kundin hat sich einen Hut zurücklegen lassen. Sie will Anfang der Woche noch einmal mit ihrem Mann vorbeikommen, um seine Meinung dazu zu hören.«
Clemens verzog etwas geringschätzig den Mund.
»Meine Güte, muss eine Frau sich denn den Kauf eines Hutes vom Ehemann genehmigen lassen?«
Leonies Lächeln wurde trübe. »Nein, nein, aber man will eben sichergehen, dass es wegen eines Hutes kein Ehedrama gibt.«
Und dann aßen beide eine Weile schweigend.
Es waren eben schwierige Zeiten, tröstete Leonie sich in Gedanken, als wollte sie sich selber Mut machen. Welche Frau ging heutzutage los und kaufte sich einfach einen Hut, mochte er auch noch so schön sein? Hüte waren keine modische Notwendigkeit, sie waren eigentlich überhaupt keine Notwendigkeit. Man trug sie entweder immer oder gar nicht, egal, was die Mode gerade vorschrieb.
Früher hatte es Frauen gegeben, die ohne Hut das Haus nicht verließen, weil sie sich unangezogen fühlten. Das hatte sich erheblich geändert. Außerdem waren Leonies Hüte durchweg Unikate, sie entwarf und fertigte jeden einzelnen selbst an. Das kostete seinen Preis, denn Einzigartigkeit zählte nun einmal mehr als massenhaft Hergestelltes.
»Wie lief es bei dir?«, fragte sie in die Stille hinein, die zwischen ihr und Clemens herrschte, woraufhin er mit einem kleinen Seufzer die Schultern hob.
»Ach, auch nur mäßig. Kunst geht in diesen wirtschaftlich angespannten Zeiten genauso schlecht. Ich habe mehrere von Hand signierte Drucke von Horst Janssen verkauft … und einen Lichtenstein.«
Leonie starrte ihn mit ihren großen, dunklen Augen fassungslos an.
»Den Lichtenstein? Und das sagst du so dahin, als ginge es um irgendeinen Kaufhausdruck?«
Er legte kurz seine Hand auf ihre. »Ich wollte dich nicht deprimieren, Leo.«
»Du deprimierst mich nicht, wenn du ein gutes Geschäft machst! Im Gegenteil, ich freue mich für dich. Das ist fantastisch, Clemens! Ich werde doch wohl ernsthaft darüber nachdenken müssen, ob ich meine albernen Hüte nicht endgültig an den Nagel hänge und stattdessen in den Kunsthandel wechsle.«
»Da befindest du dich ja längst, denn alle deine Hüte sind Kunstwerke«, erwiderte Clemens.
»Danke, das zu hören, tut gut. Aber es wäre natürlich noch besser, wenn die Leute angesichts dieser Kunstwerke in einen nie da gewesenen Kaufrausch gerieten und meinen Laden ratzekahl leer kauften«, gab Leonie lakonisch zurück.
Clemens lehnte sich in seinem Stuhl zurück und prostete ihr mit dem Rotwein zu.
»Eines steht jedenfalls fest – die Rechnung für das Essen heute Abend zahle ich, und ich dulde keinerlei Widerrede.«
»Alter Angeber«, murmelte Leonie scheinbar bockig, doch in ihren dunklen Augen lag ein Lächeln.
»Kleine Hutmacherin«, sagte er kaum lauter, und über ihre Gläser hinweg blickten sie sich an und lächelten einander zu.
***
»Entschuldigt, wenn ich störe«, sagte die Frau, die nun an den kleinen Tisch trat und nur wenig älter als Leonie war. »Aber als ich eben draußen vorbeiging, sah ich euch hier sitzen und … also, ich muss es einfach loswerden, länger kann ich es nicht für mich behalten, weil ich dann nämlich daran ersticke. Darf ich mich zu euch setzen?«
»Elisabeth!«, sagte Leonie verblüfft und stellte ihr Glas mit einem Ruck wieder auf den Tisch.
»Frau Conradie!« Das war Clemens, nicht ganz so enthusiastisch.
»Frau Bürgermeister!«, beeilte sich indessen der herbeigeeilte Ober zu beteuern. »Was für eine nette Überraschung. Einen Stuhl für die Frau Bürgermeister, bitte!« Der Ruf galt dem Piccolo, der zehn Sekunden später einen dritten Stuhl an den Tisch schob, damit Elisabeth Conradie sich setzen konnte.
Sie war tatsächlich lediglich fünf Jahre älter als Leonie, dennoch gelang es ihr immer noch, jeden, der ihr zum ersten Mal begegnete, mit ihrer linkischen, ein wenig zerstreut wirkenden Art zu täuschen. Elisabeth Conradie gehörte zu jenen Frauen, die man auch mit Mitte dreißig noch als »Mädchen«, bezeichnete und denen man niemals zutraute, auch nur annähernd einen halbwegs intelligenten Satz über die Lippen zu bringen.
Gleichgültig, ob Elisabeth wie jetzt einen Schottenrock und eine lange Strickjacke darüber trug oder sich in ein Haute-Couture-Abendkleid zwängte: Sie schien nie zu wissen, was sie mit sich anfangen sollte.
Clemens, der große Ästhet und Kunstkenner, kannte kein einziges weibliches Wesen, das sich noch schlechter kleidete als Elisabeth, und alleine das reichte aus, um sie schlichtweg unerträglich zu finden.
Elisabeths Augen, die ihr ovales Gesicht fast ausschließlich beherrschten, waren groß und seegrün. Ihr Haar, sehr kurz und von hellem Rot, lugte da und dort unter dem dunkelgrünen Hut hervor, den sie natürlich bei Leonie gekauft hatte, denn Elisabeth war nicht nur Leonies beste Freundin, sondern auch deren allerbeste Kundin.
Es ging das Gerücht, dass sie für jeden Tag des Jahres einen anderen Hut besaß, aber das stimmte natürlich so nicht. Bestenfalls stapelte sie Hüte für jede einzelne Woche eines Jahres in ihren Schränken: Mehr jedoch waren es wirklich nicht.
»Was tust du hier?«, wollte Leonie jetzt, immer noch überrascht, von Elisabeth wissen, während der Ober ein weiteres Weinglas brachte. »Normalerweise ziehst du dich doch an den Wochenenden in deine Hütte auf dem Lande zurück – wenn dein Terminkalender es erlaubt.«
Elisabeth nahm ihren Hut ab, fuhr sich mit beiden Händen durch das rote Haar und antwortete dabei ironisch: »Wenn, ja, wenn … Zurzeit erlaubt er es nicht. Große Ereignisse werfen nämlich ihre Schatten an die Wand – oder wie das heißt.«
Clemens verzog so schmerzhaft getroffen das Gesicht, als hätte sich der erstklassige Rotwein letztlich doch noch als sauer erwiesen: Er verabscheute nicht nur Elisabeths absurde Art, aufzutreten, beziehungsweise sich zu kleiden, sondern auch die Angewohnheit, die guten, alten Redewendungen und Sprichwörter grundsätzlich durcheinander zu werfen.
Früher hatte er nie widerstehen können und sie regelmäßig korrigiert. Seit einiger Zeit jedoch siegte die Einsicht, dass das zu nichts führte.
»Große Ereignisse?«, wiederholte Leonie indessen aufhorchend. »Hier? In unserer Stadt? Was könnte das wohl sein?«
»Lass mich raten«, warf Clemens lässig ein. »Wahrscheinlich kommt Madonna zu einem Livekonzert in die Handballhalle.«
»Oder der Ministerpräsident hält endlich seine lang angekündigte Rede vor dem Magistrat?«, orakelte Leonie, schon leicht beschwipst nach dem zweiten Glas Bordeaux.
Clemens frotzelte reichlich respektlos: »Es könnte auch sein, dass der Prince of Wales die Insel Fehmarn endgültig zu seinem neuen Sommersitz erklärt und fortan dort seine Ferien mit der holden Gattin verbringt.«
»Hört auf, euch wie kleine Kinder zu benehmen«, wurde Elisabeth rigoros, was sie durchaus mühelos konnte. Sonst wäre ihr es wohl auch nie gelungen, bei der Wahl zur Bürgermeisterin der Stadt alle anderen – ausschließlich männlichen – Bewerber aus dem Rennen zu werfen.
»Keine Madonna, kein Minister oder was auch immer«, fuhr sie sachlich fort und schnupperte an ihrem Wein, als fürchte sie, Clemens hätte ihr beim Einschenken Gift hineingetan. »Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass ich seinerzeit die Idee hatte, dass Heiner Behringer für seine Verdienste als Freund und Förderer von Kunst und Kultur in unserer Stadt eine besondere Ehrung erfährt …«
»Ihr wolltet eine Straße nach ihm benennen«, warf Clemens, etwas schief lächelnd, ein.
Elisabeth nickte nachdrücklich. »Das hat der Magistrat in der Sitzung gestern Abend einstimmig beschlossen. Es wird demnächst einen Heiner-Behringer-Weg geben.«
»Schade, dass er das nicht mehr erlebt«, stellte Clemens fest. »Soviel ich weiß, ist der Mann schon seit ein paar Jahren tot.«
Elisabeth hob mahnend den rechten Zeigefinger.
»Genau gesagt, seit sechs Jahren. In seinem Testament hat er seinerzeit die Stadt sehr großzügig bedacht. Ich erwähne nur mal die Summe, die die Behringer-Stiftung regelmäßig für die jungen Künstler aller Genres zur Verfügung stellt. Dazu die Behringer-Villa, wo wir das Projekt Heimatmuseum realisieren konnten, und nicht zu vergessen den ›Kunstkilometer‹, den er ins Leben gerufen hat und der sich heute auf weitaus mehr Kilometern durch die gesamte Stadt zieht.«
Clemens’ Lächeln wirkte immer noch skeptisch.
»Der Mann hätte eine Prachtstraße mit seinem Namen verdient gehabt, finden Sie nicht, Frau Conradie? Und der Magistrat speist ihn mit einem lächerlichen Schild für einen kleinen Weg ab?«
»Ach, sei doch nicht immer so miesepetrig«, tadelte Leonie und schob ihr Weinglas, nur zur Hälfte geleert, und auch den dazu servierten Käse weg, als schmeckte ihr gar nichts mehr. »Ich finde, es ist eine schöne Sache, die Elisabeth da angeschoben hat. Meistens wird in der Politik doch nur geredet, aber selten etwas tatsächlich realisiert.«
Daraufhin lächelte Clemens ein weiteres Mal nur schwach, während er abwehrend eine Hand hob.
»Ich bin nun mal der Ansicht, dass man Menschen wie Heiner Behringer gar nicht genug Ehre erweisen kann. Diese Stadt hat von dem Mann nur Gutes erfahren – wieso eigentlich? Soviel ich weiß, hat er die meiste Zeit gar nicht hier gelebt.«
Elisabeth strich sich wieder durch das rote, kurze Haar, ehe sie antwortete: »Er hatte mehr als nur diesen einen Wohnsitz. Behringer war ein unruhiger Geist, hat viel ausprobiert, aber eigentlich selbst kein einziges künstlerisches Talent entwickelt. Das kann man von seinem Sohn allerdings nicht behaupten.«
Clemens lehnte sich wieder zurück und zündete sich eine seiner französischen Zigaretten an.
»Ah ja, der große Meister«, murmelte er, dem Zigarettenrauch hinterher blickend. »Marius Behringer. Nach – ich weiß nicht, wie vielen – Jahren ist er plötzlich wieder zurück in der Kunstszene und besser denn je.«
»Sie kennen ihn?«, fiel Elisabeth ihm, plötzlich ganz sachlich, ins Wort.
Clemens stutzte nur kurz, dann antwortete er knapp: »Persönlich? Nein. Wieso?«
Elisabeths Blick, ihr ganzes Auftreten hatte mit einem Mal überhaupt nichts Vages, Verhuschtes mehr. Sie fixierte den jungen Mann über den Tisch hinweg mit einer solchen Entschlossenheit in den Augen, dass der eine Ahnung bekam von jener Energie, die sie ihre Ziele erreichen ließ.
»Würden Sie sich zutrauen, eine Laudatio auf den alten Behringer und gleichzeitig auch auf dessen berühmten Sohn zu halten?«
Clemens’ Hand mit der Zigarette sank herab. Er starrte erst Elisabeth, dann Leonie an.
»Wie? Was?«, stieß er konsterniert hervor.
Auch Leonie schien nun verunsichert.
»Elisabeth, was redest du denn da?«, wollte sie befremdet wissen, und prompt lächelte ihre Freundin nachsichtig.
»Ich höre mich höchstwahrscheinlich etwas wirr an, aber es ist seit gestern Abend so viel passiert. Also, als ich damals die Idee hatte, eine Straße oder einen Weg in unserer Stadt nach Heiner Behringer zu benennen, teilte ich diese Absicht gleichzeitig seinem Sohn in New York mit. Nicht, dass er jemals darauf geantwortet hätte. Jedoch, der Mensch hofft, solange er lebt …«
Der Mensch irrt, solange er lebt!, verbesserte Clemens in Gedanken, zog es aber vor, zu schweigen, denn Elisabeth jetzt zu unterbrechen, hieß, sich endgültig ihres Wohlwollens zu berauben, und das erschien ihm in diesem Moment unangebracht.
»Also, kaum hatte der Magistrat gestern in der Sitzung den Beschluss für den Heiner-Behringer-Weg einstimmig gefasst, da erhielt ich, als ich noch einmal in mein Büro ging, eine E-Mail. Die Agentin des Behringer-Sohnes teilte mir in fünf knappen Sätzen mit, dass Mr. Behringer gerne persönlich zur Einweihungsfeier kommen würde, falls unsere Stadt die Idee, dem Andenken seines Vaters eine Straße zu widmen, inzwischen weiterverfolgt hätte. Was sagt ihr dazu?«
»Ich bin sprachlos«, flüsterte Clemens, irgendwie ergriffen.
»Ich auch«, sagte Leonie, fast noch leiser als er.
Elisabeth lehnte sich mit einem zufriedenen Lächeln zurück.
»Ich habe der Dame sofort geantwortet. Die Sache hätten wir also in grünen Tüchern«, verkündete sie mit einem ihrer rätselhaft verschlungenen Sätze.
***
Leonie schloss die Tür ihres kleinen Ladens hinter sich, die Türglocke klingelte noch einmal, dann war es still. Sehr still, wie Leonie feststellte. Sie drehte sich um und ging rasch den Bürgersteig hinunter. Wind und Regen trafen sie ungehindert, durchnässten ihr Haar und ihren Mantel, aber sie bemerkte es nicht einmal.
Irgendwann begann sie zu laufen und durchquerte den Park, als müsste sie irgendeinen Verfolger abschütteln, dabei gab es niemanden außer ihr, der sich bei diesem Wetter hierher verirrt hatte. Wer ging schon bei Sturm und Regen in dieser Jahreszeit abends um sechs im Park spazieren?
Leonie stellte sich diese Frage nicht. Sie wollte nur fort, wollte ihren eigenen quälenden Gedanken entfliehen, nachdem es ihr immerhin gelungen war, fast drei Tage lang so zu tun, als hätte es den Abend mit Elisabeth und Clemens im »L’etoile« nicht gegeben.
Erst kurz vor Ladenschluss, als sie sich bereits in Sicherheit gewähnt und noch eine junge Frau den Hutladen betreten hatte, um sich nach einer Kreation für eine bevorstehende Hochzeit umzusehen – da war es über Leonie hereingebrochen, dieses Dunkle, Bedrohliche. Ihre Vergangenheit.
Mit jeder Minute, die die Kundin länger gebraucht hatte, um sich zwischen einem Florentiner Hut und einer schlichten Kappe mit schwarzem kleinen Schleier über den Augen zu entscheiden, war Leonie unruhiger geworden. Auf einmal war ihr der Raum viel zu eng erschienen. Alles, was die Kundin gesagt hatte, war an ihr vorübergeglitten.
Ihr Atem war flach geworden. Sie hatte förmlich gespürt, wie ihr Gesicht alle Farbe verlor. Mein Gott, wollte diese Person denn gar nicht mehr gehen?, hatte Leonie sich schließlich zornig und verzweifelt zugleich gefragt und sich zu Geduld und Aufmerksamkeit zwingen müssen.
Als der Kauf des Florentiner Hutes endlich besiegelt gewesen war und das Klingeln der Türglocke verkündet hatte, dass Leonie es überstanden hatte, hatte sie den Schlüssel mit wahrer Verbissenheit im Schloss umgedreht und im nächsten Moment schon alle Lampen im Laden ausgeschaltet.
Aber sie konnte die eigenen Gedanken, die wie eine Springflut in ihr emporstiegen und an die Oberfläche wollten, nicht länger aufhalten. Sämtliche, in vielen Jahren sorgfältig geschaffenen Vermeidungstechniken und Verleugnungsstrategien brachen zusammen wie Streichhölzer bei einem Dammbruch.
Sie blieb stehen und zwang sich, ruhig zu atmen. Sie zwinkerte immer wieder. Keine Tränen!, befahl sie sich. Nein, sie würde nicht weinen. Sie hatte nie leicht geweint, und auch deshalb fürchtete sie sich vor ihren Tränen, von denen sie wusste, dass sie heiß und bitter sein würden nach so vielen Jahren …
Während sie so da stand und das Gesicht schutzlos dem Wind und dem Regen darbot, begriff sie plötzlich, wohin sie unterwegs war. Sie lief nach Hause. In ihrer großen Not hatte sie ihre kleine Wohnung über dem Hutladen völlig vergessen. Irgendetwas in ihr hatte die Tatsache geradezu ausgeblendet, dass sie den langen Weg nach Hause gar nicht machen musste – es sei denn, sie konnte nicht anders.
Leonie hätte jetzt gerne über die eigene Dummheit gelacht, wenigstens gelächelt, aber es gelang ihr nicht. Stattdessen erkannte sie schlagartig, wie schutzbedürftig sie in diesem Moment war, wie sehr sie sich nach der Geborgenheit ihrer Kindheit zurücksehnte und dass die eigene kleine Wohnung ihr das jetzt nicht würde geben können, was sie am meisten suchte und brauchte: ein Zuhause.
Sie begann wieder zu laufen. Einmal stolperte sie über eine Baumwurzel und stürzte, erhob sich jedoch sofort wieder und lief weiter, spürte den Schmerz in ihrem rechten Knie überhaupt nicht und auch nicht das Blut, das an ihrem Bein herunterrann und allmählich durch den Stoff ihrer Jeans drang.
***
Das Haus der Familie Eicken hatte keinen Namen. Es hatte auch nie einen Namen gehabt. Auf einem kleinen bronzenen Schild, das man in einen riesigen Findling am Ende der Auffahrt eingelassen hatte, stand lediglich der Name »Eicken«. Der Feldstein wirkte beeindruckender als das Haus, denn es war letztlich weiter nichts als eine kleine Villa mit einer Veranda vorne und einem sehr viel später angebauten Wintergarten hinten.
Es hatte Leonie nie viel bedeutet, hier zu leben. Ein Haus war eben nur ein Haus, hatte sie immer gemeint, doch dass ein Haus irgendwann eine Zufluchtsstätte sein konnte – die Erfahrung machte sie an diesem Abend.
Leonie stürmte die Stufen zur Eingangstür hinauf, inzwischen restlos erschöpft und am Rande des Zusammenbruchs. Als sie eben die Tür mit ihrem Schlüssel öffnen wollte, wurde die Tür bereits von innen geöffnet.
Eine junge Frau, die ihr helles Haar im Nacken zu einem Knoten zusammengewickelt hatte, blickte Leonie ohne jedes Zeichen von Erstaunen oder gar Überraschung entgegen, sondern sagte nur mit dunkler, fast herber Stimme: »Was ist denn los? Du siehst ja fürchterlich aus. Hast du dich verletzt? Meine Güte, du hattest hoffentlich keinen Autounfall!«
»Nein, nein«, stieß Leonie immer wieder wie mit letzter Kraft hervor, machte einen Schritt auf die andere zu – und wurde im nächsten Augenblick ohnmächtig.
***
Anja Eicken war zwei Jahre jünger als ihre Schwester Leonie, hatte jedoch schon immer erwachsener, gesetzter, beherrschter gewirkt. Es schien nichts zu geben, was Anja wirklich aus der Fassung bringen konnte, offenbar schon gar nicht dieser unangekündigte abendliche Besuch ihrer Schwester.
Anja rief, während sie Leonie in einen Sessel in der Eingangshalle setzte, nach der Haushälterin, die so prompt erschien, als hätte sie nur auf ihr Stichwort gewartet. Auch sie stimmte nicht etwa ein Klagelied an, sondern half, die immer noch ohnmächtige Leonie ins Wohnzimmer zu tragen, wo die beiden Frauen sie aufs Sofa legten.
»Wolldecken, eine Wärmflasche, heißen Tee mit Rum«, ordnete Anja dann mit einer Stimme an, die verriet, dass sie daran gewöhnt war, anzuordnen, anzuleiten, ja, auch zu befehlen. Sie beugte sich über ihre Schwester und tätschelte ihr, nicht übermäßig sanft, die blassen Wangen.
»Komm schon, Leo, wach auf! Du kannst nicht einfach hier hereinplatzen und dann umfallen. Das tut man nicht. Haben Sie alles?« Das galt der Haushälterin, die in Windeseile mit den gewünschten Dingen unter dem Arm, beziehungsweise auf einem Tablett zurückkehrte.
Während sie Leonie in eine warme Decke wickelte, ihr gleichzeitig die Wärmflasche an die eiskalten Füße legte und ihr den stark nach Rum duftenden schwarzen Tee unter die blasse Nase hielt, fuhr Anja mit gesenkter Stimme, als spräche sie mit sich selber, fort: »Sie ist hoffentlich nicht schwanger … Ich meine, möglich ist alles, nicht wahr? Aber das hätte sie mir gesagt … Oder etwa nicht? Zuzutrauen wäre es ihr … Gibt es vielleicht irgendeinen Mann in ihrem Leben? Hallo, Leo! Wie nett, dass du mich besuchst. Wie wär’s mit einer guten Tasse Tee?«
»Mir ist schlecht«, flüsterte Leonie, die soeben die Augen geöffnet und sich etwas verwirrt umgeschaut hatte.
»Das macht nichts«, behauptete ihre Schwester. »Das geht vorbei. Jetzt trink mal was. Und dann guck ich mir dein Knie an. Wie, um alles in der Welt, hast du das hingekriegt?«
»Ich … bin gestürzt«, stammelte Leonie mit schwacher Stimme und begann zu weinen. Sie weinte, wie ihre Schwester sie noch nie hatte weinen hören, verzweifelt und laut schluchzend, dass es sie beinahe zerriss.
Anja half ihr nicht. Sie war nicht der Typ, der andere liebevoll tröstend in die Arme schloss. Sie war kühl und sachlich, und so sagte sie auch jetzt nichts, wirklich überhaupt nichts.
Stattdessen tat Anja einige sehr vernünftige Dinge. Sie ordnete, zum Beispiel, die herumliegenden Zeitungen, öffnete ein Fenster, um frische Luft hereinzulassen und blieb dort eine Weile stehen, wobei sie Leonie den Rücken zu wandte – einen sehr geraden, entschlossenen Rücken.
Leonie war der Schwester letztlich dankbar für ihre Nüchternheit und das Schweigen. Sie wollte jetzt nicht mit den üblichen billigen Phrasen wie »Ach, das wird schon wieder!«, oder »Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird!«, getröstet werden. Genau genommen wollte sie gar keinen Trost.
Sie wollte endlich weinen, schwach, verletzlich und todunglücklich sein dürfen, und die Gelegenheit gab Anja ihr. Vielleicht war Leonie auch deshalb nach Hause geflüchtet. Weil Anjas Art, Trost zu spenden, so gar nichts Mütterliches, Liebevolles hatte. Denn das hätte Leonie in diesen Minuten nicht geholfen.
Sie wollte nicht bedauert werden, sondern sich einfach nur selber erlauben, jahrelang unter Kontrolle gehaltenen, schmerzvollen Erinnerungen freie Bahn zu lassen. Und damit nicht alleine sein, wenn es geschah.
Für diese Situation war ihre kleine, aber so kluge und besonnene Schwester genau der richtige Mensch.
Anja schloss nun das Fenster und kehrte zu Leonie zurück, um ihr ein Taschentuch zu reichen. Dann holte sie sich einen Stuhl, setzte sich, schlug die Beine übereinander und sagte mit ihrer herben, sachlichen Stimme: »Ich hatte dich eigentlich schon viel früher erwartet.«
Leonie, die gerade ihre Tränen trocknete, erstarrte in der Bewegung. Ihr Kopf ruckte empor.
»Du hast es gewusst?«
»Natürlich hab ich es gewusst«, gab ihre Schwester lakonisch zurück. »Ich bin die Pressereferentin der Bürgermeisterin! Schon vergessen?«
Leonie starrte sie sekundenlang fassungslos an, dann griff sie nach dem Teebecher, um ihn bis auf den Boden zu leeren.
»Das war jetzt sehr mutig von dir«, stellte Anja fest. »Es war nämlich mehr Rum als Tee drin. Aber das kann nur gut sein, du brauchst was Kräftiges.«
Leonie wischte die Worte mit einer heftigen Handbewegung beiseite.
»Du hast es die ganze Zeit gewusst und mir nichts gesagt?«, stieß sie erschüttert hervor.
Anja bot in diesem Augenblick in ihrem taubenblauen engen Strickkleid, den grauen Strümpfen und ebenfalls blauen flachen Wildlederschuhen, den übereinandergeschlagenen Beinen und dem kerzengeraden Rücken das Bild absoluter Perfektion und gleichzeitiger Gelassenheit.
»Was hätte ich dir sagen sollen?«, fragte sie zurück. »Elisabeth hat die Sache noch vor meiner Zeit ins Rollen gebracht. Damals war sie nur eine kleine Hinterbänklerin im Magistrat, ich glaube, sie hat im Kultur- und Jugendausschuss mitgearbeitet. Jedenfalls haben die anderen ihre Idee mit der Straße für den alten Behringer nur mitleidig belächelt. So hat man es mir nachträglich erzählt.«
»Sie hat mir gegenüber nie was davon erwähnt«, murmelte Leonie in ihr Taschentuch.
»Es gab ja auch nichts zu erwähnen«, erläuterte Anja mit ihrer unverändert sachlichen Pressereferentinnen-Stimme. »Sie schickte einen Brief an die New Yorker Galerie des jungen Behringer – und es kam nichts zurück. Drei Jahre lang nur großes Schweigen.«
»Bis Freitagabend«, fügte Leonie halblaut hinzu und starrte ins Leere. »Dann kam die E-Mail.«
»So ganz stimmt das nicht, aber typisch, dass sie es so jetzt überall herumerzählt.« Anja lächelte ein wenig herablassend. »Die Mail habe ich bekommen und sie dann umgehend an die Bürgermeisterin weitergeleitet. Ich bin anschließend zu ihr ins Büro gegangen, wo sie weinend in ihren Computer starrte und schluchzte: ›Ach Gott, ach Gott! Und: Regeln Sie das, Anja.‹ Tja, das hab ich dann auch getan. Eine halbe Stunde nach Mitternacht war die Sache unter Dach und Fach.«
Leonie war immer noch sehr blass, doch der Rum begann allmählich zu wirken.
»Er kommt also?«, fragte sie nach einem langen Schweigen unerwartet ruhig.
»Er kommt«, bestätigte ihre Schwester und nickte. »In drei Wochen ist er hier. Für drei Tage. Feierliche Begrüßung des Künstlers durch die Bürgermeisterin und den Magistrat. Feierliche Einweihung des Behringer-Weges. Irgendjemand soll eine Laudatio halten, auch feierlich selbstverständlich. Am zweiten Tag ist ein großes Essen geplant und eine Stadtführung, damit der junge Behringer sehen kann, wie man das Geld seines Vaters angelegt hat. Den dritten Tag möchte Marius Behringer gerne privat verbringen – und dann ist er auch schon wieder weg.«
Leonie starrte immer noch ins Leere. Dabei boten die schönen alten Bogenfenster des Hauses einen so schönen Blick auf den Park und den Stadtkanal dahinter. Aber sie nahm nichts wahr, nicht das Geringste.
»Ich verlasse die Stadt«, erklärte sie schließlich kaum hörbar.
»Unsinn!«, widersprach Anja ihr sofort rigoros. »Er weiß doch gar nicht, dass du hier lebst. Dass sein Vater hier ein Landhaus mit Park besaß, wo er sich die wenigste Zeit im Jahr aufhielt, hat für den Sohn keinerlei Bedeutung. Er war nie hier, das ist eine Tatsache. Seine Kindheit hat er in Irland verbracht, die Jugend in Frankreich und von dort ist er nach New York gegangen.«
Leonie schlug die Hände vor das Gesicht.
»Ich möchte ihn nicht wiedersehen«, flüsterte sie immer wieder. Und danach: »Ich würde das nicht aushalten.«
Anja beugte sich zu ihr und antwortete ihr absolut mitleidlos: »Leo, es sind inzwischen viele Jahre vergangen. Marius Behringer hat dich längst vergessen.«
Seltsam, so sehr Leonie jenen ganz speziellen Trost immer geschätzt hatte, den Anja ihr zukommen ließ – diesen Satz wollte sie nicht hören. Sie presste die Hände gegen ihre Ohren, während sie hervorstieß: »Du sollst so etwas nicht sagen. Bitte nicht! Ich …« Und dann brach ihre Stimme.
Anja lehnte sich wieder zurück. Den Blick ihrer schönen dunkelblauen Augen auf die Schwester gerichtet, fasste sie mit Nachdruck zusammen.
»Acht, fast neun Jahre, Leo. Das ist eine Ewigkeit. Und wir wissen noch gar nicht, was er inzwischen erlebt hat, wie sein Leben gelaufen ist. Dass er zwei Jahre wie vom Erdboden verschluckt war, spricht für die Tatsache, dass ein Drama, eine Tragödie passiert sein könnte.«
»Er malt wieder«, erinnerte Leonie sich matt.
»Und wie er malt!« Nun konnte sich sogar Anja begeistern. »In seinen Bilder explodieren die Farben förmlich, sagen die Kritiker. Pure Lebensfreude behaupten die einen. Nichts als Verzweiflung sagen die anderen. Ich kann mich dazu nicht äußern, ich verstehe nichts von Malerei.«
»Ich eigentlich auch nicht«, sagte Leonie und warf die Wolldecke beiseite, in die Anja sie vorhin gewickelt hatte. »Und sein Stil hat sich seit damals ja auch ziemlich verändert … Ich würde gerne heute Nacht hier schlafen, weißt du, wenn es dich nicht stört und überhaupt …«
Nun wurde ihre Schwester, ganz gegen ihre Gewohnheit, fürsorglich.
»Natürlich stört es mich nicht. Bleib so lange, wie du willst. Und nun kümmern wir uns endlich um dein Knie. Mann, das sieht aber gar nicht gut aus.«
***
Marius Behringer konnte von seinem New Yorker Loft aus über den Central Park blicken, jenes unglaublich lebendige und gleichzeitig sehr ruhige, grüne Herz der riesigen Stadt, die man den »Big Apple«, nannte, weil hier so viele Menschen unterschiedlichster Herkunft lebten, deren Vorfahren größtenteils nur aus einem Grund hergekommen waren: Sie wollten ein Stück von diesem großen Apfel ergattern.
Als Marius damals nach New York gekommen war, hatte er die Stadt wie einen Schlag auf den Kopf empfunden. Wenn er schon gemeint hatte, Paris sei der absolute Albtraum einer Großstadt, so hatte der Koloss New York diese Vorstellung in jeder Hinsicht übertroffen.
Tagelang war er nicht fähig gewesen, sich auf irgendetwas zu konzentrieren. Die Menschenmassen, die sich über die Bürgersteige wälzten, der sich endlos durch die Straßen schleppende Verkehr, der Lärm, der Schmutz, der Staub, die Hitze – das alles zusammen hatte ihn schließlich in den Central Park getrieben, wo er Ruhe fand und von wo aus er sich zu orientieren begann.
Als junger Künstler hatte er selbstverständlich nur versuchen können, eine Unterkunft in Greenwich Village zu bekommen. So war es dann auch geschehen: zunächst in einer Wohngemeinschaft mit zwei anderen jungen Malern, später in einer winzigen Mietwohnung, die er sich mit einer japanischen Geigerin geteilt hatte, danach das erste eigene Apartment in der Nähe der Fifth Avenue, nicht weit von einer kleinen, aber durchaus renommierten Galerie.