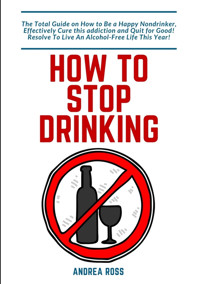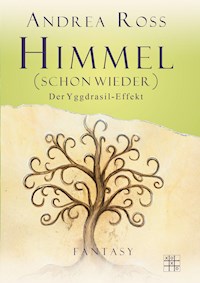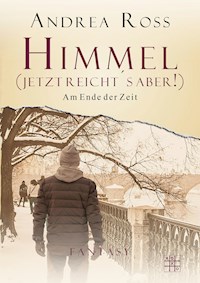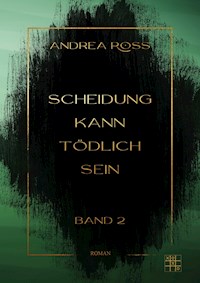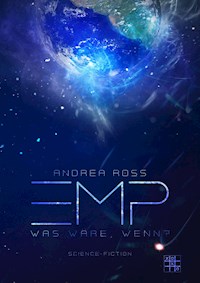Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Endzeit-Saga
- Sprache: Deutsch
Der Hamburger Programmierer Stephen McLaman wandert nach einem Streit mit seinem Vater nach Spanien aus, wird dort aber vom Pech verfolgt. Er erleidet an der Costa Blanca einen schweren Motorradunfall. Im Jenseits hat man schon auf ihn gewartet - der junge Mann wird mit diversen Aufträgen betraut. Einer davon führt ihn zurück auf die Erde, wo er auf eine labile junge Frau aufpassen soll Hätte er nur geahnt, dass dieser Job mit der Wiederkunft des Messias und einem sehr wahrscheinlichen Kometeneinschlag im Jahr 2029 zu tun hat ... Wird es Stephen gelingen, die drohende Apokalypse zu verhindern?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrea Ross
Himmel (noch mal)
Der Anfang vom Ende der Welt
Teil 1 der Endzeit-Saga
XOXO Verlag
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-030-9
E-Book-ISBN: 978-3-96752-530-4
Copyright (2019) XOXO Verlag Umschlaggestaltung:
© Ulrich Guse, Art fine grafic design, Orihuela (Costa)
© Collage von Ulrich Guse, unter Verwendung eines Lizenzbildes von: dreamstime.de
Buchsatz: Alfons Th. Seeboth
Rechtlicher Hinweis:
Sämtliche Personen, Orte und Begebenheiten rund um diesen Roman sind, abgesehen freilich von real existierenden Ortschaften, frei erfunden. Dasselbe gilt bezüglich der beschriebenen Vorgänge bei Behörden sowie anderen Institutionen oder Firmen. Eventuelle Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Menschen sowie deren Vereinigungen sind von der Autorin nicht beabsichtigt und wären daher rein zufällig. Selbstverständlich gilt letzteres nicht für ›Öffentliche Personen‹ aus der Politik.
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149
28237 Bremen
Für meine Kinder Suzann, Patrick und Cedric
»Zur Wahrheit führt kein Pfad, und darin liegt ihre Schönheit; die Wahrheit ist etwas Lebendiges.«
Krishnamurti
Kapitel 1
An euren Taten sollt ihr gemessen werden
Stephen saß mit hängendem Kopf auf seinem unbequemen weißen Stuhl. Bestimmt waren hier die Sitzgelegenheiten mit voller Absicht hart wie Kruppstahl, damit nur ja kein Wohlbehagen aufkam. Es war schließlich kein angenehmer Anlass, aufgrund dessen er hierher zitiert worden war. Jawohl, zitiert! Etwas gekränkt hatte der junge Mann einsehen müssen, dass er wohl Dinge getan haben musste, die der Sanktion durch die Obrigkeit unterlagen. Wie diese für ihn nun ausfallen würde, entzog sich leider total seiner Kenntnis.
Stephen fuhr sich mit nervösen Fingern zum wiederholten Male durch die strubbeligen, blonden Haare. Seine Haartracht war wie er selbst beschaffen: unbezähmbar, unkonventionell. Diese Eigenschaften ließen ihm in der Vergangenheit oft die Herzen der Mädchen zufliegen, weil er eben keiner von der Stange war. Jedoch dieses Mal hatten sie ihn wohl in arge Schwierigkeiten gebracht.
Steve, wie alle diesen potentiellen Delinquenten seit jeher nannten, schluckte den dicken Kloß in seinem Hals hinunter. Verdammt, wie lange dauerte denn das hier noch? Mit jeder Minute stieg seine Nervosität weiter an. Ob er einfach wieder gehen sollte? Aber was würde danach geschehen, könnte man ihm endgültig den Laufpass hier oben verpassen? Dabei hätte er früher alles gegeben, um nur einen raschen Blick auf dieses noble Szenario werfen zu dürfen, das sich soeben seinen Augen darbot. Die Leute versprachen sich einfach viel zu viel von diesem Laden hier. Die wussten es ja nicht besser!
Er konnte jetzt eigentlich nur hoffen, dass von den Herrschaften hinter der schweren, weißen Schleiflacktüre niemand Gedanken lesen konnte, denn schon wieder hatte er einen Fluch gedacht. Und das war hier natürlich, wie so vieles, verboten. Strengstens! Doch was sollte man denn tun, wenn man sich gerade zu Unrecht verfolgt fühlte? Wobei sich natürlich die Frage stellte, ob es an diesem Ort so etwas wie ›Unrecht‹ überhaupt geben konnte.
Dies war kein Arztwartezimmer. Somit gab es auch nicht die trivialen Zeitschriften, die dort allenthalben herumgelegen waren, wie er sich erinnerte. Mit denen hätte er sich jetzt wenigstens ein wenig ablenken können. Hätte sich in diesem Moment wahrscheinlich sogar eine von diesen total schmalzigen Frauenillustrierten hineingezogen, von denen regelmäßig sämtliche Promis und Königshäuser durchgehechelt wurden.
In Ermangelung jeglicher Druckerzeugnisse kreisten seine Gedankengänge immer wieder um seine Tat, deren angebliche Verwerflichkeit er nicht einzusehen vermochte.
Mit einem tiefen Seufzer quittierte Stephen die lästige Tatsache, dass es hier neben anderen Dingen keine Uhren gab, auch nichts anderes, womit man den Lauf der Zeit hätte messen können. Er war sich nicht einmal darüber im Klaren, ob so etwas Lineares wie Zeit überhaupt existierte. Er wusste nur, dass er sofort anzutanzen hatte. Und nun saß er hier herum und wartete, vermutlich bis zum Jüngsten Tag.
Wenigstens gab es an diesem Ort erst recht keine Krawatten, denn eine solche umzubinden, hätte ihm glatt noch mehr Überwindung abverlangt. Er hatte die Dinger immer gehasst, seinen Vater dafür verachtet, dass dieser jeden Tag so einen Kulturstrick umgelegt hatte. Dress-Code. Pah, das war etwas für Leute, die keine Persönlichkeit besaßen und den Menschen in ihrer Umgebung deswegen die Existenz einer solchen vorspiegeln mussten. Der Sinn und Zweck von Krawatten erschloss sich Stephen bis heute nicht. Und dann diese bescheuerten Müsterchen, die farblich zum gebügelten Hemd passen mussten. Nichts für Stephen!
Sein Blick fiel auf seine Schuhe. Die hatte er immer noch an, er mochte sich nicht an die hiesigen Sitten gewöhnen. Sie wirkten weder besonders schön noch besonders sauber. Aber das war jetzt nicht mehr zu ändern, genauso wenig wie die Tatsache, dass die Säume seiner Lederhose ausgefranst aussahen. Die würden ihn eben genau so nehmen müssen, wie er nun einmal daherkam. Angeblich zählten hier innere Werte mehr als Äußerlichkeiten. An diese Regel würde er die hohen Herrschaften notfalls eben erinnern müssen, falls er nachher scheele Blicke erntete.
Immer noch tat sich hier nichts. Gar nichts!
Stephen beschwor zum hundertsten Mal jene Szenen herauf, die dazu geführt hatten, dass er in Ungnade gefallen war. Was nur hatte er falsch gemacht? Es war doch nicht jeder Mensch wie der andere, und einige besaßen ganz spezielle Fähigkeiten. Er, Stephen, hatte doch nur einem Menschen ein bisschen Starthilfe verpasst, ihm ein wenig unter die Arme gegriffen. Na ja gut, es war ein weiblicher Mensch gewesen!
Ihm wurde noch heute schwindelig, wenn er an sie dachte. Unscharfe Bilder eines schlanken, anmutigen Körpers drängten sich schmerzhaft in sein Bewusstsein. Ein Lächeln, Grübchen in den Wangen. Und dieses wallende Haar.
Stephen seufzte wieder. Warum eigentlich suchten ihn immer noch derartige Empfindungen heim? Hätte er die nicht längst ablegen müssen? Wenn er sich die Anderen hier oben in der Zentrale der Macht so betrachtete, schienen diese längst über so ziemlich alles erhaben zu sein. Selbst der Rockertyp von letzter Woche, der nach einem Unfall in recht desolatem Zustand hier ankam. Nur eben er selbst nicht.
Wieder fiel ihm Lena ein. Wie hatte sie sich gefreut, als sie dank seiner Hilfe neue Einsichten gewann. Sie war so bezaubernd gewesen, wie ein kleines Kind, das seine ersten Schritte tat. Die er ihr ermöglicht hatte. Ihm war nichts anderes übrig geblieben, denn nur so hatte er mit ihr in Kontakt treten können. Und sie war es zweifellos wert gewesen, dass man sich um sie kümmerte. Das wusste er ganz genau.
Lena. Wie mochte es ihr gehen? Man verweigerte ihm mittlerweile den Zugang, er konnte keinerlei Präsenz mehr aufnehmen. Als er sie zuletzt gesehen hatte, trug sie eine hässliche weiße Jacke, deren Ärmel man hinten zusammengebunden hatte. Er sah ihren verzweifelten Blick, bevor man sie unsanft in ihr Krankenzimmer bugsierte. Nichts hatte er dagegen unternehmen können. Bei diesem furchtbaren Gedanken angelangt, spürte er sehr negative Empfindungen aufwallen. Auch die waren verboten, doch langsam war ihm schon alles einerlei. Ein zusätzlicher Punkt auf seiner Liste des Versagens machte auch keinen Unterschied mehr. Hoffentlich … !
Als Stephen aufsah, bemerkte er ein weiteres menschliches Wesen. Ah, noch ein böser Bube? Würde es ein Mehrfachtribunal geben? Wohl eher nicht, dieser hochnäsige Geselle ging schnurstracks an ihm vorbei, verschwand hinter dem glänzenden, riesigen Portal. So, wie der aussah, hatte er früher ganz bestimmt Krawatte getragen. Mit garstigen Diagonalstreifen.
Gespannt wartete Steve, spitzte die Ohren. Wieso durfte der da einfach rein und er nicht? Kein Geräusch drang nach draußen. Vielleicht hatte man ihn auch inzwischen vergessen, so lange, wie er schon hier saß. Wenn das so weiter ging, würde er bestimmt zu Biomüll kompostieren.
Mittlerweile war Stephens Nervosität in lähmende Langeweile umgeschlagen. Ihm war dermaßen öde zumute, dass er die Farbe der Türe kurzerhand in ein knalliges Rot änderte.
›Ups, nicht gut ... ‹ siedend heiß fiel ihm ein, dass speziell diese Farbe hier als Fauxpas angesehen werden könnte. Das war die Lieblingsfarbe der Konkurrenz, die ein paar Stockwerke tiefer residierte. So nahm er blitzschnell wieder eine Änderung vor, dieses Mal in ein gefälliges Türkisblau. Schon besser. Wobei diese Farbe nun wiederum sehnsüchtige Erinnerungen in ihm wachrief. Erinnerungen an einen Abend am Meer. Stephen ließ die Türklinken silbern irisieren, so dass sie wie Glanzlichter auf den Wellen wirkten.
Jawohl, er hatte diese Farbund Lichtkompositionen schon einmal gesehen. Damals. Kurz bevor es geschah.
*
Stephen hatte versucht, sich in seine Motorradhose zu quetschen, die ihm etwas eng geworden war. Während er schwitzend versuchte, den Knopf zu schließen, fiel an jenem Tag sein Blick über die Veranda hinaus aufs Meer. Drei Monate zuvor hatte er sich endlich seinen Traum verwirklicht, war nach Südspanien ausgewandert. Die Sonne ging eben unter und Steve realisierte, dass er spät dran war. Aber er musste mit dem Motorrad zu der Party fahren, ein anderes Fahrzeug hatte er nämlich nicht in sein neues Heimatland mitgebracht. Mit nichts, außer seinen Kleidern auf dem Leib und einem Rucksack, war er hierher an die Costa Blanca gekommen, denn das Appartement am Meer, das er bezog, war möbliert. Abgesehen davon hätte er auch nicht viel mehr besessen.
Diese Party war verdammt wichtig, damit er hier Fuß fassen konnte. Er würde dort einige Menschen treffen, die ihm sein Auskommen für die nächsten Jahre sichern sollten. Falls er den Auftrag erhielt, würde er das kleine Appartement bald in eine Villa umtauschen können. Die dann auch Kakerlaken-frei wäre. Bisher war es ihm gelungen, jeden Job an Land zu ziehen, für den er sich beworben hatte.
Stephen war nämlich der unangefochtene Meister in einer Königsdisziplin: scharfsinnig herauszufinden, was Menschen von ihm hören wollten, damit er ihnen haargenau die ersehnten Antworten zu servieren vermochte. Er konnte sein jeweiliges Gegenüber in Windeseile bis in den letzten Winkel seines Unterbewusstseins analysieren, und diese Gabe verschaffte ihm in jeglichem Rennen stets einen unschätzbaren Bonus. Steve galt als überaus eloquent und charismatisch, wobei er selbst sich manchmal fragte, was Menschen eigentlich an ihm fanden. Aber sie taten es – und das war es, was unter dem Strich zählte.
Er musste bloß noch diese verflixte Hose geschlossen bekommen, dann konnte es losgehen. Musste er eben ein wenig schneller fahren, doch das war mit seiner schweren Maschine das kleinste Problem. Zum Glück sah ihn niemand, während er rücklings auf seinem zerwühlten Bett lag und, zappelnd wie ein Fisch auf dem Trockenen, krampfhaft versuchte, seine Hose mit eingezogenem Bauch und angehaltenem Atem zu überreden, doch noch ein wenig nachzugeben; so machte er das damals. Stephen schwitzte, unternahm einen letzten Versuch – und hatte Erfolg.
Im Dauerlauf hastete er anschließend hinaus zu seiner eisblauen Harley, die chromblitzend in der Sonne stand und nur darauf wartete, dass er einen neuerlichen Tiefflug mit ihr unternahm. Wie lange war das eigentlich her? Das Erste, was sie ihm nach dem … Ereignis genommen hatten, war das Gefühl für Zeit und Raum gewesen.
Seine Harley! Beim Gedanken an dieses Kultobjekt kam er ins Schwärmen, ließ den Fußboden nun jenes sagenhafte Eisblaumetallic annehmen, das so perfekt mit schwarzem Leder und silberglänzendem Chrom harmonierte. Den Zweck seines Hierseins hatte er auf diese Weise schon fast vergessen. Daher schreckte ihn das ironisch hervorgebrachte »Nett!«, das jemand zu ihm sagte, unsanft aus seinen Gedanken.
Vor Steve stand dieser trockene, langweilige Typ, der vorhin in der Zentrale der Macht verschwunden war, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Nun bedeutete er Steve mit säuerlichem Gesicht, ihm zu folgen.
Die riesigen Portale schwangen vollkommen lautlos in ihre Öffnungsposition, als ein geräderter Steve und der ›Beamte‹, wie er den trockenen Typen mittlerweile insgeheim nannte, darauf zugingen. Jetzt war also unwiderruflich der Augenblick gekommen, die Strafe für seine Untaten klaglos entgegenzunehmen. Falls die gestrengen Schergen vom Tribunal dachten, er werde wie ein jämmerlicher Angsthase um Gnade oder mildernde Umstände winseln, hatten sie sich gründlich geschnitten! Er würde mit Fassung tragen, was immer sie mit ihm vorhatten. Sofern es da drinnen gerecht zuging …
*
Als er eintrat, war da … nichts. Absolut nichts außer gleißendem Licht. Er fühlte irgendeine Art Anwesenheit, oder nein, gleich mehrere davon. In seinem Kopf vernahm er vage eine Stimme, die ihm erklärte: »Wir spüren deine Unsicherheit, deine Angst. Daher werden wir uns in eine dir bekannte und daher angenehme Erscheinungsform transformieren, damit du problemlos mit uns kommunizieren kannst, Stephen McLaman.« Langsam bildeten sich aus dem diffusen Licht Formen heraus, die Steve zuerst schemenhaft, dann deutlich erkennen konnte.
Er stand in einem Saal, der nach oben hin offen wirkte. Um ihn herum gruppierten sich weiße Konferenztische, an denen zwölf helle, fast durchsichtige Gestalten saßen. Den hinteren Abschluss der Szenerie bildete eine Art Wolkenvorhang oder Wandschirm, hinter dem dieses alles durchdringende Licht hervorschien. Soeben nahm davor der ›Beamte‹, der ihn hereingelassen hatte, mit wichtiger Miene Aufstellung; er hielt ein Buch in Händen.
Stephen beabsichtigte zu fragen, was denn dieser fremde Kerl hier in seiner Verhandlung zu suchen habe, als vollautomatisch auch schon eine Anweisung ertönte: »Mäßige dich, und urteile nicht. Höre, was wir dir mitzuteilen haben«. Stephen hatte in seiner Erregung glatt vergessen, dass hier Gedanken ebenso deutlich bei anderen ankamen wie es auf der Erde nur gesprochene Worte vermochten.
Er fragte sich, wer von den zwölf Anwesenden eigentlich mit ihm gesprochen hatte. Die Stimme kam von überall und nirgendwo her, auch hätte er nicht ausmachen können, ob es sich um eine männliche oder eine weibliche Stimme handelte. Die Gestalten schienen keine festgefügten Konturen zu haben, sie verflossen optisch ineinander. Auch jetzt folgte die Belehrung auf dem Fuße:
»Wir alle hier sind Eines, und Eines ist alle. Die verschiedenen Erscheinungsformen eures irdischen Daseins basieren allesamt auf diesem 12-teiligen Prinzip, das gleichzeitig eine unzerstörbare Einheit, ein hochfunktionales Netzwerk bildet. Überall in der Geschichte der Erde stoßt ihr darauf, und wollt doch nicht verstehen. Erinnerst du dich? Schon in der Bibel ist die Rede von zwölf Stämmen Israels.
Menschen brauchen Bilder, Geschichten, ein Ordnungssystem, um sich die zwölf verschiedenartigen Strukturen – oder Energieschwingungen – überhaupt vorstellen zu können, welche die Grundlage jeglichen Daseins bilden … sozusagen die Matrix der Welt.
Die nordischen Menschen haben uns früher die Namen verschiedener männlicher und weiblicher Gottheiten, wie ›Thor‹ oder ›Freya‹ gegeben, um verschiedenartige Strukturen auszudrücken. Jeder dieser Götter besaß einen eigenen Charakter, erfüllte eine eigene Aufgabe im Himmel. Man erklärte sich damit auch gleich die Naturphänomene, die man damals noch nicht genau messen und verstehen konnte. Die Ägypter und Griechen, sowie zahllose weitere Zivilisationen, hatten auch jede ihr eigenes Pantheon erschaffen, das in den Köpfen der Menschen nach denselben Prinzipien funktionierte; schließlich versucht ihr noch in eurer Epoche, uns mithilfe der Tierkreiszeichen zu charakterisieren. Auch das sind zwölf, wie du weißt.
Zwölf Monate, zwölf Tagesund zwölf Nachtstunden. Und Jesus folgten genau zwölf Jünger, nicht wahr? Kein Zufall, denn Zufälle existieren nicht!
Es liegt gleichzeitig in der Natur der Menschen, sich gegenseitig wegen geringfügigen Unterschieden in den Vorstellungen über das Aussehen, die Beschaffenheit der zwölf Strukturen zu bekämpfen. Sie können dort unten nicht erkennen, dass der Name oder die Form, die ihr den Dingen gebt, völlig unerheblich sind. Manche lehnen sich gegen den Gedanken, es gebe mehrere ›Gottheiten‹, auf. Sie haben sich eine Religion geschaffen, die nur einen einzigen Gott verehren darf. Nun, auch sie haben Recht. Denn alle sind eines. Eine Einheit, die mehr ist als nur die Summe ihrer Teile.
Die Zahl 13 gilt bei euch als Unglückszahl, einfach weil es eine dreizehnte Energieform nicht gibt. Alles ist in der Zwölf enthalten, sie ist Vollkommenheit.
In der Christenreligion hat man euch gesagt, ihr sollt euch kein Bildnis Gottes machen. Das war die deutliche Warnung, dass wegen solcher Bildnisse Krieg und Verderben zwischen euch ausbrechen werden, weil niemand des Anderen Bildnis wird anerkennen können. Keiner von euch vermag die wahre Bedeutung der Wörter ›Gott, Allah, Jehova‹ zu erkennen, und dennoch tötet ihr euch gegenseitig um Seinetwillen. Dabei ist dieser Name, um den ihr euch so beharrlich streitet, nur der gemeinsame Oberbegriff für die Einheit der 12 Strukturen.
Ich kann dir auch erklären, was der Grund hierfür ist: der Mensch ist ein potentiell gewalttätiges Wesen, jeder einzelne trägt aggressive Züge in sich. Anders könntet ihr dort unten in der festgefügten Ordnung der Natur nicht überleben. Jene, die diese Züge leugnen oder sich nicht eingestehen wollen, verüben im Namen der Religion oder der Menschlichkeit oft die allerschlimmsten Verbrechen. Denn anstatt zu vereinen, spalten sie. Kleinlich ist der Menschen Geist.«
Die Stimme verstummte plötzlich, und Stephens Gedanken überschlugen sich förmlich. Diese Fülle an Information auf einen Schlag – das würde er in einer ruhigen Minute verarbeiten müssen. Die Matrix der Welt, na prima!
Er war niemals ein reger Kirchgänger gewesen, im Gegenteil. Zu scheinheilig erschienen ihm die Rituale, zu vordergründig die Anlässe, wegen denen seine Verwandtschaft so häufig die Kirche besuchte. Stephen war katholisch getauft, Sohn eines schottischen Geschäftsmannes und einer irischen Sekretärin. Von diesem Elterncocktail hatte er wohl auch sein unbeugsames, revolutionäres Wesen geerbt, das ihn zu mutigen Taten befähigte, ihm auch oft genug Schwierigkeiten einbrachte.
Aber es stimmte doch: auf der Beerdigung, wo jeder tiefste Trauer für den armen Verstorbenen zur Schau stellte, wurde hernach auf einer makabren Vorstellung namens ›Leichenschmaus‹ das Erbe in erbitterten Kämpfen aufgeteilt. So geschehen im letzten Jahr bei seinem Großvater Angus als auch bei seiner Großmutter Katarina.
Oder dann die Taufe seines kleinen Neffen! Die Anwesenden hatten nichts Besseres zu tun gehabt, als hinter vorgehaltener Hand über den mutmaßlich nichtsnutzigen Vater, der dieser Schlampe von Mutter den Säugling verehrt habe, zu tuscheln. Belinda, seine Halbschwester aus Vaters erster Ehe, hatte das mitbekommen, und seither war sie auf Familienfeiern nie wieder aufgetaucht. Er konnte ihr das kaum verübeln, fand es aber schade, denn Belinda hatte diese Veranstaltungen mit ihrer unkomplizierten Art immer aufgelockert. So wie er.
Noch schlimmer: die sonntägliche Beichte. Ich habe gesündigt? Na und … ich ziehe meinen Anzug an, erzähle das dem Pfarrer, und schon trage ich keine Schuld mehr. Die paar Rosenkränze sitze ich doch auf der linken Backe ab. Danach kann ich gleich wieder sündigen, denn nächsten Sonntag ist ja wieder eine Beichte, die mich davon befreit ...
Stephen mochte sich an solch verlogenen Aktionen schon lange nicht mehr beteiligen. Jetzt war er angeblich im Himmel gelandet. Doch ging es hier so zu, wie man ihm auf Erden immer gepredigt hatte? Nein! Es war die Rede von Tierkreiszeichen, von nordischen Göttern und wer weiß was noch alles. Und er sollte sich jetzt auch noch für etwas verantworten, das er selbst für eine gute Tat gehalten hatte.
Er hatte keine Ahnung, wie lange er schon tot war, oder warum er überhaupt hierher kommen durfte; schließlich hatte er schon seit Jahren keine Kirche mehr von innen gesehen. Wer mochte ihm die V.I.P.-Card für das Auffahren ins Paradies verehrt haben? Und dann die schnöde Art und Weise, wie hier mit ihm umgesprungen wurde! Kaum hatte er quasi den ersten Fuß auf die Wolke gesetzt, wurde er schon für eine Aufgabe abkommandiert. Keiner hatte ihm zuvor erklärt, wie er das machen sollte: Leuten auf der Erde helfen, bestimmte Vorkommnisse verhindern. Die hatten so getan, als wäre dies so einfach wie Einkaufen.
Der erste Auftrag war ja noch einigermaßen mit Phantasie und Witz zu erledigen gewesen. Man hatte ihn mitten in die graue Vorzeit abkommandiert, wo er ein zu frühes Wettrüsten der Völker kurz und schmerzlos beenden sollte. Denn das war nach der Progression des Plans erst viel später vorgesehen, so kurz vor Schluss, nicht allzu lange vor Armageddon. Trotzdem hatte so ein findiger, bepelzter und verlauster Kerl viel zu früh Dinge erfunden, die er nicht hätte erfinden sollen.
Als erstes hatte sich Stephen mit der Tatsache vertraut machen müssen, dass so etwas wie eine gerade Zeitlinie hier oben nicht existierte. So konnten tote Menschen aus dem Jahr 2004 in Dinge eingreifen, die eigentlich schon in der Steinzeit stattgefunden hatten. Dies alles war offenbar Teil des göttlichen Plans; somit war es kein Wunder gewesen, dass er einen tödlichen Motorradunfall baute. Er hätte ihn gar nicht vermeiden können, man hatte ihn hier oben längst für seine Einsätze eingeteilt. Alles war Vorhersehung.
Auch dieser vermaledeite (›Entschuldigung!‹) Knopf seiner Motorradhose. Der hatte dafür gesorgt, dass er spät dran war und daher genau zum richtigen Zeitpunkt diesem Lastwagen mit der Aufschrift Hnos. García begegnete. Natürlich musste der Fahrer haargenau in dem Augenblick, als ihn Stephen wie der Blitz auf der Gegenfahrbahn passierte, sein klingelndes Handy aus der Hosentasche fummeln, wodurch er leicht das Steuer verriss. Noch bevor der abgelenkte Lkw-Fahrer sein
»¿Digame?« murmeln konnte, krachte es bereits infernalisch, und die Trümmer der Harley verteilten sich über die Landschaft. Nein, er hatte kein schönes Ende gefunden. Wenigstens waren ihm jegliche Schmerzen erspart geblieben.
Die Stimme aus dem Hintergrund ertönte wieder. »Stephen McLaman, es scheint, als hättest du wenigstens einige der Zusammenhänge in der Zwischenzeit reflektiert; das rechtfertigt unser Vertrauen in dich. Wir haben lange analysiert, ob wir dich hier oben wirklich aufnehmen wollen, denn du warst zum Zeitpunkt deines Todes voller Egoismus, voller Bitterkeit und voll von hektischen, negativen Gedanken. Also voll von alledem, was wir hier nicht schätzen. Doch hattest du einen hartnäckigen Fürsprecher: IHN!«
Sämtliche Erscheinungen drehten sich nun ausgerechnet in Richtung des ›Beamten‹, sahen ihn liebevoll an. »Übrigens, unten rief man ihn Julian.«
›Kenne ich nicht‹, dachte Steve. ›Wieso sollte denn ausgerechnet der, bitteschön, eine Verbindung zu mir aufgebaut haben? Einen Langweiler wie ihn hätte ich unten bestimmt nicht in meinem Dunstkreis geduldet.
Ups! Diese Gedanken hatte Julian wohl auch schon aufgefangen, denn er sah Stephen nun direkt an, das Buch immer noch in Händen. Er hielt es vor seinen Körper, als wäre es ein Schutzschild. Und doch – irgendwie kam Stephen dieses Bild bekannt vor, wie dieser Typ so mit seinem Buch dastand. Wo hatte er das schon einmal gesehen? Was war das denn überhaupt für ein Buch? Stephen sah neugierig genauer hin. Andersons Märchen!
Nun schwante Steve etwas. Julian erwiderte seinen fragenden Blick und nickte kaum merklich. Meine Güte, konnte das denn möglich sein? Vor Steve stand sein kleiner Bruder. Sein kleiner Bruder, der im Alter von nur fünf Jahren an Leukämie gestorben war. Genauso, wie er jetzt dastand, hatte er, angetan mit seinem Bärchen-Schlafanzug, am Abend immer im Türrahmen seines Kinderzimmers gestanden und gebettelt, man möge ihm aus dem Märchenbuch vorlesen. Aus jenem, das er auch jetzt so krampfhaft festhielt.
»Du ... du bist groß geworden!« bemerkte Steve etwas hilflos. Julian lächelte mild. »Weißt du, Stephen, ich habe dich großen Bruder immer so sehr bewundert. Und du hast mich als Kleinen nie ernst genommen; da wollte ich dir wenigstens hier auf Augenhöhe gegenübertreten.«
Er hatte Recht. Die beiden Brüder waren wie Feuer und Wasser gewesen. Der eine wild und unberechenbar, der andere sanft und geradlinig. Sie hatten sich von Anfang an bekämpft; als Julian krank geworden und schließlich ans Krankenlager gefesselt gewesen war, fiel Stephen erst auf, wie sehr er ihm jeden Tag fehlte. Der Kleine hatte immer das Gegengewicht zu seinem ungestümen Wesen gebildet, hatte ihn etwas ausgeglichen. Am Tage seines Todes meinte Stephen, ohne ihn nicht weiterleben zu können. Als hätte man ihm eine Hälfte weggerissen.
Die Familie gab Julian sein Märchenbuch mit ins Grab, das er so sehr geliebt hatte. Und Stephen schenkte ihm sein Lieblingsauto, das er ihn zu Lebzeiten niemals hatte anfassen lassen. Das war vor mehr als 20 Jahren gewesen. Und jetzt stand sein Bruder vor ihm, zog verschmitzt jenes Spielzeugauto aus seiner Hosentasche. Dass ausgerechnet Julian eines Tages die Macht haben könnte, ihn vor dem Fegefeuer zu retten, hätte Steve niemals erwartet.
Nun ließ sich wieder die Stimme aus dem Hintergrund vernehmen, die allen und keinem gehörte.
»Jawohl, Stephen, wir haben dich wegen der großen Liebe deines Bruders zu dir hier aufgenommen. Schon kurz nachdem er hier angekommen war, wurde er zu deinem Fürsprecher. Doch anstatt dich unseres Vertrauens würdig zu erweisen und deine dir gestellten Aufgaben ohne Bitternis anzunehmen, sie mit Herz und Verstand zu meistern, hattest du mit Sarkasmus und Hochmut darauf reagiert. Hast Dinge preisgegeben, an die zu rühren dir selbst streng untersagt war. Wegen deines Leichtsinns war dir nicht bewusst, wie sehr deine Tat in den Lauf der Welt hätte eingreifen können, hätten wir nicht rechtzeitig interveniert. Nein, Stephen McLaman … du warst nicht reif für das Paradies!
Wenn ein Mensch stirbt, so nimmt er seine innere Einstellung, seinen Seelenfrieden – oder eben das glatte Gegenteil hiervon – mit herüber, so wie er in der Sekunde seines Todes beschaffen war. Du bist daher nicht in der Lage, die Schönheit und Reinheit dieses Ortes auch nur in Ansätzen zu erfassen, kümmerst dich lieber um unwichtige, profane Dinge. Suchst nach dem Haar in der Suppe. Von einigen kleineren Lernprozessen abgesehen, bist du eigentlich noch genauso strukturiert, wie du es dort unten als lebender Mensch warst. Du bist unreif, unzulänglich.«
Stephen starrte auf seine Schuhspitzen. Jetzt reichte es doch langsam. Hatte er denn die ganze Schuld der Welt auf sich geladen, oder was? Doch das betretene Gesicht seines Bruders verriet ihm, dass auch er ähnlich dachte. Ihm schob man jetzt wahrscheinlich sowieso die Verantwortung für sein Versagen zu. Gott, war das kompliziert hier oben! Eine irdische Behörde hätte sich noch eine Scheibe abschneiden können. Warum kam man nicht einfach auf den Punkt, sagte ihm, was eigentlich an Sanktionen gegen ihn geplant war und wie er selbst nun etwas an seiner Lage verbessern konnte?
»Auch die Ungeduld gehört zu deinen größten Schwächen, Stephen. Diese Eigenschaft verhindert, dass du in das Wesen der Dinge eindringst, sie genau kennenlernst, bevor du Entscheidungen triffst. Genau dieser Umstand hat zum Scheitern deiner Mission maßgeblich mit beigetragen. Taub und blind rennst du los, kennst keinen Respekt. Wie sollten wir dir das Leben von Menschen anvertrauen können?«
Der junge Mann begehrte auf. Er war niemals sonderlich kritikfähig gewesen und seine grasgrünen Augen blitzten vor unterdrückter Wut. Mühsam hielt er schärfere Formulierungen zurück, die der allwissende Zwölferrat jedoch mühelos aus seinen Gedanken lesen konnte. Warum sprach er überhaupt, wenn er für die anderen ohnehin aufgeschlagenes Buch darstellte?
Privatsphäre gab es hier keine, Ausrutscher-Toleranz gleich null. Stephen glaubte nun, sich in einem längeren Monolog ein wenig rehabilitieren zu müssen. Es konnte doch nicht sein, dass er ausschließlich aus Fehlern bestand!
»So, und was genau hattet ihr von mir erwartet? Ich komme hier an, kenne keinerlei Bedingungen oder was ihr hier oben sonst so an Kleingedrucktem habt, werde gleich zum ersten Einsatz geschickt. Weil ich nicht vollkommen bin. Na klar, denke ich, Wettrüsten verhindern. Wenn es sonst nichts ist!
Als nächstes sehe ich einen debil grinsenden Kerl auf der Wiese sitzen, der eifrig an einem Speer herumschnitzt. Was sollte ich nun daraus schließen? Dass ihr womöglich die falsche Epoche erwischt habt?
Aber gut, ich sitze also und beobachte. Bis mir auffällt, dass dieser fellbehangene Intelligenzbolzen den Speer viel schlanker und länger geschnitzt hat, als dies bei den Wurfgeräten im Nachbardorf der Fall war. Die Männer waren gerade beim Jagen, da konnte ich die Speere genau betrachten. Na ja, und dann hat der Kerl mit dem Flokati um die Schultern Löcher in den Speerschaft gebohrt, um große Federn hineinzustecken. Da bin ich dann schon neugierig geworden, ob der am Ende jetzt Pfeil und Bogen erfinden wird. Ich habe ganz schön abwarten müssen, bis er den neuen Speer endlich ausprobierte. Und was stelle ich fest? Das Ding fliegt viel weiter, lässt sich punktgenau steuern.
Da war mir dann schon klar, was das bedeutete. Die beiden Dörfer, die ich gesehen habe, waren sich nicht grün, daher hätte der Herr Erfinder seinen Speer wahrscheinlich irgendwann an einem Subjekt des Nachbardorfes ausprobiert. Das Nachbardorf hatte nämlich die bessere Lage, befand sich neben einer sauberen Quelle. Die bot frisches Trinkwasser und gleichzeitig eine Möglichkeit, dort trinkende Tiere zu jagen.
Somit musste ich verhindern, dass die Federspeere quasi in Serienproduktion gingen, die Freude über die neue Erfindung gleich im Keim ersticken. Sonst wäre die Folge gewesen, dass die anderen als Antwort auf den Angriff auch was erfinden und dass es dann Schule macht, die anderen bei den Waffen zu übertrumpfen und womöglich danach gleich das nächste Dorf zu überfallen. Schon klar!
Da hatte ich dann wieder ein Problem. Ihr hattet mir noch mit auf den Weg gegeben, ich dürfe niemals und unter keinen Umständen direkt mit einem Wesen auf der Erde in Kontakt treten, sodass es Notiz von meiner Existenz nähme. Also habe ich mich an Heldensagen erinnert, die ich in meiner Kindheit las. Wenn da eine Gottheit irgendetwas verhindern wollte, so hat sie Sturmfluten, Gewitter oder sonstige Naturkatastrophen geschickt.
Natürlich hat mir niemand gesagt, wie weit ich dabei gehen darf. Andererseits hätte ein lausiges Mini-Gewitterchen diesen Typen vermutlich von gar nichts abgehalten.
Stephen, habe ich mir gesagt, da musst du jetzt improvisieren. Ich habe abgewartet, bis dieser Steinzeit-Einstein den Speer in den Boden steckte, als er mal eine Duftmarke setzen musste. Genau in dem Moment, als er nach seiner Sitzung grunzend hinter den Büschen wieder auftauchte, habe ich eine einzelne, pechschwarze Wolke über seinem Speer platziert. Ansonsten herrschte strahlender Sonnenschein bei blauem Himmel. Na, und als er den Speer nehmen wollte, ließ ich einen pfeilgeraden Blitz mit lautem Getöse haargenau in den Speer einschlagen, so dass die Federn abfackelten.
Der hat vielleicht die Füße in die Hand genommen, ist wild gestikulierend in seinem Dorf verschwunden! Dort haben die Bewohner gleich mal eine Zeremonie mit Medizinmann und dem vollen Programm abgehalten, um die erzürnten Götter wieder zu besänftigen.
Nach dieser Aktion verhielt sich unser Freund, der Speererfinder, viel ruhiger. Er starrte meist nur noch die Höhlenwand an und dachte nicht im Traum daran, nochmals an einem Speer herum zu schnitzen. Gewissermaßen war er ein Fall für den Psycho-Medizinmann. Für mich galt: Auftrag erledigt! Und was, bitte, habe ich falsch gemacht?«
»Nicht viel, außer deine überhebliche Art soeben wieder zur Schau zu stellen«, lautete die Antwort. »Warum hast du noch immer nicht realisiert, dass irdische Gesprächstaktik in diesen Gefilden niemals funktioniert? Wir bekamen schließlich genau mit, dass du längst realisiert hast, dass dein zweiter Einsatz der Stein des Anstoßes gewesen ist.«
Dieser Vorwurf kam von Stephens Bruder. Schon als kleines Kind hatte dieser ihn gerne verpetzt, den Eltern in sämtlichen Farben des Regenbogens seine zahlreichen Schandtaten geschildert. Damit Julian hernach selbst als strahlender Unschuldsengel dastand. Scheinbar hatte sein Brüderchen diese Gewohnheit auch hier oben nicht ganz abgelegt; dieser Umstand versalzte Steve nun ein wenig die Wiedersehensfreude.
Die Stimme der Zwölf beendete diese Überlegungen.
»So bist du dir noch immer keiner Schuld bewusst. Nun, wir zeigen dir ein weiteres Mal, was du getan hast. Wie in einem Kinofilm, die du von der Erde kennst, wirst du dein Versagen vor Augen geführt bekommen; bitte erspare uns und dir selbst den Versuch, dich herausreden zu wollen.
Wenn wir alle noch einmal gesehen haben, welcher Art deine Verfehlungen waren, darfst du dich ein letztes Mal dazu äußern. Anschließend werden wir dir kundtun, was die Folge daraus ist. So werfe denn einen Blick auf deine Unvollkommenheit!«
Und Stephen realisierte: er würde gleich Lena wiedersehen. Seine Handflächen wurden feucht vor Aufregung.
Kapitel 2
Magische Verwicklungen
Lena saß am Strand und starrte in die Wellen. Ihr schönes, langes Haar war zerzaust, immer wieder wehte der starke Wind ihr eine Strähne über die Augen. Sie nahm es nicht als störend wahr. Neben ihr lag das lederne Handtäschchen im Sand, das ihre Eltern ihr letztes Weihnachten geschenkt hatten. Damals hatte sie sich noch über etwas freuen können, hatte mit ihren langen, schlanken Fingern über das weiche blaue Leder gestreichelt, das so herrlich zu ihren Jeans passte. Neben dem Täschchen hatte Lena eine Flasche Wodka deponiert, eine Billigmarke aus dem Discounter. Sie wollte nicht jetzt noch viel Geld ausgeben, das war die ganze Aktion nicht wert. Hauptsache, der Alkohol würde seine Wirkung tun, nur darauf kam es an.
Während der Himmel seine Farbe von einem depressiven Grau in ein bleiernes Schwarz änderte und vor diesem schaurigen Hintergrund die etwas helleren Wolkenfetzen in rasender Geschwindigkeit vorübertrieben, öffnete Lena im letzten Licht dieses traurigen Tages ihr Täschchen. Sie musste noch einmal kontrollieren, ob der Inhalt auch vollzählig vorhanden war. Ansonsten hätte sie ihre Vorbereitungen für den heutigen Abend umsonst getroffen.
Lange war sie vor diesem Schritt zurückgeschreckt, hatte fieberhaft nach Alternativen gesucht. Doch immer wieder war alles noch schlimmer gekommen, bis sie keinen Ausweg mehr sah. Sie war ja im Grunde selbst schuld, wenn die Gutmütigkeit ihr immer wieder zum Verhängnis wurde.
Jawohl, die Tablettenschachteln waren alle da drin. Sie würde nun noch für eine kurze Zeit hier still sitzen bleiben, ihr Leben Revue passieren lassen. Danach würde sie es tun.
Von der fernen Strandpromenade schimmerte die Beleuchtung der Strandbars herüber, tauchte die Szenerie in ein unwirkliches Licht. Der Mond ging auf, wurde immer wieder von zerfaserten Wolkenbänken verdeckt. Wann immer sein fahles Licht kurzzeitig silbern auf die Wellenkronen schien, erwartete man, dass Triton mit seinem Dreizack gleich auftauchen müsse, um einen unglücklichen Fischer zum Meeresgrund zu befördern. Lena hatte solche Geschichten von jeher geliebt, die von Sagen und Legenden erzählten. Mit der harten Realität hingegen konnte sie sich weitaus weniger anfreunden. Das stete Meeresrauschen machte Lena ruhiger, lullte sie ein. Konnte sie nicht einfach hier sitzen bleiben, bis sie von selbst tot umfiel? Wenn der Wind noch kälter bliese, würde sie ohnehin bald steifgefroren sein.
Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Stephen in die Szene eingeblendet; sein zweiter Auftrag, der ihm erneut ohne Erklärungen aufgedrückt worden war. Er sollte das Mädchen vor dem geplanten Selbstmord retten. Punkt, mehr Anweisungen gab es nicht. Nur eben, dass dieses bedauernswerte Geschöpf von seiner Anwesenheit keinerlei Notiz nehmen durfte. Was er allerdings als sehr schade empfand, denn ihm gefiel, was er dort unten sitzen sah. Wer oder was war sie? Eine gestrandete Meerjungfrau?
Lena war intelligent; an der fast schon poetischen Art, wie sie ihre ganz privaten Gedanken dachte, hatte Stephen dies mühelos erkannt. Dieses schöne Menschenkind war mit felsenfester Sicherheit davon überzeugt, dass es keine Daseinsberechtigung auf der Erde mehr besaß, keinen weiteren Tag würde überleben können.
Gerade in diesem Moment, als Steve sich verwundert fragte, wie die in ihrem Fall überhaupt möglich sein könne, zog, wie bei allen Todeskandidaten, Lenas Leben durch ihr Bewusstsein. Und Stephen war, ohne dass sie es wahrnehmen oder gar verhindern konnte, unmittelbar an diesem Schauspiel beteiligt.
*
Stephen sah eine große rothaarige Frau im Krankenbett. Dies war eindeutig die Säuglingsstation eines Krankenhauses, denn rundum ertönte das kräftige Geschrei von neugeborenen Kindern.
Die frischgebackene Mutter sah nicht glücklich aus, und erst jetzt bemerkte er, dass ein winziges Kindchen neben ihr im Bett lag. Sie betrachtete es voller Abscheu, als wäre es ihr lästig. Dabei handelte es sich um ein ruhiges, völlig entspanntes Kind mit ebenmäßigen Gesichtszügen, das selig schlief. Ab und an stahl sich ein Lächeln über das blasse Babygesicht, was neben den Mundwinkeln süße Grübchen entstehen ließ. Am allerliebsten hätte Steve dem Kind über die feinen, blonden Flaumhärchen gestreichelt, die den kleinen Kopf krönten. Er sah sich die junge Frau von vielleicht Anfang Zwanzig, die dort unten traurig am Strand saß, genauer an. Sie musste es sein! Die beiden Personen, die er in Lenas Gedanken erblickte, das waren ihre Mutter und sie selbst, und zwar kurze Zeit nach ihrer Geburt.
Eine stolze, herrisch und arrogant dreinblickende ältere Frau betrat das Krankenzimmer. Sie wies unverkennbar Ähnlichkeit mit Lenas Mutter auf.
»So ist das Balg also auf der Welt. Nichts als Scherereien wirst du mit diesem Kind haben, das sage ich dir gleich!«
Mit spitzen Fingern schob die Ältere die Decke etwas beiseite, um einen Blick auf den neugeborenen Säugling werfen zu können. Baby Lena hatte jetzt die Augen aufgeschlagen, strampelte unruhig. Vermutlich verspürte das Kind Hunger, denn es begann zu wimmern. Ihre Mutter beachtete es nicht.
»Er wird sich schon dazu bekennen, wird mich nicht alleine mit ihr sitzen lassen«, bemerkte sie leise.
»Das glaubst du doch selbst nicht! Ein Mann in seiner Position, noch dazu verheiratet ... so einer wird nicht gerade wild darauf sein, sich dieses Balg und dazu noch dich aufzuladen. Was musstest du dich auch ausgerechnet mit deinem Chef einlassen? Und dann ist es zu allem Überfluss ein Mädchen geworden! Musstest du mir das antun?« Kopfschüttelnd ging Lenas Großmutter im Zimmer auf und ab.
Warum konnte sich Lena überhaupt an solch frühe Ereignisse erinnern? Brannte sich so etwas Belastendes etwa bei jedem Menschen ins Unterbewusstsein ein, so dass er sich in Extremsituationen daran erinnern konnte? Oder war Lena tatsächlich so besonders, wie sie aussah?
Mittlerweile war Lena bei ihrer Kindergartenzeit angelangt. Steve sah ein kleines, zerbrechliches Wesen mit rotblondem Haar und leuchtend blauen Augen. Sie hatte ein Schürzenkleidchen an, das mit blauen Veilchen bestickt war. Nachdenklich kaute Lena auf einem Keks, verdrückte ein Tränchen im Augenwinkel. Die Kindergartentante kam vorbei.
»Na, Lenchen? Spiel doch noch ein bisschen mit dem Puppenhaus, ja? Guck, ich mach noch schnell den Abwasch fertig, dann komme ich wieder her zu dir. Dann können wir ein Memory zusammen spielen, wenn du magst.«
»Meike, wann kommt denn endlich meine Mama? Hat sie mich vergessen?« Steve fiel jetzt erst auf, dass außer Lena kein einziges Kind mehr im Kindergarten wartete. Die Stühle waren schon auf die Tische gestellt worden, die Spielsachen lagen ordentlich aufgeräumt in den Regalen.
»Ach was, mein kleiner Schatz! Du weißt doch, deine Mama muss ganz viel arbeiten. Bestimmt konnte sie nicht früher weg. Die will doch bestimmt auch nur ganz schnell dort heraus und hierher zu dir. Hab noch ein wenig Geduld.«
Lena seufzte, setzte sich traurig in die Kuschelecke und nahm das Häschen mit den lustigen langen Schlenker-Ohren an sich. Warum mussten eigentlich die Mamas der anderen Kinder nie so lange arbeiten wie ihre eigene? Und die anderen Kinder hatten es überhaupt viel besser, die besaßen nämlich auch einen lieben Papa, der sie abholen konnte, wenn Mama verhindert war. Sie hatte aber keinen Papa, nie einen gehabt. Wann immer sie manchmal Mama gefragt hatte, warum das so sei, wechselte Mama ganz schnell das Thema. »Ach, der ist schon lange fort. Denk nicht darüber nach, mein Kind!«
Die Ohren des Plüschhäschens hingen nach vorne, so dass es bestimmt nichts mehr sehen konnte. Dann warf es die Ohren mit Schwung zurück, so dass sie nun aussahen, als hätte der Hase lange Haare. Normalerweise musste Lena lachen, wenn sie ihm dann die Ohren hinten mit einer Schleife zusammenband. Aber heute konnte sie nicht einmal ihr Lieblingstierchen aufheitern.
Meike spielte mit Lena noch zweimal Memory, draußen wurde es bereits dunkel. Lena war nicht mehr recht bei der Sache, sie war schon müde. Auch die Kindergartentante wurde jetzt allmählich unruhig, auch sie musste eigentlich längst nach Hause zu ihren eigenen Kindern, die auf das Abendessen warteten. Doch Lena wurde einfach nicht abgeholt, und ihre Mutter ging im Büro nicht ans Telefon. Über das Handy war sie auch nicht zu erreichen.
Was war das nur für eine Mutter, die den Beruf derart egozentrisch über ihr Kind stellte? Es war freilich schon öfters vorgekommen, dass Lenas Mutter hektisch viel zu spät in den Kindergarten gehastet kam und irgendeine Ausrede parat hatte, warum sie nicht aus dem Büro weggehen habe können. Ein Meeting, eine dringend fertigzustellende Aufgabe oder eine kurze Geschäftsreise: Das waren die gängigsten Begründungen. Nur war es noch niemals zuvor derart spät geworden. Meike unternahm kopfschüttelnd einen weiteren Versuch auf sämtlichen ihr bekannten Telefonnummern, um Mirjam Krahler zu erreichen. Nichts.
Die Kindergärtnerin hegte schon seit längerer Zeit den Verdacht, dass Lenas Mutter in Wirklichkeit gar nicht direkt von der Arbeit kam, wenn sie mit Verspätung im Kindergarten eintraf. Sie war zwar immer top gestylt und teuer gekleidet, wirkte aber irgendwie ... zerrupft. Das hochgesteckte rote Haar hing an manchen Stellen in losen Strähnen herunter, manchmal war die Kostümjacke zerknittert. Und dann dieser penetrante Parfümduft und die stark geschminkten Augen, bei denen oft schon die Mascara verlaufen war. Meike fragte sich, was das alles bedeuten sollte. Das kleine Mädchen tat ihr leid, man musste Lena doch einfach liebhaben!
Wie Lena da so müde und verstört in der Kuschelecke saß, wirkte sie wie eine vergessene Puppe, die keiner mehr haben wollte. Meike traf eine Entscheidung, auch wenn das in den Statuten des Kindergartens absolut nicht vorgesehen war. Sie würde Lena mit zu sich nach Hause nehmen, eine Nachricht an der Türe des Kindergartens hinterlassen, bei welcher Adresse das Kind abgeholt werden konnte.
»Lena? Komm, zieh doch mal deine hübschen Schuhe an. Du darfst mit zu mir nach Hause, deine Mama braucht anscheinend länger heute. Da bekommst du dann einen schönen Teller Spaghetti, kannst mit meinen beiden Kindern spielen und schwupps – schon ist deine Mama da und wird dich abholen. Ja, machen wir das so?«
»Na gut«, meinte Lena, sah aber nicht glücklich aus. Sie mochte Meike, aber sie wollte lieber heim. Im Kindergarten war Meike eine vertraute Person, aber bei sich zu Hause war sie ihr ein wenig fremd.
Nach dem Essen spielten Meikes Kinder ein Spiel nach dem anderen mit ihr, um sie abzulenken, bis sich Lena schließlich müde auf der Couch zusammenrollte und einfach einschlief. Sie hatte leise geweint und ihr Näschen in den Hasen gedrückt, denn ihre Mama war doch nicht gekommen, hatte auch nicht angerufen.
*
Meike Keller saß mit ihrem Mann in der Küche. Die beiden sinnierten über die möglichen Gründe, warum die kleine Lena nicht abgeholt worden war. Vielleicht hatte der Wind den Zettel an der Kindergartentüre fortgeweht, noch bevor Lenas Mutter dort eintraf?
Genau, das musste es sein! Schon zog Piet Jacke und Schuhe an, um nachzusehen. Denn Lenas Mutter kannte ja nicht Meikes private Telefonnummer, hätte daher gar nicht anrufen können, falls der Zettel fehlte. In diesem Fall würde Piet dann schnell zu Lenas Adresse fahren und nachsehen, ob ihre Mutter inzwischen zu Hause wäre. Es war mittlerweile schon kurz vor 22 Uhr.
Meike ging indessen hinüber zur Couch, deckte ihren kleinen Schützling zu. »Mama«, murmelte Lena im Schlaf.
»Ja« flüsterte Meike. Wie gerne hätte sie selbst noch so ein kleines, putziges Ding gehabt, doch sie durfte kein Kind mehr bekommen. Die Ärzte hatten ihr dringend davon abgeraten, nachdem sie bei Majas Geburt fast gestorben wäre. Maja war jetzt 9, ihr Bruder Mark 11 Jahre alt. ›Na ja, es sollte eben nicht sein‹, dachte Meike und seufzte tief. ›Ich habe ja ganz viele kleine Kinder, drüben im Kindergarten, auch wenn meine eigenen nun schon bald groß sind‹.
Nach einer Weile drehte sich an der Haustüre der Schlüssel im Schloss. Meike kannte ihren Mann; wenn er die Türe derart hektisch aufschloss, dann war etwas nicht in Ordnung. Atemlos hastete er die Treppe herauf.
»Meike, der Zettel ist noch da! Und bei Lena kein Mensch zu Hause. Was machen wir nun?«
Spätestens jetzt war die Kindergärtnerin ernstlich beunruhigt. »Heute können wir ohnehin nichts mehr tun, lassen wir das Kind schlafen. Morgen früh nehme ich sie dann wieder mit in den Kindergarten und versuche, irgendjemanden in der Firma zu erreichen, in der ihre Mutter arbeitet, falls sie selbst immer noch nicht ans Telefon gehen sollte. Dann sehen wir weiter.«
So kam es, dass die kleine Lena am nächsten Morgen erwachte und gleichermaßen erstaunt wie betrübt feststellte, dass ihre Mama immer noch nicht da war.
»Mama kommt nie wieder, ich weiß schon Bescheid« sagte sie mit einem bitteren Ernst in der Stimme, der Meike fast das Blut gefrieren ließ.
»Aber Lenchen, wie kannst du so etwas denken? Wir werden schon herausfinden, was da los ist. Und bis dahin spielst du schön mit deinen Freunden. Heute hat Robin Geburtstag, da gibt es Kuchen. Den backen wir nachher gemeinsam, und du darfst zum Schluss sogar den Zuckerguss und die PiratenKanonenkugeln aus Schokolade drauf tun, ja?«
Doch Lena wiederholte traurig: »Die kommt nicht mehr« und drehte sich um.
Die große, erwachsene Lena dort unten am Strand zog die Beine an, verbarg den Kopf zwischen den Knien. Kein Wunder, dass ihr diese Erinnerung zusetzte! Stephen fragte sich, wie diese Geschichte wohl weitergegangen sein mochte. Das arme Ding.
Bei der nächsten Sequenz, die Stephen mitverfolgte, war Lena bereits in der Schule, wohl ungefähr in der zweiten oder dritten Klasse. Sie wirkte ein wenig verloren zwischen den anderen Kindern, die allesamt erheblich größer und kräftiger wirkten. Wie eine kleine Fee sah sie aus, hatte alabasterweiße Haut und langes, rotblondes Haar. Wenn man sie von hinten betrachtete, sah man nur die Kaskaden ihrer Haarpracht und darunter ein paar dünne Beinchen. Fast wirkte es, als würde sie schweben.
Dagegen sahen die anderen Mädchen wie plumpe Trampel aus. Steve fiel auf, dass Lena sich meistens absonderte. Wenn die anderen auf dem Schulhof ihren wilden Spielen, ihren Raufereien oder dem Kästchenhüpfen frönten, saß Lena meist auf der Wiese und betrachtete versonnen einen Schmetterling, strich über die Blütenblätter eines Gänseblümchens oder sah sich ein Buch an. Man suchte unwillkürlich auf ihrem Rücken nach zarten Flügeln.
Für ihre Mitschüler war Lena ein Sonderling, für ihre Lehrer jedoch eine Wohltat. So erwähnten sie ihr Verhalten immer wieder lobend vor der Klasse und Stephen ahnte bereits, wohin das führen konnte. Hatte er nicht selbst in diesem Alter einen schwächeren, seltsam wirkenden Jungen immer wieder gehänselt und diesem auch ab und zu eine übergebraten? Beschämt musste er sich dies eingestehen.
Als die Schüler mittags laut lärmend aus der Schule stürmten, dauerte es zunächst ein Weilchen; dann erst erschien, mit verträumtem Gesichtsausdruck, Lena, die ihre Schultasche noch sorgfältig gepackt und sich im Flur vor dem Klassenzimmer das Schaubild über die Funktionsweise des Waldes verinnerlicht hatte.
»Mama«, rief sie fröhlich winkend, und ihr Gesicht zeigte wieder jene bezaubernden Grübchen, die so kennzeichnend für dieses Mädchen waren. Stephen registrierte erstaunt, dass die mit ›Mama‹ angesprochene Frau gar nicht die große, überschminkte Rothaarige war, sondern auf dem Parkplatz stand mit weit geöffneten Armen ... Meike.
Im nächsten Moment schien in Lenas Gedanken der Winter ausgebrochen zu sein. Lena stand nun, dick vermummt in Mäntelchen und Fellstiefeln, auf dem Pausenhof, wieder abseits der anderen. Stephen sah, wie ein Grüppchen aus Mädchen die Köpfe zusammensteckte und tuschelte. Immer wieder sah eine in die Richtung Lenas, welche soeben Schneeflocken in ihrer Hand auffing und fasziniert beobachtete, wie die kleinen Kristalle langsam zu Wassertropfen schmolzen. Bei solchen Tätigkeiten war Lena stets derart in sich gekehrt, dass sie überhaupt nicht mehr wahrnahm, was um sie herum geschah.
Voller Abscheu musste Stephen mit ansehen, wie sich die Mädchengruppe, offensichtlich angeführt von einer reichlich asozial wirkenden Brünetten, langsam immer weiter in Lenas Nähe schob. Lena registrierte das nicht einmal zu dem Zeitpunkt, als die Rädelsführerin längst in Reichweite stand.
Dann schlug das Quartett los. Zwei der Mädchen packten Lena brutal an den Oberarmen, schleppten sie hinter ein Gebüsch, das den Schulhof begrenzte. Eine hielt ihr den Mund zu, damit sie nicht schreien konnte; doch Lena war ohnehin viel zu erschrocken, um sofort auf den Angriff zu reagieren. Die letzte schließlich lenkte die Aufsicht habende Lehrerin ab, indem sie ihr eine Frage aus dem Unterricht stellte.
Hinter dem dichten, immergrünen Gebüsch hatte man Lena nun in den Schnee gelegt; eines der Mädchen saß auf ihrem Brustkorb, während die anderen Hände und Füße fixierten. Lena sah drein wie ein verschrecktes Reh, wehrte sich nicht einmal. Gewalttätigkeiten vermochte sie nicht einzuordnen, konnte nicht darauf reagieren. Sie war wie paralysiert.
»Na, Tussi?« Mit Häme in der Stimme fing die Wortführerin an, Lena zu beleidigen. Lena wehrte sich immer noch nicht, sie sah ihre Peinigerin nur fragend an und hatte Mühe, Luft zu bekommen. Das Mädchen wog sehr schwer auf ihrer Brust, tiefe Atemzüge waren nicht möglich.
»Wir zeigen dir jetzt mal, was wir mit solchen Einschleimerinnen wie dir machen. Merk dir das besser für die Zukunft. Nie wieder wirst du sicher vor uns sein. Niemals wirst du wissen, hinter welcher Ecke wir dir auflauern.« Das Gesicht des Mädchens verzog sich zur diabolischen Fratze.
»Los, gebt es ihr!« Alle drei Mädchen begannen nun, Lena den Schnee vorne und hinten in die Kleidung zu stopfen. Sie rieben ihr das Gesicht damit ab, stopften ihr gar Schneebälle in den Mund, die Lena keuchen und spucken ließen. Lena glaubte, die Mädchen wollten sie umbringen.
»So hört doch endlich auf! Was habe ich euch denn getan?« Lena würgte die Worte mit zittriger Stimme hervor, panische Angst sprach aus ihren Augen.
»Was sie uns getan hat ...! Habt ihr gehört? SIE denkt, sie könne uns was anhaben. Hör zu, du Tussi! Du passt nicht zu uns. Du bist öde, langweilig, eine verdammte Streberin. Mit dir stimmt irgendwas nicht. Und deswegen biste dran!« Die Brünette kostete ihre Macht sichtlich aus, während die anderen Mädchen eifrig nickten. »Genau!«
Von diesem Moment an wurden Überfälle dieser Art zur Gewohnheit. Lenas Schulleistungen fielen rapide ab, sie wurde schreckhaft und ängstlich. Wenn Meike sie fragte, was denn mit ihr los sei, brach sie einfach nur in Tränen aus und klammerte sich an sie wie eine Ertrinkende. Meike hielt Lenas psychische Probleme für Nachwirkungen aus der Sache mit ihrer leiblichen Mutter, daher pflegte sie das Mädchen in solchen Momenten einfach nur an sich zu drücken und zu warten, bis sie sich ausgeheult hatte. Denn sprechen wollte Lena über ihre Seelenqual nicht. Erst als Lena eines Tages mit halb abgeschnittenen Haaren nach Hause kam und aussah wie eine misshandelte Puppe, bekam Meike eine Ahnung davon, dass die Probleme wohl in der Schule liegen mussten.
Stephen war entsetzt. Weder hatte die Lehrerin etwas gemerkt, noch hatten vorbeikommende Passanten in die Szene eingegriffen. Ersatzmama Meike war hingegen kein Vorwurf zu machen, denn die hatte, als ihr ein Licht aufgegangen war, in der Schule gründlich aufgeräumt. Aber die Narben, die diese entwürdigenden Vorgänge auf Lenas Seele hinterlassen hatten, waren unübersehbar. Lena wirkte nun übernervös und misstrauisch, ging nicht mehr mit ihrem natürlichen Vertrauen in die Welt hinaus, das sie zuvor so liebreizend gemacht hatte. Am liebsten hätte Steve nun alle Verbote missachtet, wäre auf die Erde hinunter gegangen (oder geflogen, keine Ahnung) und hätte Lena in den Arm genommen. Doch wie er die Herrschaften dort oben mittlerweile kannte, würde er da unten am Strand vermutlich auf der Stelle einen inszenierten Herzkasper bekommen und dann ohne Umwege noch weiter unten im roten Kellergeschoß enden, als Überraschungsgast auf des Teufels Grillparty. Nun, das wollte er natürlich auch wieder nicht riskieren. Er würde Lenas Gedanken somit tatenlos ertragen müssen.
Indessen beschwor Lena ihre erste Romanze herauf, und Stephen musste sich bereits beherrschen, nicht eifersüchtig zu reagieren und dem unsensiblen Arsch, der Lena soeben vollkommen niveaulos anbaggerte, eine zu ballern. Lena, inzwischen vielleicht 16 Jahre alt, befand sich an ihrem liebsten Platz auf der Welt: in der städtischen Bibliothek. Soeben hatte sie sich ein Buch ausgesucht, auf dessen Inhalt sie sich schon unbändig freute. Eine fantastische Geschichte, voll nach ihrem Geschmack, mit fernen, exotischen Welten, fremdartigen Wesen und einem Helden, der stets alles wieder in Ordnung brachte.
Verträumt stand Lena vor dem Regal, das Buch umarmend wie einen Schatz. Vor ihrem geistigen Auge konnte sie bereits die tropische Landschaft sehen, in welcher die Geschichte spielte; und das, obwohl sie nicht mehr als den Klappentext gelesen hatte. Dieses Mädchen verfügte über eine sehr ausgeprägte Vorstellungskraft, soviel war sicher.
Abgesehen von ihren geliebten Büchern bot die Bibliothek ihr Schutz, wirkte wie ein Resort. Lena kannte und liebte das Geräusch des knarrenden Parkettbodens, den Geruch des alten Papiers und der immer leicht stickigen Luft in der Leseecke. Die renitenten Exemplare ihrer ›Schulkameraden‹ ließen sich hier nie sehen. Die trieben sich lieber alkoholisiert am Brunnen in der Innenstadt herum, saßen vor dem Computer oder frönten dem Konsumrausch. Es war still hier, und Lena konnte von jeher mit lauten Geräuschen, Zwist oder Ungerechtigkeit absolut nichts anfangen; noch immer befiel sie eine Art hilfloser Starre, wenn sie unfreiwillig solchen Gegebenheiten ausgesetzt war.
Hier war sie in Sicherheit. Bis zu jenem Tag.
Mit langsamen, gemessenen Bewegungen setzte sich Lena auf den Holzstuhl, um nicht allzu viele Geräusche zu machen. Schließlich wollten auch die anderen Besucher in Ruhe lesen. Bändigte ihr Haar mit einer Spange, denn sonst hätte es einen dichten Vorhang vor ihrem hübschen Gesicht gebildet, welcher den Lesegenuss komplett vereitelt hätte.
Dann konnte es losgehen – Lena öffnete lächelnd das Buch und machte sich bereit, ganz in dieser interessanten Geschichte zu versinken. Manchmal hatte sie die ältere Bibliothekarin am Abend schon behutsam auffordern müssen, nach Hause zu gehen, wenn die Bücherei schließen wollte. Denn Lena vergaß über ihrer Lektüre allzu gerne Raum und Zeit.
PATSCH! Lena fuhr zusammen und erschrak fürchterlich. Neben ihrem aufgeschlagenen Buch war ein ganzer Stapel von anderen Büchern unsanft gelandet, jemand hatte sie achtlos dorthin geworfen. Empört sah Lena auf. Da stand ein unverschämt grinsender Junge, den sie noch nie zuvor gesehen hatte. Jedenfalls nicht bewusst.
»Na, aufgewacht, Lady?« Der Störenfried setzte sich ungefragt einfach zu Lena an den Lesetisch, verteilte seine mitgebrachten Bücher und streckte die Beine von sich. Doch anstatt wenigstens jetzt Ruhe zu geben und seine Nase ebenfalls in die Bücher zu stecken, gab er ständig eine nervige Geräuschkulisse ab. Er öffnete eine Cola-Dose, schnäuzte sich lautstark und packte auch noch Kräcker aus. Lena überlegte schon, ob sie den Tisch wechseln sollte.