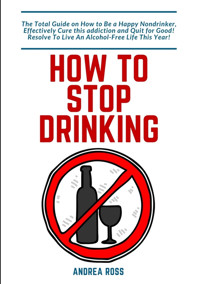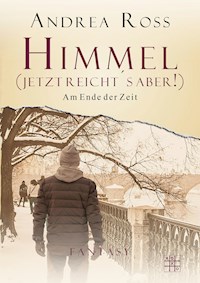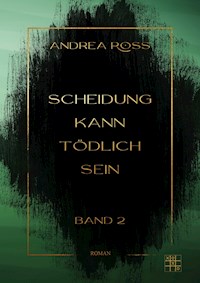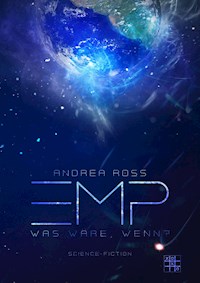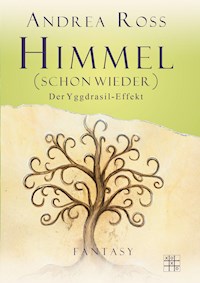
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Endzeit-Saga
- Sprache: Deutsch
Stephen hat keine Ahnung, was geschehen ist. Erst neulich hatte der Himmel ihn zum Erzengel auserkoren, nachdem er beim Sturz von einer Felswand in Prag das Zeitliche segnete. Dann jedoch war er nach einer Party in Spanien aufgewacht. Man hatte ihm erklärt, dass er wohl einen Joint zu viel geraucht haben müsse, um einen solch ausgefeilten Horrortrip zu erleben. Der junge Mann versucht, sein Leben einfach ganz normal weiterzuleben und diesen Albtraum zu vergessen. Leider ist das unmöglich, denn verschiedene Gegebenheiten aus dem anderen, scheinbar fantasierten Leben greifen in die heutige Realität herüber. Stephen ist sich nicht mehr sicher - wie hängen Realität und Traum zusammen? Im zweiten Teil der Geschichte überschlagen sich wieder die Ereignisse. Dieses Mal laufen viele Begebenheiten ganz anders ab, Stephen lebt sein Leben noch einmal. Aber lässt sich diesmal der prophezeite Weltuntergang vermeiden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrea Ross
Himmel (schon wieder!)
Der Yggdrasil-Effekt
Teil 2 der Endzeit-Saga
XOXO Verlag
Impressum
»Alles fließt. Alles ist in Bewegung, und nichts währt ewig. Deshalb können wir nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Denn wenn ich zum zweiten Mal in den Fluss steige, haben sowohl ich als auch der Fluss uns verändert.«
Heraklit
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche
Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-031-6
E-Book-ISBN: 978-3-96752-531-1
Copyright (2019) XOXO Verlag Umschlaggestaltung:
© Ulrich Guse, Art fine grafic design, Orihuela (Costa)
© Collage von Ulrich Guse, unter Verwendung eines Lizenzbildes von: dreamstime.de
Buchsatz: Alfons Th. Seeboth
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149
28237 Bremen
Kapitel 1
Traum oder Wirklichkeit?
Stephen saß im Spätherbst am Strand der Costa Blanca, obwohl der Himmel bedeckt war und ihm ein unangenehm kühler Wind um die Nase blies. Es war ihm einerlei, denn er musste dringend nachdenken. Reglos ließ der junge Mann die Ereignisse der gestrigen Nacht vor seinem geistigen Auge vorüberziehen, versuchte, sie zu verstehen und einzuordnen. Im ersten Augenblick seines Erwachens hatte er nur allzu gerne daran glauben mögen, dass er einem Horrortrip aufgesessen war; ausgelöst durch einen Joint, der wohl eine ihm unbekannte Höllenmischung enthalten haben musste. Doch wenn seine nächtlichen Erlebnisse nur Einbildung gewesen wären, wie ließen sich dann die Unstimmigkeiten erklären, die er in den wenigen Minuten, die seither vergangen waren, festgestellt hatte? Er war erst am späten Nachmittag erwacht, Lenas Spott ausgesetzt gewesen und zerstreut losgefahren. Stephens Kopf schmerzte fürchterlich und in diesem Zustand taten selbst die Gedanken körperlich weh. Jedenfalls fühlte sich das für ihn so an.
»Nochmal überlegen. Also. Ich bin aus Deutschland ausgewandert, um hier ein neues Leben anzufangen. Gestern Abend habe ich mich mit Gewalt in meine enge Motorradhose gequetscht, um zu einer Party zu fahren. Und heute Nachmittag bin ich dort mit einem dicken Schädel aufgewacht. Man hat mir erklärt, ich sei in einer Art Delirium gewesen, hätte mit einer hübschen Rothaarigen geschlafen und einen Job an Land gezogen. Soweit klingt das alles noch ganz normal. Jedenfalls für meine Verhältnisse.« Seine Gedanken ordnete man am besten, wenn man alles halblaut vor sich hinmurmelte, diese Feststellung hatte Steve schon vor Jahren gemacht. Hier hörte das zum Glück niemand, denn die anderen Menschen waren anscheinend nicht blöd genug, sich bei diesem ungemütlichen Wetter nach draußen zu begeben.
Jetzt kam doch jemand vorbei. Ein älterer Mann, der vermutlich wegen der unaufschiebbaren Notdurft seines mitgeführten Hundes hierzu verdonnert worden war. In Spanisch redete er auf das Tier ein, und Stephen konnte seltsamerweise jedes Wort verstehen. Noch gestern hatte es ihm äußerste Mühe abverlangt, selbst einfachste Konversation in dieser fremden Sprache zu verstehen. Und nun? Nicht einmal die Umgangssprache verursachte ihm nennenswerte Probleme.
DIESER Umstand sprach nun wieder dafür, dass die Ereignisse, welche so eindrucksvoll in seiner Erinnerung hafteten, doch nicht vollständig halluziniert sein konnten. Genau wie dieser ominöse Lastwagen, der ihn beim Verlassen des Grundstücks fast ins Jenseits befördert hätte. Er kannte dieses Fahrzeug; er wusste sogar, wie es scherzhaft bezeichnet wurde – El Burro, der störrische Esel. Es gehörte einer gewissen Pilar, einer älteren Dame aus der Nähe der Stadt Elche und … nein, das alles konnte nicht wahr sein. Oder doch?
In der hereinbrechenden Abenddämmerung kam Stephen endlich der erlösende Geistesblitz. Moment, warum war ihm das nicht früher eingefallen? Wenn er schon so viele Orte und Begebenheiten aus dem Drogen-Horrortrip kannte, warum fuhr er dann nicht einfach auf dem Weg nach Guardamar an einigen Schauplätzen vorbei und überprüfte sie? Da würde sich dann hoffentlich schnell herausstellen, dass er sich etwas zusammengesponnen hatte. Anschließend konnte er beruhigt nach Hause fahren und das Hotel anrufen, den Inhabern in Aussicht stellen, dass er morgen früh zuverlässig zum Vertragsabschluss erscheinen werde. Die hatten heute schon vergeblich auf ihren neuen SuperProgrammierer gewartet.
Allerdings war sich Stephen nicht ganz sicher, ob die Hotelmanager nur aufgrund seiner gestrigen Ausführungen überzeugt waren, den Richtigen zu engagieren, oder ob dies vielmehr auf den Anruf seines Vaters zurückzuführen war, welcher ein Software-Imperium in Deutschland besaß und in der Branche weithin bekannt war. Bewusst war er sich hingegen, dass seines Vaters Fürsprache nicht aus Liebe zu ihm geschehen war, sondern vermutlich sicherstellen sollte, dass er nur ja nicht nach Deutschland zurückkäme. Die beiden hatten sich vor Stephens Abreise nach Spanien ziemlich heftig in den Haaren gehabt, sehr zum Leidwesen von Stephens Mutter Kirstie.
Stephen rappelte sich auf, eine Idee zu schnell für seinen desolaten Zustand. Nicht nur dass sein Kopf nun fast zu platzen drohte, ihm wurde auch schwarz vor Augen. Egal. Er würde eben später der Sportart »Extrem-Couching« frönen, wie er faule Fernsehabende gerne bezeichnete; oft hatte er für diesen Ausdruck in geselligen Runden Gelächter geerntet, denn Stephen gab gerne den Scherzkeks, sofern er sich nicht gerade in unerfreulichen Grübeleien erging.
Momentan war ihm nicht nach seichten Späßchen zumute. Soeben hatte er anhand eines charakteristischen Schwapp-Geräusches festgestellt, dass das Motorrad aufgetankt werden musste. Na schön! Das wäre dann gleich eine passende Gelegenheit, die Existenz einer gewissen Tankstelle zu überprüfen. Jener Tankstelle, die nicht weit vom Grundstück Pilars entfernt lag. Der Tanke mit dem Besitzer Fernando, die ihm einige Ersatzteile für »El Burro« geliefert hatte. Sehr gut! Vielleicht musste er dann gar nicht mehr weiter nachsehen, wenn schon dieser Ort nur im Traum existent gewesen wäre. Schon von weitem sprang ihm das Flachdach der Tankstelle ins Auge. »Was zum Teufel …!« Es klang dumpf unter dem Helm und Stephen brach der kalte Schweiß aus. Besonders als er Fernando gewahrte, den es somit ebenfalls in Wirklichkeit gab. Der sang unbekümmert in seiner Werkstatt vor sich hin, während er einem Fahrzeug Öl nachfüllte, welches hier zu Lande, wie Stephen neuerdings wusste, »aceite« hieß. Nachdem er geistesabwesend die Tankrechnung beglichen hatte, fuhr er sich nervös durch die blonde Strubbel-Frisur, setzte den Helm wieder auf und fuhr, wie von Teufeln gehetzt, vom Gelände.
»Wenn der Rest dieses Albtraums auch noch in Wirklichkeit
existent ist, dann müsste … jaaaaaaa, JETZT Pilars Grundstück sichtbar sein!«
Schon wieder sprach Stephen mit sich selbst, um sich abzuregen. Das klang erneut recht seltsam unter dem Helm und seine vor Aufregung beschleunigte Atmung hinterließ einen feuchten Film auf dem Visier. Doch die Beruhigung seiner Nerven wollte ihm nach Lage der Dinge nicht gelingen. Was er insgeheim befürchtet, jedoch eigentlich instinktiv schon geahnt hatte, das war nun auch unverrückbar in seinem Verstand etabliert. Seine erstaunten Augen vermeldeten nämlich, dass Pilars Haus genauso vorhanden war wie ihre Zitronenplantage.
Doch EIN Detail erschien ihm trotzdem seltsam. Als er das Grundstück während seines »Horrortrips« zum ersten Mal gesehen hatte, war es in einem verlotterten Zustand gewesen. Aus Dankbarkeit für seine Rettung und Pflege nach dem Motorradunfall hatte Stephen es für Pilar hergerichtet, und in exakt diesem Zustand befand es sich jetzt. Wie konnte das möglich sein? Wenn er den Unfall doch gar nicht erlitten hatte, dann hätte Pilar ihn nicht gepflegt, ihn nicht einmal gekannt. In diesem Fall aber hätte er dort natürlich auch gar nichts reparieren können … Über solch abstrusen Gedanken konnte man wahrlich verrückt werden. Ja klar – Stephen erinnerte sich. Hier drüben befand sich der Bewässerungsgraben, aus welchem man ihn nach dem Unfall geborgen hatte. Dort, neben der Werkstatt, standen große Körbe, die zur Zitronenernte verwendet wurden, genau wie in seiner Erinnerung. Mit dem einzigen Unterschied, dass einer davon eben NICHT die Trümmer seiner zerstörten Harley enthielt, welche Pilar in seiner Erinnerung penibel aufgeklaubt hatte.
Er musste hier weg, bekam es mit einer unheimlichen Angst zu tun. Wollte nur noch nach Hause, sich hinlegen und am nächsten Morgen wieder einen klaren Kopf bekommen, über sich selber lachen, über seine vielfältigen Einbildungen.
Er wurde einfach den Gedanken nicht los, dass das Mädchen Lena, welches er von der Party kannte, irgendwie den Schlüssel zur Lösung dieses Rätsels bereithielt. Doch weshalb, das wusste er nicht zu sagen. In seiner Erinnerung war sie ein liebenswertes, zartes Geschöpf gewesen, schließlich, nach turbulenten Erlebnissen eines Tages, seine Frau geworden.
Warum war die Lena von heute so komplett anders? Wie eine verwöhnte Zicke hatte sie auf ihn gewirkt, lasterhaft und egoistisch. Auf der Party gestern hatte sie sich ihm förmlich an den Hals geworfen, niemals hätte er dergleichen bei seiner sanften Traum-Lena erlebt.
So schön es sich anfühlte, dass die Harley doch nicht an einem Möbellaster zerschellt war – in Bezug auf Lena hätte er etwas darum gegeben, wenn DIES hier der Traum gewesen wäre und im Gegenzug der »Horrortrip« die Wirklichkeit. Wenn man vom Ende dieser Geschichte einmal absah, welche weiß Gott nicht witzig ausgegangen war. Stephen McLaman als Lehr-Erzengel, Himmel noch mal!
Vor dem Einschlafen versuchte sich eben dieser verwirrte Stephen McLaman nun krampfhaft einzureden, dass er Pilars Haus und die Tankstelle einfach nur irgendwann beim Vorbeifahren gesehen haben musste, aus dem Augenwinkel registriert. Der Rest war demnach bestimmt Einbildung.
Was Lena betraf, so hatte er sich für dieses Mädchen, das in einem dermaßen attraktiven Körper steckte, wahrscheinlich einfach einen anderen Charakter herbeigewünscht, war gestern mit solchen Gedanken in den Drogenrausch hinübergedämmert. Sein zugedröhntes Gehirn musste dann wüst herumphantasiert haben. Nur so ließ sich das alles mit Hängen und Würgen erklären.
In der nächsten Zeit würde er sich penibel von allen Joints dieser Welt fern halten, garantiert.
* * *
Die schwarzgelockte Yoli warf sich energisch die Jacke über die Schulter und zwängte sich in ihre hochhackigen Pumps. »Lena, bist du endlich fertig? Ich muss gehen, in einer Viertelstunde muss ich auf der Arbeit sein! Komm, wir fahren!«
»Ja gleich, warte mal! Ich hab da etwas gefunden; ich glaube, das gehört diesem Stephen. Seine Referenzen, aus denen gestern so viel zitiert wurde. Hast du eine Ahnung, wo der wohnt?« Yolanda Nuñez Hernandez hatte keine blasse Ahnung. Ihre Finger trommelten seit endlosen Minuten einen nervösen Marsch auf die Türklinke. Wenn Lena jetzt nicht bald kam, dann wäre sie, die Kellnerin Yoli, in argen Erklärungsnöten. Ihr Chef schätzte es so gar nicht, wenn sie zu spät an ihrem Arbeitsplatz erschien. Dabei hatte sie schon gestern krankgefeiert, damit sie das Catering für diese Party übernehmen konnte. Für ein hübsches Sümmchen, versteht sich. Kellnerinnen waren ersetzbar, daher konnte sie es sich unmöglich leisten, heute auch noch zu spät zu kommen. Wenigstens sah sie total übernächtigt aus und hatte Augenringe, die sie an diesem Abend absichtlich nicht überschminkte. Daher würde ihr Chef sicherlich den Schwindel mit der Krankmeldung nicht durchschauen.
Endlich bog Lena mit wehendem Haar um die Ecke. »Ich glaube, ich nehme das Zeugs einfach mit! Vielleicht rufe ich dort im Hotel Eden Roc an, die könnten es ihm irgendwann aushändigen. Vielleicht mach ich das auch nicht, denn als er aufwachte, war er doch ein ziemlicher Idiot!« Lena seufzte. Männer! Warum hatte sie gestern Abend nicht bereits bemerkt, dass der ach so charmante und eloquente Steve nicht alle Tassen im Schrank hatte?
Yoli war sich sicher: sie hatte sämtliche nur denkbaren Verkehrsregeln übertreten, als sie Lena nach nur 10 Minuten vor ihrem Hotel absetzte. Sie besaß nun einmal ein ausgeprägtes Samariter-Gen, welches ihr strengstens verbot, Lena einfach ihrem Schicksal zu überlassen, so dass diese dann selbst sehen müsste, wie sie zurück zum Hotel kam. Obwohl die beiden eigentlich nichts weiter verband, als eine kaum zweiwöchige Bekanntschaft.
Lena war eines Abends in der Tapas-Bar aufgetaucht, in welcher Yoli bediente. Die beiden hatten sich etwas angefreundet, gemeinsam über alles Mögliche gelästert. Na ja, eigentlich hatte Lena sich an Yolis Fersen geheftet, weil sie hier in Spanien niemanden kannte und schnell feststellte, dass sich in Yolis Nähe attraktive Jungs aller Nationen aufhielten. Dann hatte Yoli Lena unvorsichtigerweise von der Party erzählt, bei der sie für Speis und Trank sorgen wollte. Sofort war Lena darauf eingestiegen und hatte sich quasi selbst eingeladen.
Mit quietschenden Reifen legte Yoli die letzten Meter zur TapasBar zurück. Wenn sie nun nicht doch noch von der Guardia Civil erwischt wurde, dann würde sie es gerade rechtzeitig schaffen, registrierte sie, nicht ohne Stolz.
* * *
Am nächsten Morgen, als Steve frisch und munter erwachte, hatte er einen festen Vorsatz gefasst: er würde den komischen Traum, oder was immer das gewesen war, einfach abhaken und vergessen. Er würde im Hier und Jetzt leben, zu dem großen Hotel hinüberfahren, das ihn vorgestern mit der Erstellung eines umfangreichen Computerprogramms beauftragt hatte, den Vertrag unterzeichnen und an seiner Zukunft arbeiten. Er würde die halben Nächte lang durchprogrammieren, in Rekordzeit ein perfektes Ergebnis abliefern. So wie es seine Kunden von ihm gewohnt waren. Schon spukten ihm die ersten Codes und Layouts durch den Kopf, die er zu kreieren gedachte.
Aber zuallererst würde er hinüber nach Elche in den Elektrogroßmarkt fahren, um ein mobiles Heizgerät zu besorgen; denn in einem Winkel seines mittlerweile hellwachen Gehirns wusste er, wie schweinekalt und feucht der bevorstehende Winter im sonnigen Süden werden konnte, wenn man keine Heizung in der Wohnung besaß. Souverän fand er den versteckt gelegenen Elektromarkt, obwohl er diesen nie zuvor aufgesucht hatte. Wenigstens nicht im »realen« Leben, denn im Traum musste er sich dort ein neues Notebook besorgen, nachdem seines bei einem Einbruch entwendet wurde. Stephen verdrängte diesen Gedanken gleich nach seiner Entstehung, sonst hätte er über diese Ungereimtheit wieder nachdenken müssen. Außerdem war er gerade mit einem profanen Alltagsproblem befasst; als er den sperrigen Karton auf der Harley verstauen wollte, entrang sich ein frustrierter Fluch seinen Lippen. Er liebte Motorräder, speziell dieses hier! Doch wenn man größere Einkäufe oder Heizgeräte zu transportieren hatte, dann hörte der Fahrspaß auf.
In Guardamar del Segura mit heiler Fracht und leichten Muskelverspannungen angekommen, fühlte sich Stephen erst einmal erleichtert. Jetzt schnell noch den Heizkörper ins Appartement, dann gleich weiter zum Hotelmanager nach Torrevieja.
Nanu, hatte er nicht abgesperrt gehabt? Stephen hielt irritiert in seiner Bewegung inne. Es ereilte ihn unvorbereitet das nächste unangenehme Déjà vu.
Diese Situation war ihm leider bereits hinreichend bekannt. Er würde nun gleich in das Appartement eintreten und hierbei feststellen, dass nicht mehr alle Dinge an ihrem angestammten Platz standen. Anschließend, da war er sich ganz sicher, würde sein Blick auf die leere Stelle fallen, wo noch vor einer Dreiviertelstunde sein Notebook gestanden hatte. Danach würde er registrieren, dass auch das Handy fehlte.
»So eine gottverdammte Scheiße!« Mit dieser verbalen Entgleisung war nicht nur die Tatsache gemeint, dass das Notebook noch einen beträchtlichen Wert gehabt hatte, er es dringend zum Programmieren benötigte und dieses nun gestohlen worden war. Weitaus schlimmer war die Einschätzung seiner Situation. Es würde nicht aufhören, immer wieder würde er auf Fragmente seiner Traumerlebnisse – oder was immer ihm da serviert wurde – stoßen, die er in Wirklichkeit doch gar nicht erlebt haben konnte.
Ja genau! Die Nebenerwerbseinbrecher! Nun wusste er wenigstens, dass man schon einen Tag nach seinem schweren Unfall hier eingebrochen hatte; nur konnte er es in der anderen Version seines Lebens erst später entdecken, weil er zu diesem Zeitpunkt noch bei Pilar wohnte, El Burro reparierte und seine Verletzungen vom Unfall ausheilte.
Stephen fühlte sich nicht wohl in seiner Haut, ließ sich mutlos auf die Couch fallen. Er würde den Einbruch nun wieder bei der Policía melden müssen, diesmal aber ganz bestimmt nicht wie der deutsche Touristen-Depp dastehen und zum Gespött gelangweilter Polizisten werden. Diesmal nicht! Anschließend würde er schon wieder zum Elektromarkt fahren dürfen, ein Notebook kaufen. Dann zum Schlüsseldienst, die Schlösser austauschen lassen. Gott, nervte das.
Stephen beschloss, dies alles NACH seinem Besuch im Hotel zu erledigen. Er streifte sein einziges Jackett über, bestieg das Motorrad und machte sich auf den Weg. Aber heute Abend, wenn er erst ein neues Notebook nebst einem Großauftrag sein Eigen nannte, dann würde er einiges eruieren, es führte leider kein Weg daran vorbei. Am besten bei einer schönen Flasche Rotwein.
Das Hotelmanagement war überhaupt nicht erbaut, dass der vielversprechende junge Programmierer so wenig Interesse an seinem Auftrag zeigte, dass er einen vollen Tag zu spät zur Vertragsunterzeichnung auftauchte. Dabei hatte man ihm explizit zu verstehen gegeben, dass die Zeit drängte, die Teilrenovierung des Hauses bereits ihrer Fertigstellung entgegen ging. Danach würde man das neue System in Betrieb nehmen wollen, vorausgesetzt, dass Stephen seinen vorgegebenen Zeitplan einhielt. Für die Eile hatte man ihm schließlich auf den gewöhnlichen Stundensatz einiges draufgepackt, der Auftrag konnte für den jungen Mann durchaus als lukrativ betrachtet werden. Umso erstaunlicher, dass dieser nun schon im Vorfeld durch Unpünktlichkeit glänzte.
Natürlich hatte Stephen eine prima Ausrede parat, er war ja ausgeraubt worden. Den Einbruch verlegte er bei seiner Erzählung einfach einen Tag zurück, schilderte in den buntesten Farben seine Erlebnisse bei der Polizei, wie er sie aus seinem »Zweitleben« in Erinnerung hatte. Man nickte bedächtig, anscheinend hatte hier jeder so seine Erfahrungen mit irgendwelchen Einbrüchen. Dennoch entging Stephen der irritierte Blick des Hotel-Managers nicht, mit dem er ihn in einem unbeobachtet geglaubten Moment betrachtete. Misstraute er ihm etwa?
Stephen erhielt seinen unterzeichneten Vertrag, sein Pflichtenheft und die eindringliche Ermahnung, regelmäßigen Bericht über den Fortgang seiner Tätigkeit zu erstatten und unbedingt im Zeitplan zu bleiben. Dann durfte er endlich gehen.
Als er draußen die Unterlagen in der Satteltasche seiner Harley verstaute, beschlich ihn ein höchst ungutes Gefühl. Als hätte er soeben ein Verbrechen oder einen Verrat begangen, sich wissentlich Sünde aufgeladen. Selbstverständlich wusste er auch, weshalb sich dies so anfühlte.
Waren nicht Computer und die Menschen, die sie benutzten, am Untergang der Welt mitschuldig? In seinem anderen Leben hatten sie den Anfang vom Ende eingeleitet; es würde in einigen Jahren der Supercomputer »das Tier 0« in Betrieb genommen werden, und zwar Mitte 2012. Was heute, am Ende des Jahres 2004, allerdings noch niemand ahnen konnte. Genau, er würde einiges überprüfen müssen, wenn er nach Hause kam.
Im »Eden Roc« war die Chefbesprechung indessen noch nicht aufgelöst worden. Die drei Spanier waren sich plötzlich überhaupt nicht mehr sicher, den richtigen Programmierer an Land gezogen zu haben. »Señor Gómez, haben Sie es auch bemerkt? Vorgestern noch hat dieser Stephen McLaman vorgeschoben, nur ein paar Brocken Spanisch zu sprechen, »un pocito« hat er entschuldigend bemerkt. Und heute steht er da und erzählt ausführlich seine Erlebnisse mit La Policía, ohne mit der Wimper zu zucken, nachdem er einen Tag zu spät hier auftauchte. Sagen Sie, wie gut kennen Sie eigentlich seinen Vater, der ihn empfohlen hat?« Der Angesprochene war ebenfalls nicht ganz im Bilde, was dieses Verhalten zu bedeuten hatte. Aber der Ruf des Thomas McLaman und seiner Aktiengesellschaft war tadellos. Gómez hatte einige Jahre lang im selben Bürogebäude gearbeitet und schwärmte noch heute von seiner Zeit in Hamburg, als er den großen »Mr. LAMANTEC« persönlich kennenlernen durfte. Dieser Mann verkörperte das, was sich Victor Gómez unter einem perfekten Manager vorstellte. Er besaß Brillanz, Unerbittlichkeit und Stolz. Seit er diesem Unternehmer begegnet war, strebte er danach, dieselbe Kompetenz auszustrahlen. Nur so funktionierte das Big Business. Nur so.
* * *
Lena Keller langweilte sich. Eigentlich war sie spontan nach Spanien geflogen, um Spaß zu haben, um endlich ihr Image als graue Maus loszuwerden. Sie hatte wohl das gehabt, was man heute als
»schwere Kindheit« bezeichnete, denn ihre Mutter war einfach spurlos verschwunden, als sie noch im Kindergarten-Alter war. Die Kindergärtnerin hatte sie schließlich adoptiert, doch Lena war trotzdem mit dem Makel aufgewachsen, von der eigenen Mutter im Stich gelassen worden zu sein. Was sich fatal auf ihr Selbstbewusstsein auswirkte.
Außerdem war sie viel zu schüchtern und verklemmt gewesen. Noch bis vor wenigen Wochen, als sie an einem schicksalhaften Tag endlich aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen konnte. Oder musste, wie man es eben nahm.
Das Leben spielte oft gemeine Streiche. Eigentlich hatte Lena sterben wollen, war mit einer ganzen Batterie von Tabletten und einer Flasche Schnaps an den norddeutschen Strand gegangen, um sich das Leben zu nehmen. Zur Sicherheit wollte sie während der Tabletteneinnahme in der Brandung des Meeres stehen, damit sie beim Eintritt ihrer Bewusstlosigkeit auch gleich ertrinken würde. Denn kein Gedanke war schlimmer, als der an eine bleibende geistige Behinderung, falls man sie zu früh am Strand gefunden und in letzter Minute gerettet hätte.
Die junge Frau besaß jedoch einen derart labilen Magen, dass dieser schon mit den großen Schlucken billigen Wodkas überfordert war, die sie angeekelt hinunterwürgte. Als sie die ersten Tabletten hinterherschicken wollte, übergab sie sich derart, dass sie schon dachte, alleine daran krepieren zu müssen. Wann hatte sie zuvor auch schon einmal Alkohol getrunken?
Vollgekotzt und kreidebleich war sie nach Hause gewankt, wo ihr Stiefmutter Meike mit ihrer Bemutterung und Besorgnis gnadenlos auf den Wecker gefallen war, Stiefvater Piet hingegen mit herben Vorwürfen. Sie konnte und wollte nichts erklären, nicht mehr reden müssen an diesem Abend.
Von diesem Zeitpunkt an veränderte sich etwas in Lena. Wenn sie schon nicht sterben durfte, dann war es auch egal, wie es weiterging. Nur nicht wie bisher, das auf gar keinen Fall. Lena beschloss, ihr Überleben als Neuanfang, wie eine neue Geburt, zu sehen. Sie hatte vor ein paar Monaten von weisen Frauen im Altertum gelesen, die für solche Zwecke ein Ritual zur Selbstsuggestion beschrieben, wonach sie dann zu neuen Persönlichkeiten, in diesem Fall zu weißen Hexen, wurden. Genau so etwas würde auch sie durchführen, das versprach sich Lena in jener Nacht. Mit ungewissem Ausgang.
Meike und Piet, ihre Stiefeltern, waren äußerst beunruhigt, als sie Lenas Verwandlung gewahrten. Ihre Tochter verschwand mit einer Decke mehrere Stunden lang, ohne wie sonst Bescheid zu geben, wohin sie ging. Dann tauchte sie mit Erdkrümeln im Haar wieder auf, trug ein vollkommen neues Outfit, das sie noch tags zuvor niemals getragen hätte, weil es für ihren Geschmack um Welten zu offenherzig wirkte. Geschminkt war sie auch noch, dabei hatte sie stets verächtlich bemerkt, dass so etwas sicher nur Mädchen täten, welche dies auch nötig hätten und die sowieso nur danach trachteten, Jungs anzumachen. Sie selbst hatte niemals auch nur ein Quäntchen Farbe aufgetragen, die ganze Pubertät lang nicht. Doch jetzt, mit ihren 19 Jahren, benahm sie sich, als wäre sie eben erst in die Pubertät gerutscht und das buchstäblich über Nacht. Lena neigte von jeher zum Extremismus. War sie früher extrem schüchtern, unauffällig und natürlich gewesen, so konnte jetzt das glatte Gegenteil zur Beschreibung dienen. Ihre gewählte, höfliche Ausdrucksweise wandelte sich zunehmend in die bei jungen Leuten weltweit so beliebte Gossensprache; sie selbst glaubte, sich so ausdrücken zu müssen, damit sie künftig als »cool« gelte. Im Gymnasium waren die Klassenkameraden begeistert, als sie Lenas Verwandlung gewahrten. Endlich war diese abgehobene, vergeistigte Schnepfe normal, eine von ihnen, geworden. Bis Lena die Schule von heute auf morgen schmiss, ihr Sparbuch plünderte und nach Spanien flog, um endlich »Party zu machen«, wie sie ihren entsetzten Adoptiveltern in arrogantem Ton fünf Minuten vor der Abreise erklärte.
Im Grunde war Lena in der Nacht ihres Selbstmordversuchs doch gestorben. Oder etwas in ihr.
Wie gesagt, aktuell langweilte sie sich im Hotel. Also machte sich die attraktive junge Frau zurecht und beschloss, wieder einmal Yoli in der Tapas-Bar zu besuchen. Sie würde per Anhalter fahren müssen, denn sonst reichten ihre Ersparnisse nicht mehr lange. Ein aufregendes Leben hatte sie sich sowieso anders vorgestellt, aber vielleicht traf sie ja dort in der Bar interessante Leute, die mit ihr etwas Abenteuerliches unternahmen. Wem gehörten denn eigentlich die ganzen schneeweißen Yachten und Segelboote dort draußen, die vor der Küste hinund her cruisten? Hatte denn niemand Interesse daran, sie zu solch einem Turn mitzunehmen? Kein Zweifel: Lena war begierig nach dem Leben, wollte die letzten Jahre gesellschaftlich mit aller Gewalt nachholen, die nahezu ereignislos an ihr vorbei gezogen waren. Jedenfalls sah sie das aus dem heutigen Blickwinkel so. Früher hatte sie ihr Leben wie im Traum verbracht; jetzt aber würde sie, die wachgeküsste Lena, ihren Traum leben. Ohne Rücksicht auf Verluste.
Auch wenn sie sich das Wachküssen von gestern Abend anders vorgestellt hätte, wie sie sich längst beschämt eingestehen musste.
* * *
Stephen McLaman erreichte nach diesem erlebnisreichen Tag endlich seine feucht-klamme Couch, die er am liebsten schon wesentlich früher an diesem Nachmittag aufgesucht hätte. Er befreite im Licht der Abenddämmerung sein neues Heizgebläse aus der opulenten Verpackung, um die feindliche Atmosphäre seines Appartements ein wenig trockener und kuscheliger zu bekommen. Das hiesige Klima hatte er echt unterschätzt, das musste er zugeben. Im Spätherbst und Winter wirkte sich die unmittelbare Nähe des Meeres eher negativ aus, die allgegenwärtige Salz-Luft ließ Metall innerhalb kürzester Zeit rosten und erfüllte die Wohnung mit fast schon modrig riechender Luftfeuchtigkeit.
Bereits nach wenigen Minuten fühlte er sich wohler, konnte sein dickes Sweatshirt wieder ablegen. Er zündete ein Räucherstäbchen an, welches dezenten Sandelholzduft verbreitete. Schon besser! Nun kam das neue Notebook dran. Steve musste es konfigurieren, damit es einsatzbereit war.
Das stellte sich als gar nicht so einfach heraus, denn das Betriebssystem führte ihn auf Spanisch durch die Anwendungen; überdies musste er erst lernen, mit der, an manchen Stellen, im Vergleich zu seinem deutschen Rechner unterschiedlichen Tastatur klar zu kommen. Normalerweise vermochte er blind im 10-FingerSystem in rasender Geschwindigkeit zu schreiben, doch jetzt war ihm das ñ ständig im Weg. Verflixter Nebenerwerbs-Einbrecher! Hoffentlich ärgerte sich dieser Mistkerl jetzt über Buchstaben wie ä, ö und ü, die er nicht gebrauchen konnte.
Mit dem ebenfalls geklauten Handy wollte er gar nicht erst spanische Experimente eingehen. Seine Mutter würde ihm sicherlich in Deutschland ein Neues besorgen. In seinem anderen Leben, von dem er leider immer noch nicht wusste, wie er an Erinnerungen aus der Zukunft gekommen sein konnte, hatte Kirstie sich gefreut, ihm helfen zu können. Überraschend war das Handy mit der Post angekommen; schon wenige Tage, nachdem er ihr sein Leid geklagt hatte. Heimlich hatte sie es an ihn abschicken müssen, damit sein Vater sie deswegen nicht mit sarkastischen Vorwürfen überschüttete.
Endlich hatten Stephens Bemühungen einen Punkt erreicht, an dem er sich mit dem Ergebnis zufrieden geben konnte. Morgen war auch noch ein Tag; es war ohnehin besser, ausgeruht mit dem Programmieren zu beginnen, als jetzt am Abend mit aller Gewalt halbherzig noch ein paar Code-Zeilen zu schreiben. So etwas barg Fehlerquellen.
Steve startete die Internet-Suchmaschine, um ein paar Recherchen vorzunehmen. Er erinnerte sich ganz genau an die Begebenheiten seines Zweit-Lebens, die er in der Zeitspanne kurz vor Weihnachten erlebt hatte. Das mit dem Einbrecher war bereits eingetroffen, andere Ereignisse hingegen hatten sich eindeutig verändert. Einfach, weil er keinen Motorradunfall gehabt und Lena somit nicht vom Himmel aus das Leben gerettet hatte.
In diesem Moment, an diesem Punkt seiner Überlegungen angekommen, lief es ihm eiskalt den Rücken hinunter. Ach, du Schande! Stephen hatte keine Ahnung, zu welchem genauen Datum Lena den Selbstmordversuch unternommen hatte! Die lineare Zeitschiene war während seines Aufenthaltes im Himmel überhaupt nicht existent gewesen, man konnte vor und zurückspringen, wie man es gerade brauchte. Einmal kurz Steinzeit, dann wieder nach 2004. Was, wenn der Selbstmord noch in der Zukunft lag und Lena den Versuch diesmal eben nicht am Nordseestrand, sondern hier, an der Costa Blanca, unternahm? Oder hatte er sich doch alles nur eingebildet? So etwas konnte es doch nicht geben!
Um genau das herauszufinden, saß er hier am Notebook, erinnerte er sich. »Also schauen wir mal, WIE bescheuert ich eigentlich bin. In meinem Horrortrip, Delirium oder sonstigen vollverblödeten Zustand saß ich auf exakt diesem Sofa hier, als ich im Fernsehen die Sache mit der Kometensichtung verfolgt habe. Diese Doku, genau. Als die Sache mit Apophis später richtig aktuell war, haben sie die ganze Geschichte seit der Entdeckung immer wieder in Spezial-Nachrichtensendungen aufgebauscht und durchgenudelt. Da wurde unter anderem erwähnt, dass irgendwelche Typen in Arizona im Sommer 2004 den Kometen entdeckt, dann aber wieder aus den Augen verloren haben. Na, was ist, du hinterhältiges Steinchen, bist du da oben?«
Steve gab die Suchbegriffe ein. Es war gar nicht so einfach, die Meldung zu finden, die das Observatorium herausgegeben hatte; das kam daher, dass man der Entdeckung zu diesem Zeitpunkt noch keine große Bedeutung beimaß, zumal die »Sichtung« erst einmal aus dem Blickfeld verschwunden war. Aber sie war dokumentiert. Von Roy Tucker und seinen Kollegen, haargenau. Das war der Startschuss für die Öffnung der Rotweinflasche, die an diesem Abend nicht die letzte bleiben sollte. Es stimmte also! Dieser verdammte Komet, der 2029 mit der Auslöschung der Welt begonnen hatte – beziehungsweise das noch tun würde – der war tatsächlich dort oben. Und außer einem nach Spanien ausgewanderten Programmierer, welcher einen Joint zu viel geraucht hatte, wusste niemand Bescheid. Er konnte jetzt schlecht zu irgendwelchen Sternwarten marschieren, dort einen auf »ich weiß was« machen und erklären, dass der Weltuntergang bereits eingeleitet sei. Sonst wäre er an Weihnachten mit einer Zwangsjacke bekleidet und würde an einem Malprojekt für Schizophrene teilnehmen, vielleicht mit Thema »Wir drücken unsere Krankheit im Bild aus«.
Das Ganze lief ziemlich aus dem Ruder. Da war ja die Abfolge der Ereignisse aus dem anderen Leben noch angenehmer gewesen, und er hatte diese schon für katastrophal gehalten. Er gestand es sich nur ungern ein, aber am meisten störte ihn die Veränderung, die Lena betraf. In DIESEM Leben würde sie ihm wohl keine Oase sein, in die er sich retten konnte, wenn es hart auf hart kam.
»Mensch, genau – Lena! Ich frage morgen besser mal bei dieser Bedienung nach ihr. Wo die arbeitet, weiß ich ja … auch wenn Lena dieses Mal absolut nicht mein Fall ist, ich darf nicht zulassen, dass sie sich etwas antut!«
Hoffentlich war es morgen nicht schon zu spät. Jetzt bedauerte Stephen, dass er fast zwei Flaschen Rotwein abgepumpt hatte und des Fahrens nicht mehr mächtig war. Zum Glück hatte wenigstens offensichtlich jener peinliche Abend am Strand niemals stattgefunden, an dem er Yoli, die Bedienung, eigentlich hatte verführen wollen. Zumindest hatte sie bei seinem Anblick am Morgen nach der Party keinerlei Zeichen des Erkennens gezeigt. Da war es nun nicht ganz so peinlich, dort aufkreuzen zu müssen.
* * *
»He, Bedienung! Was ist jetzt? Bringst du uns endlich noch eine Runde Hierbas, oder wird das heut nix mehr?!« Yoli hatte Tische wie diesen heute noch mehr satt als an anderen Tagen. Seufzend gab sie an der Bar Bescheid, doch bitte noch 7 Kräuterschnäpse für Tisch 23 einzuschenken. Für den lauten Tisch in der Ecke, an dem die besoffene Meute von tätowierten Deutschen saß. Die hatten alle schon kräftig getankt und wurden nun langsam ausfällig. Heute nervte das ganz besonders, denn Yoli war alles andere als fit. »¡Momento, por favor!« Es gab Tage, da klang dieser Standardsatz einer Kellnerin nicht einmal bei der temperamentvollen, fröhlichen Yoli freundlich.
Und genau an diesem Abend, der so gar nicht vergehen wollte, war natürlich auch noch Lena aufgetaucht. Yoli hatte nichts gegen die Urlauberin, aber eben auch keine Zeit. Sie wollte einfach nur hier fertig werden und dann schnellstens nach Hause ins Bett, endlich einmal schlafen.
Lena hingegen wirkte frisch und munter, vermutlich hatte sie sich im Hotel für ein paar Stunden hinlegen können. Sie saß an der Bar, quatschte ein paar Leute voll und trank für Yolis Geschmack entschieden zu viel Alkohol. Ab und zu schickte sie vorwurfsvolle Blicke in Richtung der gestressten Kellnerin, die diese wohl daran erinnern sollten, dass sie Lena schon viel zu lange alleine an der Bar sitzen ließ, anstatt sich an ihre Seite zu gesellen. Yoli hegte den berechtigten Verdacht, dass diese Lena in ihrem Leben wohl noch niemals hatte arbeiten müssen.
Weit nach Mitternacht war es Yoli endlich gelungen, den letzten Tisch abzukassieren und die volltrunkenen Deutschen aus der Bar zu komplimentieren. Sie wischte kurz über die Tische und stellte die Stühle für die Putzfrau hoch, die morgen früh zum Dienst erscheinen würde. Der Chef hatte sich schon verabschiedet, nur Lena saß noch an der Bar und ließ den Kopf hängen. Die hatte Nerven! Wenigstens jetzt hätte sie genauso gut herkommen und ihr mit den Stühlen helfen können.
Yoli sah genauer hin. Moment. Weinte Lena etwa? Ihre Schultern zuckten seltsam, den Kopf hatte sie in ihre Hände gestützt.
»Lena? Alles in Ordnung mit dir? Hast du zu viel getrunken?« Mit tränenüberströmtem Gesicht sah Lena auf; die Schminke um ihre Augen war total verwischt und lief nun in zwei dicken, schwarzen Rinnsalen über ihre hohen Wangenknochen.
»Nein! Es geht mir NICHT gut, und es wird mir auch nie wieder gut gehen!« Nach diesen Worten wurde das große schlanke Mädchen von einem weiteren Weinkrampf geschüttelt. Yoli konnte sich keinen Reim auf Lenas Zustand machen. War sie von einem der Gäste beleidigt worden, oder hatte sie irgendetwas anderes nicht mitbekommen, was Lena derart zusetzte? Normalerweise wirkte die Rothaarige auf eine seltsame und krampfhafte Weise cool und frech, ungefähr so, als probe sie für ein Theaterstück. Als sei sie in Wirklichkeit ganz anders und müsse diese neue Rolle erst einstudieren. Unbeholfen: das war das Wort, nach dem Yoli gesucht hatte! Und manchmal überzog Lena auch, wusste nicht, wo die Grenzen des guten Geschmacks lagen.
Yoli taten die Füße weh, ihr Kopf begann zu schmerzen. Die Augen weiterhin offen zu halten, das grenzte mittlerweile an einen Kraftakt, so schwer wogen die Augenlider. Dennoch, was sollte sie tun? Sie MUSSTE Lena jetzt mit sich aus der Kneipe nehmen. Yoli nahm Lena in den Arm. »Komm, wir gehen erst einmal an die frische Luft! Dann sehen wir, dass wir dich ein wenig beruhigen, so furchtbar schlimm kann doch jetzt gar nichts auf dieser Welt gewesen sein. Wirst sehen, morgen früh sieht alles schon wieder ganz anders aus. ¿Vale?« Willenlos ließ Lena sich aus der Bar führen, setzte sich draußen auf ein Mäuerchen, während Yoli Tür und Scherengitter sorgfältig absperrte.
Als sie sich zu Lena umdrehte, stand diese schwankend auf, hing der zierlichen Kellnerin nur Sekunden später heulend um den Hals. Schluchzte ihr nasse, bitterliche Tränen in den Blusenkragen und bettelte: »Bitte, lass mich jetzt nicht alleine, ich möchte mit dir nach Hause kommen! Bitte! Ich KANN heute Nacht nicht alleine bleiben, ich flehe dich an, nimm mich mit!«
Auch das noch! Nichts hätte sich Yoli in diesem Augenblick weniger gewünscht, als dieses Szenario. Aber nichts hätte sie weniger gekonnt, als Lena einfach ihrem Schicksal zu überlassen. So atmete Yoli scharf ein, befreite ihren Hals von diesem schluchzenden menschlichen Collier und führte Lena zu ihrem altersschwachen Auto. Als das Sozialgen verteilt worden war, musste Yoli wohl mehrfach »Hier!!!« gerufen haben.
* * *
Meike Keller saß am Frühstückstisch. Um sie herum standen die stummen Zeugen eines beendeten Familienfrühstücks, welches in ihrer Familie samstags traditionell immer sehr umfangreich auszufallen pflegte. Aber ein einziges Detail unterschied sich an jenem Samstag eklatant von ähnlichen Schlemmereinsätzen – Meike, die kleine rundliche Kindergärtnerin, stand heute nicht eifrig spülend und singend am Becken, um die geräumige Wohnküche möglichst schnell wieder in einen ansehnlichen Zustand zu versetzen.
Im Gegenteil. Tief in schwarze Gedanken versunken brütete Meike vor sich hin, sah erst auf, als ihr Mann Piet mit der Zeitung nahte, die er normalerweise genüsslich am bereits gesäuberten Tisch zu einer letzten Tasse Kaffee las.
Als Piet bemerkte, dass er seine Zeitung wohl in diesem Chaos nicht aufschlagen würde können, zog er ein säuerliches Gesicht. Da arbeitete man die ganze Woche lang hart in seiner Schreinerei, und dann machte die Frau am Wochenende solch ein Theater wegen einer Adoptivtochter, die ihm ohnehin von Anfang an unheimlich gewesen war. Das erfüllte ihn nicht gerade mit Freude; genauer gesagt verstand er es nicht.
»Meike, jetzt hab dich doch nicht so! Davon geht die Welt nicht unter! Lena ist erwachsen, soll sie doch jetzt selbst sehen, wie sie klar kommt. Immer hast du sie verteidigt, egal was sie gemacht hat, oder sich zumindest wie ein Opferlamm gefallen ließ. Wirst schon sehen, wenn das Geld erst alle ist, kommt die ganz schnell von selbst wieder angekrochen!«
Piet und Meike waren schon lange verheiratet. Im Grunde schätzte Meike Piets einfache, geradlinige Art, wie er mit Menschen umging. Er war wie ein großer, starker Bär, dem seine Familie über alles ging, an den sie sich anlehnen konnte. Für ihn hatte die Existenz bombenfeste Konturen, war die Welt entweder schwarz oder weiß, dazwischen gab es nichts. Wer viel arbeitete, war eben auch viel wert. Und umgekehrt. Geisteswissenschaften interessierten ihn genauso wenig wie Modeerscheinungen oder alles, was er als »brotlose Kunst« bezeichnete. Daher hatte er stets Schwierigkeiten gehabt, Lenas Ansichten zu verstehen und sich in ihr zartes, sehr zerbrechliches Wesen einzufühlen.
Doch Piet besaß in erster Linie ein großes Herz für Kinder und hatte das Mädchen großmütig akzeptiert, auch wenn ihm das nicht immer leicht gefallen war. Für Unternehmungen jeder Art hielt er sich allerdings dann doch lieber an seine eigenen beiden Kinder Mark und Maja. Das waren nicht so überempfindliche Fabelwesen. Freilich hatte es Lena nicht leicht gehabt, als ihre Mutter sang und klanglos verschwand. Aber musste man ihr deswegen ihr ganzes Leben lang alles nachsehen, was sie tat?
»Piet, sieh mal: Lena ist schon so lange wir sie kennen gehemmt und ängstlich, hat sich am liebsten zurückgezogen. Sie kommt doch in der Welt da draußen überhaupt nicht zurecht. Was, wenn ihr jemand etwas antut? So wie sie jetzt herumläuft, kann werweiß-was passieren. Und dann auch noch im Ausland …! Glaubst du, sie ist krank? Psychisch, meine ich? Sie hat krank ausgesehen, als sie an diesem Abend nach Hause gekommen ist, nach welchem sie so verändert war, das hast du doch selbst gesehen!« Bei diesen Worten liefen Meike schon wieder die Tränen hinunter.
Piet war kein Unmensch. Er hielt mit seinen großen Arbeiterhänden die Schultern seiner Frau fest, drückte sie und sagte in versöhnlichem Ton: »Dann geh halt am Montag mal zu Dr. Berner. Der kennt sie schon fast ihr ganzes Leben lang. Frag ihn, was er dazu meint. Bloß – machen kann man im Moment so oder so nichts, damit musst du dich abfinden!« Damit war für Piet Keller die Angelegenheit erledigt. Wenn man ein Problem hatte, fand man eine Lösung, und dann dachte man vorläufig nicht mehr darüber nach. Basta.
Für Meike hingegen war es nicht ganz so einfach, den Schalter umzulegen und wieder einen auf fröhliche Mama und Ehefrau zu machen. Die Angst nagte an ihrem Herzen, denn es gab etwas, das sie Piet bislang verschwieg. Krank vor Kummer und Sorge hatte sie in das kleine, blaue Handtäschchen gesehen, das Lena an jenem Abend am Strand dabei gehabt hatte; sie schob ihr schlechtes Gewissen mit der Hoffnung beiseite, eine akzeptable Begründung für Lenas merkwürdige Veränderung zu finden.
Die handliche Tasche war mit mehreren Tablettenschachteln vollgestopft gewesen, eine davon leer. Meike verstand nicht viel von Arzneimittelkunde, doch wusste sie natürlich ganz genau, was sie hier vor sich hatte: Schlafmittel und andere Psychopharmaka, die man in solchen Mengen eigentlich nur dann hortete, wenn man … Wie konnte das Kind nur sein Leben wegwerfen wollen? Meike folgte Piets Rat und eilte am Montagabend gleich nach dem Dienst zu Dr. Berners Praxis, die im ersten Stock eines ansehnlich renovierten Altbaus in der Innenstadt lag. Als sie an der Türe der Praxis klingelte, öffnete zunächst niemand. Zwei Minuten später allerdings kamen die beiden Sprechstundenhilfen schwatzend heraus, schon fertig angezogen in Mänteln und Stiefeln, um ihren verdienten Feierabend anzutreten. Die beiden sahen nicht gerade begeistert drein, als sie die späte Patientin im Treppenhaus bemerkten.
»Oh, hallo Frau Keller! Also, tut mir leid, aber wir haben eigentlich schon geschlossen!«, bemerkte die Ältere in vorwurfsvollem Ton. »Wenn etwas Dringendes ist, Sie wissen ja, die Bereitschaft im Medizinischen Zentrum hat noch geöffnet!« Damit wollten die beiden verschwinden und Meike ihrem Schicksal überlassen.
»Aber ich will mich doch gar nicht behandeln lassen! Ich müsste nur kurz mit Heinrich, ich meine, Dr. Berner sprechen. Und das ist wirklich eilig!« Meike konnte durchaus energisch werden, wenn es sein musste. Wenn man sich nicht durchsetzen konnte, war man heutzutage als Kindergärtnerin verloren. Sie kannte Kolleginnen, die sich bereits schwer taten, mit Vierjährigen fertig zu werden. Die Arzthelferin verdrehte die Augen in Richtung der zartgelben Stuckdecke, sperrte dann aber seufzend die schwere Holztür der Praxis wieder auf. »Ich sehe mal nach, ob ich ihn stören kann! Warten Sie hier einen Moment.«
Die Holzdielen der Praxis knarrten, als sich jemand mit schnellem Schritt der Eingangstüre näherte. Es war ihr Jugendfreund Heinrich, der erfreut heraneilte und sie in sein Sprechzimmer bat. Meike fühlte sich bei diesem Arzt gut aufgehoben, seit er gleich nach dem Medizinstudium diese Arztpraxis eröffnet hatte. Ihre ganze Familie war niemals woanders hingegangen, wenn ärztlicher Rat von Nöten war. Bei Heinrich handelte es sich um einen Menschen, dem man vorbehaltlos vertrauen konnte. Meike und er waren dick befreundet gewesen, bis sich ihre Wege wegen der Schullaufbahn trennten. Obwohl auch Meike mit ihren guten Noten ins Gymnasium hätte gehen können, beschlossen ihre Eltern, dass für ein Mädchen die Realschule gut genug wäre. Meike würde ja irgendwann sowieso heiraten und ein Studium wäre der Familie bei weitem zu teuer gekommen.
So kam es, dass Heinrich weitgehend aus Meikes Leben verschwand. Dr. Heinrich Berner heiratete die schöne Anna, die ihm schon lange nachgelaufen war und mit Nachdruck sowie allen Mitteln das Ziel verfolgte, Frau Doktor zu werden. Meike schloss aus Heinrichs Wahl, dass sie selbst bei ihm bestimmt sowieso nie eine Chance gehabt hätte, auch wenn sie ihm damals ins Gymnasium gefolgt wäre.
Anna bot optisch das glatte Gegenteil, war groß, schlank, attraktiv und überaus blond. Leider hatte sie auch einen gegenteiligen Charakter. Diese Frau wurde von Ehrgeiz, Egoismus und Oberflächlichkeit getrieben, Meike dagegen galt als warmherzige, liebenswürdige Mama. Wenn die Kinder glücklich waren, so war sie es auch. Da brauchte es weder Shopping, noch Partys.
Ab und zu traf man sich später zufällig bei Kinobesuchen, in der Fußgängerzone oder beim Elternabend auf dem Flur des örtlichen Gymnasiums, denn Heinrichs Sohn Max besuchte dieselbe Schule wie Lena. Alle drei Söhne waren bei Meike in der Kindergartengruppe gewesen. Und jedes Mal fragte sich Heinrich wider Willen, ob er wirklich die richtige Wahl getroffen hatte; Meike war ein Mensch aus Fleisch und Blut, besaß ein Herz. Anna? Die war eine meist übel gelaunte Puppe. Wenn man Dr. Heinrich Berner gefragt hätte, was seine Frau am besten könne, hätte er geantwortet: Kreditkarten benutzen.
Es war viel zu spät für solche Gedanken. Meike hatte Piet und der war zwar einfach strukturiert, das hatte Heinrich gleich gemerkt, aber gleichwohl ein treuer, zuverlässiger Ehemann. Er selbst war Vater von drei Söhnen, auch Meike hatte drei Kinder, Lena mitgerechnet. Viel zu spät, leider.
»Ja Meike, welch Glanz in meiner bescheidenen Hütte! Lange nicht gesehen, was verschafft mir die Ehre?« Dr. Berner rückte seiner Jugendfreundin eilfertig einen bequemen Sessel zurecht, setzte sich ihr gegenüber. Mit Meike ein paar freundschaftliche Worte wechseln zu können war allemal besser, als sofort nach Hause in Annas unterkühlten Dunstkreis fahren zu müssen.
»Heinrich, es tut mir leid, dich so spät noch zu stören. Aber ich weiß mir einfach nicht mehr zu helfen und brauche deinen Rat. Du kennst Lena doch auch schon ewig. Wie oft waren wir hier gesessen und haben darüber gesprochen, wie dünn ihr Nervenkostüm ist und wie schwer für sie immer noch die Verarbeitung des Traumas mit ihrer Mutter zu sein scheint. Wahrscheinlich glaubst du mir gar nicht, wenn ich dir jetzt sage, dass sich ihr Wesen ins genaue Gegenteil verkehrt hat. Innerhalb eines einzigen Tages verwandelte sie sich von unserer unnahbaren, zurückgezogenen Lena in … ja, ich weiß auch nicht. Rennt jedenfalls offenher zig herum, redet, als käme sie aus der Bronx. Und dann ist sie abgehauen! Einfach so, plünderte ihr Sparkonto und meinte, sie werde jetzt endlich leben, fliege jetzt erst einmal nach Spanien. Man konnte überhaupt nicht mehr normal mit ihr sprechen!« Dr. Berner sah tatsächlich ungläubig drein. »Natürlich glaube ich dir, Meike! Warum sollte ich nicht? Du bist ein vollkommen bodenständiger Mensch und eine gute Beobachterin, schon berufsbedingt. Aber sag mal – wir reden hier echt von DIESER Lena? Und ihre Verwandlung vollzog sich wirklich innerhalb eines Tages, nicht schrittweise, sagst du?«
»Genau, das ist es ja! Ich habe Angst bekommen, dass ihr irgendetwas passiert ist, dass sie womöglich an eine Sekte oder in falsche Gesellschaft geraten ist. Die ist doch solch ein Schaf und vermutet bei niemandem etwas Böses. Also habe ich … habe ich in ihre Handtasche gesehen, die sie an jenem Abend dabei gehabt hatte. Nicht, dass ich sonst so was mache, aber ich musste doch …!«
»Meike, jetzt mach dir bloß deswegen keine Vorwürfe! Schau, du meinst es schließlich nur gut. Du hast ja Recht, irgendetwas muss passiert sein. Hast du einen Hinweis gefunden?«
»Allerdings. Und daher wollte ich dich als Fachmann fragen, ob das hier der Grund dafür sein könnte!« Meike kippte den Inhalt ihrer Tasche auf Dr. Berners Schreibtisch.
»Ach, du meine Güte. Psychopharmaka … die waren alle in Lenas Tasche? Himmel, dann wollte sie sich vielleicht umbringen! Was auch funktioniert hätte, wenn sie die alle eingenommen hätte. Aber da ist nur eine einzige Schachtel leer, die anderen hat sie nicht angerührt, wie es scheint.« Dr. Berner wirkte ehrlich betroffen.
Hatte er die Suizidneigung bei Lena während seinen Untersuchungen übersehen? Meike war öfters mit ihr vorbeigekommen, um sicherzugehen, dass sie keine psychische Erkrankung ausbrütete. Häufig hatte er dem Mädchen pflanzliche Beruhigungsmittel verschreiben müssen.
»Lena kam an diesem Abend völlig aufgelöst nach Hause. Sie roch nach Alkohol und Erbrochenem, die Kleidung war sandig und die Haare ganz verworren. Ich habe sie niemals zuvor in einem solchen Zustand gesehen, sie ist sonst ein sehr kontrollierter, fast schon zwanghafter Mensch. Na gut, sie IST zwanghaft. Natürlich habe ich nachgefragt, wollte unbedingt mit ihr reden. Doch sie hat komplett abgeblockt, wollte nur noch ins Bett. Und schon am nächsten Morgen war sie dann so komisch!«, schluchzte Meike. Dr. Berner griff nach Meikes Hand. »Gott, was hast du doch mit dem Mädel schon durchgemacht! So aus dem Stegreif würde ich sagen, es gibt zwei Möglichkeiten: entweder hat sie etwas derart Fürchterliches erlebt, dass sie nur noch den Ausweg des Suizid sah, der dann nachweislich schief ging; du sagst ja, sie roch nach Erbrochenem. Manchmal kommt es vor, dass in solchen Fällen der Magen die ganze Chemie und den Alkohol nicht verkraften kann, der potentielle Selbstmörder dann ständig erbricht. Ergo funktioniert es nicht, den Körper bis zum Eintreten des Todes zu vergiften. Wenn es so abgelaufen ist, muss diese Feststellung für Lena einer Katastrophe gleich gekommen sein. Stell dir vor, du willst sterben, und es klappt nicht!«
Nun war es um Meikes Selbstbeherrschung endgültig geschehen.
Sie weinte hemmungslos, quetschte mühsam ihre Begründung hervor: »Ja, sie war verzweifelt und ich war schuld! Sie hat mich wieder einmal danach gefragt, was ich über ihre verschwundene Mutter weiß. Ich habe abgewehrt, doch sie hat es dieses Mal nicht auf sich beruhen lassen. Ich wollte sie doch nur vor neuem Leid schützen! Wir stritten heftig, und auch Piet ist noch ziemlich mit ihr ins Gericht gegangen, bis sie seelisch nicht mehr konnte. Sie ist nicht konfliktfähig, und ich hätte das wissen müssen!«
Dr. Berner konnte nicht anders, er nahm die verzweifelte Meike in seine Arme, strich ihr über das hellbraune, gelockte Haar. Er versuchte zu ignorieren, wie gut sich das für ihn anfühlte; gleichzeitig wusste er, dass er von dieser Erinnerung lange zehren würde, auch wenn ihm dies bestimmt nicht gut tat. Gar nicht gut. Er seufzte.
»Meike, bitte glaube mir: du brauchst dir hierfür ganz bestimmt nicht die Schuld anzurechnen! Du hast so viel Geduld bewiesen in all den Jahren, so viel für Lena getan. In jeder Familie wird einmal gestritten, wobei dein Piet sich natürlich manchmal schon wie ein Elefant im Porzellanladen benimmt. Recht viel Einfühlungsvermögen hat er nicht, oder? Na, wie auch immer, es ist nun einmal passiert.«
»Heinrich? Du hast noch von einer zweiten Möglichkeit gesprochen …«
»Ja, genau, stimmt. Also, eventuell hat sie alles wieder erbrochen, noch bevor die Chemie allzu sehr wirken konnte. In diesem Fall wäre denkbar, dass sie aufgrund dieses neuerlichen Traumas quasi eine Persönlichkeitsveränderung durchgemacht hat, eine Art Schockreaktion. Manchmal ist so etwas nur zeitlich eingegrenzt, die Betroffenen werden wieder ganz die alten. Manchmal auch nicht, wenn sie denken, nichts mehr zu verlieren zu haben. Deine Lena ist von jeher eine Extremistin; bei solchen Charakteren steuert das Verhalten dann nach dem Trauma oft in genau die entgegengesetzte Richtung. Was ja geschehen ist. Nach dieser Phase pendelt es sich, falls wir Glück haben, irgendwann in der Mitte ein, zwischen diesen gegensätzlichen Polen ihres Verhaltens. Die zweite Möglichkeit wäre, dass sie noch mehr Tabletten mit sich geführt haben könnte. Wer garantiert uns, dass sie nicht doch mehr als diese eine Schachtel eingenommen hat? Sie könnte die Verpackungen weggeworfen haben. In diesem Fall wäre die Sache schlimmer, dieses Dreckszeug kann im Gehirn ganz schöne Schäden hinterlassen. Das wollen wir mal nicht hoffen!«
Meike klammerte sich an Dr. Heinrich Berner wie eine Ertrinkende, und dieser hielt sie allzu bereitwillig fest.
Dr. Berners Ausführungen hatten die Kindergärtnerin ganz schön erschreckt. Alles, bloß das nicht! Denn sie, Meike, rechnete sich nach wie vor die Schuld an Lenas Trauma an.
Weder der Arzt noch Meike hatte während dieser emotional aufgeladenen Unterredung bemerkt, dass sich ein Schlüssel im Türschloss der Eingangstüre drehte, diese nahezu geräuschlos aufgedrückt wurde. Anna Berner hatte an diesem Tag zufällig ihre Shoppingtour in der Nähe der Praxis ausklingen lassen und spontan beschlossen, ihren Mann direkt abzuholen, da er sonst wieder reichlich spät nach Hause kommen würde. Normalerweise war sie keine Frau, die leise Töne anschlug; so wollte sie zuerst mit der gewohnten Selbstsicherheit in die Praxis stolzieren. Allerdings hatte sie von draußen Stimmen wahrgenommen, wovon eine ihrem Heinrich gehörte, die andere einer Frau.
»Meike«, flüsterte er ihr schon fast zärtlich ins Ohr. »Es wird alles wieder gut, du wirst sehen. Wir kriegen das hin. Mir ist außerdem soeben eine dritte Möglichkeit eingefallen. Du hast mir doch mal ihre Mutter beschrieben, weißt du noch? Richtig sauer warst du, weil das so eine kalte, aufgedonnerte Schnepfe war, die mit dem Kind gar nichts anfangen konnte. Es wäre somit auch möglich, dass sie nun einfach wie ihre Mutter wird. Blut ist dicker als Wasser, sagt man!«
Mit tränennassen Augen sah Meike zu Dr. Berner auf, der sie um mehr als einen Kopf überragte. »Das würde mir aber auch nicht gefallen, Heinrich. Ich kenne und liebe sie so, wie sie war. Ich weiß ja, dass ich derzeit nichts machen kann, weil sie erwachsen ist. Handy besitzt sie keines, also kann ich sie nicht einmal anrufen. Keine Ahnung habe ich, wohin genau sie geflogen ist. Also kann ich nur abwarten. Darf ich mit ihr zu dir kommen, falls sie zurückkommt? Damit du sie dir einmal ansehen kannst?« Wieder brach Meike in Tränen aus.
»Selbstverständlich, Meike, was glaubst denn du!« Widerwillig löste sich Dr. Berner von Meike, sah ihr eindringlich in die Augen.
»Halte mich bitte auf dem Laufenden, ja? Ruf mich an, wenn du etwas von ihr gehört hast, dann überlegen wir gemeinsam, was zu tun ist.«
Die überaus blonde Frau draußen im Flur hatte bruchstückhaft genug gehört, vor allem aber eine nette Szene durch den Türspalt beobachtet. Sie würde jetzt bestimmt nicht nach Hause gehen, sondern schnurstracks zum Anwalt. Wütend rauschte Anna Berner das Treppenhaus hinunter. Flüsterte der doch dieser dicken Tussi etwas von einer »aufgedonnerten Schnepfe« ins Ohr! Na warte, der konnte etwas erleben!
Anna Berner wusste auch schon spontan, wie die kalt servierte Rache am süßesten schmecken würde. Dieser Don Juan konnte mit Unterhaltszahlungen bluten bis an sein Lebensende! Mit drei Kindern und Ehegattenunterhalt am Hals wäre sein Leben, wie er es gekannt hatte, wohl beendet. Pah, von wegen »hektischer Tag in der Praxis«! Nun endlich wusste Anna Berner, warum ihr Mann fast täglich so spät aus der Praxis gekommen war. Ausgerechnet diese plumpe Kindergärtnerin!
Und Meike Keller hätte beim Verlassen des Gebäudes schwören können, dass die Frau, die dort drüben auf der anderen Straßenseite schwungvoll in ihr Cabrio stieg, Anna Berner hieß. Sie war immer noch so schön, stellte Meike neidvoll fest.
* * *
»Nun erzähl mal, Lena. Was war denn gestern Abend mit dir los?« Yoli hatte Kaffee gekocht, Lena einen großen Pott des Muntermachers gereicht. Die saß am winzigen Küchentisch dieser winzigen Küche des winzigen Appartements, das Kellnerin Yoli in Rojales, einem winzigen Städtchen im Hinterland der Costa Blanca, alleine bewohnte. Lenas künstliche Selbstsicherheit war noch immer wie weggeblasen, still knubbelte sie an ihren Fingernägeln herum.
»Es geht schon wieder. In letzter Zeit war eben alles etwas viel für mich. Weißt du, ich hatte nicht gerade das lustigste Leben. Zuerst ließ mich meine Mutter einfach sitzen, da war ich knapp fünf Jahre alt. Die Kindergärtnerin hat mich adoptiert, mir aber niemals erzählt, wo Mama abgeblieben ist. Mein Stiefvater hat mich zwar akzeptiert, mehr aber auch nicht. Immer bekam ich überall Schwierigkeiten, niemand konnte mich so lieben, wie ich nun einmal war. Ich lese gerne, habe mich niemals viel mit anderen Menschen abgegeben, weil ich Angst vor Enttäuschung hatte. Tja. Und letzten Monat habe ich mit meinen Stiefeltern so sehr gestritten, dass ich dort nicht mehr bleiben mochte.«
Yoli hatte aufmerksam zugehört, eine zweifelnde Miene aufgesetzt. Was erzählte diese Touristin da? Lena und zurückgezogenes Leben?
»Und dann? Bist du erst einmal in Urlaub gefahren, damit die sich beruhigen?«
»Nein, nicht gleich. Eigentlich wollte ich Selbstmord begehen, das hat aber nicht funktioniert. Die Tabletten kotzte ich alle wieder aus. Da habe ich einen Neuanfang gemacht, eine vollkommen neue Lena wollte ich sein. Eine, die das Leben genießt, die so ist wie alle anderen auch. Außerdem wollte ich endlich einmal einen Freund haben, ich hatte mich aus lauter Angst immer von allen männlichen Wesen ferngehalten. War auch notwendig, ich hatte bisher nur totale Idioten kennen gelernt. Und bei der Party tauchte dann dieser Stephen auf. Er faszinierte mich, weil er intelligent und ehrlich wirkte. Diese grünen Augen … Was dann geschah, weißt du ja. Ihr dürftet es alle mitbekommen haben. Leider.« Lena lief vor lauter Scham rot an.
Yoli konnte es nicht fassen. »Du willst mir doch jetzt nicht allen Ernstes verklickern, das sei der erste Mann gewesen, mit dem du intim geworden bist? So, wie du den angemacht hast? Mein lieber Schwan, der hatte überhaupt keine Chance!«
Lena sah peinlich berührt aus. »Doch, so ist es. Was mag er von mir denken? Ich bin sonst nicht so, ganz und gar nicht. Vielleicht hatte dieser Joint auch auf mich eine komische Wirkung, Steve war doch am nächsten Tag ebenfalls ziemlich von der Rolle. Wer weiß, was da drin war. Außerdem habe ich mir wohl etwas vorgemacht. Stephen hat mich nur benutzt, war am nächsten Tag überhaupt nicht mehr an mir interessiert. Ich hatte doch so gehofft …«
»Na, du bist vielleicht gut! Glaubst du, mit jemandem mal eben in die Kiste steigen zu können und das war es dann? Nachher rettet dich dieser Ritter aus dem Turm und ihr lebt glücklich und zufrieden bis an euer Lebensende? Nö, da braucht es schon ein bisschen mehr! Gleich am ersten Abend so etwas, da reduzieren dich die Männer ganz schnell auf deinen Körper. Weißt du das denn nicht?«
»Nein, das wusste ich nicht«, bemerkte Lena kleinlaut. »Ich hatte mich mit Jungs doch noch gar nicht befasst, bin ihnen ausgewichen. Bevor ich abgeflogen bin, habe ich mir vorsichtshalber beim Frauenarzt die Pille verschreiben lassen, ganz blöd bin ich ja auch nicht. Die Sache mit den Bienen und Blumen war mir bekannt, falls du das als Nächstes fragen wolltest.« Lena sah ein bisschen beleidigt drein.
»Nein, entschuldige, Lena. Doch ich habe einfach noch niemals jemanden in deinem Alter kennen gelernt, der sich wie du verhielt und trotzdem noch … sag mal, warst du etwa vor dem Abend mit Stephen noch Jungfrau gewesen, falls ich derart Indiskretes fragen darf?« Yoli musterte ihr Gegenüber mit ihren großen, dunklen Augen. Dieses Mädchen war ihr ein Rätsel, so viel stand fest.
»Ja, du darfst. Denn ich muss dich auch gleich etwas fragen.« Lena stand auf und trat ans Fenster. Die Aussicht war nicht gerade atemberaubend, die Hauswand des nächsten Appartement-Blocks stand fast zum Greifen nah, war nur durch einen engen, dunklen Durchgang von diesem Gebäude getrennt. Warum wohnte Yoli eigentlich derart beengt? Hier in der Gegend gab es doch so schöne Häuschen und Wohnungen.
»Yoli? Glaubst du, man kann gleich beim ersten Mal schwanger werden? Ich hatte an dem Abend mit Stephen die Pille vergessen!
Und der machte dann obendrein auch noch die Bemerkung, dass ich das Kind »Jessica« nennen soll, falls es ein Mädchen wird!« Schwer ließ sich Lena wieder zurück auf den Küchenstuhl fallen, sah Yoli fragend an.
Die Angesprochene musste lachen. »Lena, du bist mir schon eine Marke! Um deine Frage zu beantworten: nein, das glaube ich nicht. Das wäre schon ein großer Zufall. Stephen hat bestimmt auch nur einen Scherz gemacht, Männer sind manchmal recht geschmacklos und halten sich für die Größten. Aber tu mir bitte einen Gefallen: sei künftig du selbst, dann kommen keine Missverständnisse auf. Ehrlich gesagt, mag ich dich heute Morgen viel besser leiden, seit du authentisch bist!«
Nun stahl sich auch auf Lenas Gesicht der Anflug eines Lächelns, das ihre bezaubernden Grübchen in die Mundwinkel malte.
»Ich danke dir, Yoli. Du bist eine echte Freundin! Darf ich dich noch etwas fragen?«
»¡Sí, claro!«
»Warum wohnst du denn in dieser Mini-Wohnung? Es gibt doch viel schönere in dieser Gegend, die auch gar nicht teuer sind, wie ich gesehen habe.«
Yolanda schmunzelte. Diese Lena hatte wirklich noch nie in ihrem Leben für sich selber sorgen müssen, geschweige denn, arbeiten. Sie wusste gar nicht, wie gut sie es im Grunde gehabt hatte. Doch diese Sichtweise behielt sie für sich. »Nun, dafür gibt es nur einen einzigen, aber sehr guten Grund: sie ist spottbillig! Ich spare, um mir meine Sprachkurse finanzieren zu können. Das Gehalt als Kellnerin ist nicht gerade fürstlich, aber so komme ich knapp zurecht.« Yoli deutete auf einen Stapel Bücher, der auf der Couch lag.
»Sprachkurse? Gleich mehrere? Wozu brauchst du die denn?« Lena hatte mitbekommen, dass Yoli durchaus in der Lage war, ihre Gäste in mehreren Sprachen willkommen zu heißen. Mehr brauchte es als Kellnerin doch gewiss nicht.
Als hätte Yoli ihre Gedanken gelesen, antwortete sie: »Ich will doch nicht ewig Kellnerin bleiben und mir die Hacken für einen Hungerlohn abrennen. Auch ich hätte gerne eine schöne Wohnung und ein Auto, das nicht erst nach gutem Zureden fährt, weißt du? Also bilde ich mich weiter, denn ich beabsichtige, einen Catering-Service zu eröffnen. So etwas, wie ich es probeweise bei der Party durchgezogen habe. Anstrengend, aber einträglich. Leider braucht man für alles auf dieser Welt erst einmal Kohle, die man sich mühsam verdienen muss!«
Lena hatte den Seitenhieb an ihre Adresse durchaus registriert, war aber nicht beleidigt. Ihr war soeben etwas eingefallen. Auch sie würde demnächst Geld brauchen, denn ihr Kontingent neigte sich seinem Ende zu.
»Yoli, ich hätte da eine Idee! Sieh mal, all die Sprachen willst du doch bestimmt lernen, damit du problemlos mit deiner künftigen internationalen Kundschaft verhandeln kannst, oder? Nun, ich war auf dem Gymnasium, spreche fließend Deutsch, Englisch und Französisch. Außerdem hatte ich Spanisch als Wahlfach belegt; du hörst ja, es geht recht gut. Da könnte ich doch für dich die Verhandlungen übernehmen, bis du so weit bist! Dann brauchst du derweil keine Kurse mehr zu bezahlen und kannst gleich mit dem Service anfangen! Und beim Kochen helfe ich dir auch, wenn du mir sagst, was ich tun soll, ebenso beim Bedienen. Was meinst du?« Das Leben war in Lena zurückgekehrt, sie war Feuer und Flamme für ihre Idee. Die veilchenblauen Augen strahlten nur so vor Begeisterung.
»DAS würdest du für mich tun?« Yoli war sprachlos.