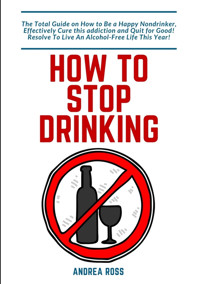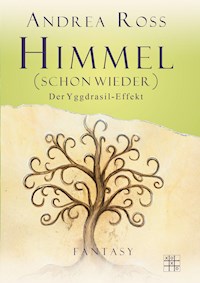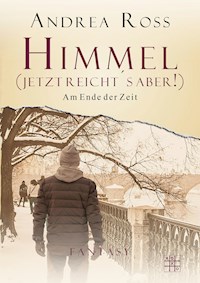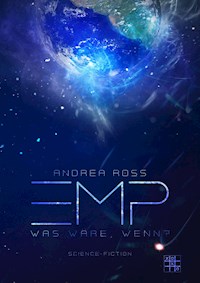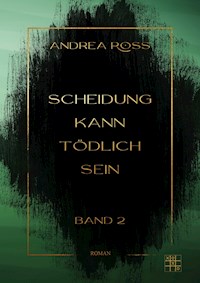
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Scheidungstrilogie
- Sprache: Deutsch
Ein pervertiertes Scheidungsverfahren hat das neu entstandene Paar Andrea und Attila an den Rand des Wahnsinns und aus ihrem Heimatland getrieben. In Spanien wollen sie endlich das sonnenreiche Leben genießen. Doch die Vergangenheit rückt immer wieder in den Mittelpunkt und löst schwere Konflikte aus. Beiden sehnen sie sich nach ihren Kindern. Erzählt aus dem Blickwinkel der neuen Partnerin
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrea Ross
Scheidung kann tödlich sein
Band II
XOXO Verlag
Dieser Band ist gewidmet
Herrn
Dr. Dr. Franz »Monaco Franze« Kreuter Bayreuth – Bad Berneck
einem hervorragenden Arzt weisen Philosophen ehrlichen Theologen und Schriftstellerkollegen
... einer schillernden Persönlichkeit, die ihresgleichen sucht nachträglich zum 70. Geburtstag in Dankbarkeit
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-039-2
E-Book-ISBN: 978-3-96752-539-7
Copyright (2019) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung: Grit Richter
Buchsatz: Alfons Th. Seeboth
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149
28237 Bremen
Rechtlicher Hinweis:
Sämtliche Personen, Orte und Begebenheiten rund um diesen Roman sind, abgesehen freilich von real existierenden Ortschaften, frei erfunden. Dasselbe gilt bezüglich der beschriebenen Vorgänge bei Behörden sowie anderen Institutionen oder Firmen. Eventuelle Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Menschen sowie deren Vereinigungen sind von der Autorin nicht beabsichtigt und wären daher rein zufällig. Selbstverständlich gilt letzteres nicht für ›Öffentliche Personen‹ aus der Politik.
Ein Hinweis vorab
Dieser Roman greift ein sensibles Thema unserer Zeit auf und hinterlässt die wohl berechtigte Frage, ob die Rechtsprechung in Familiensachen im Deutschland unserer Tage in ihrer Form noch aktuell sein kann. Ähnlichkeiten mit realen Personen sind nicht beabsichtigt, können wegen der Vielzahl so oder ähnlich abgelaufener Fälle jedoch neben autobiografischen Teilen dieses Werks wohl nicht vermieden werden, wobei auch bei diesen Teilen alle Namen geändert wurden.
Als Schauplatz der Handlung habe ich meine wirkliche Heimatstadt gewählt, doch hätte der Roman auch an jedem anderen Ort spielen können. Es ist nicht meine Absicht, diese Stadt zu verunglimpfen, aber ein wenig Satire wird sie sicherlich verkraften können.
Die Romanfiguren sind stellvertretend für bestimmte Persönlichkeitstypen zu sehen. Eine Verletzung von Persönlichkeitsrechten kann somit nicht eintreten.
Ich bedanke mich bei Freunden und Bekannten, die mir mit zahlreichen Fallschilderungen Anregungen zu diesem Buch gegeben haben.
Ihre Autorin
Was in Band 1 geschah
Andrea, die Erzählerin dieser Geschichte, wollte in ihrer Verzweiflung Selbstmord begehen. Sie verfasste einen sehr langen Abschiedsbrief, in dem sie die Geschichte erzählte, wie ihre Absicht langsam reifte. Warum sie ihr Leben nicht mehr ertragen konnte. So entstand dieses Buch. Folgende Ereignisse gingen diesem Band voran: Attila ist es leid, dass seine dritte Ehefrau Uschi ständig an ihm herumnörgelt. Entweder reicht ihr das Geld nicht, das sie mit beiden Händen ausgibt, oder er arbeitet zu viel in seinem Beruf als Programmierer. Immer, wie es ihr gerade passt. Das Paar hat drei Kinder: Solveig (11), Ronja (9) und Marco (7). Ihretwegen hält Attila durch, trennt sich viel zu lange nicht von seiner Familie. Er hat schon einmal ein Kind aufgeben müssen, nach seiner zweiten Ehe. Natascha ist jetzt 17, und er hat keinerlei Kontakt. Sie wurde vom neuen Ehemann seiner Exfrau Ina adoptiert.
Da Attila nach einer Firmenpleite mit seiner Spedition noch nicht selbst Inhaber seiner Software-GmbH sein darf, ist seine Frau als Geschäftsführerin eingetragen. Sie bezieht zwar ein fürstliches Gehalt, arbeitet jedoch nicht für die Firma. Trotzdem reichen ihr die Einkünfte ihres Mannes nicht, und Attila billigt um des lieben Friedens willen, dass seine Ehefrau mit der Zeit insgesamt 160.000 Euro darlehensweise aus der Firma zieht. Ihm bedeutet Geld nichts. Selbst zu arbeiten, das kommt für Uschi nicht in Frage. Zur ordnungsgemäßen Führung des Haushalts hat sie keine Lust, und Attila darf nicht einmal im Ehebett schlafen, muss wegen Schnarchen auf die Couch, in ein separates Zimmer. Das ist keine Ehe.
Im Jahre 2004 erträgt Attila die Situation nicht mehr. Uschi hat ihm angedroht, ihn mitsamt den Kindern zu verlassen. Den Gedanken, die Kinder zu verlieren, kann er nicht ertragen. So begeht er einen Selbstmordversuch, der trotz bombensicherer Vorbereitung jedoch misslingt. Zunächst scheint es, als sei Uschi aufgewacht: Sie geht mit ihm zu einer Eheberatung. Aber nach kurzer Zeit ist alles beim Alten, und Attila weiß, dass er diese Ehe weiterhin ertragen muss. Nach insgesamt 12 Ehejahren ist er wieder so weit und weiß: Entweder ich gehe oder ich unternehme den nächsten Selbstmordversuch.
Er entscheidet sich für Ersteres, außerdem hat Uschi bereits von sich aus die Scheidung eingereicht. Weil Attila die Scheidung aber so fair wie möglich durchziehen möchte und dabei niemanden verletzen will, nimmt er Kontakt zu Uschis Kusine Andrea auf, die seine Frau gut kennt. Diese schätzt er seit Jahren, hat mitunter bei Familientreffen gute Gespräche mit ihr geführt. Sie hatte ihm ihre Hilfe angeboten, falls er mit jemandem reden will, denn sie hat eine Ausbildung als Psychotherapeutin.
Die beiden treffen sich in einem Café, verbringen einen sehr angenehmen Nachmittag. Und sie verlieben sich, ohne dies je beabsichtigt zu haben. Jetzt haben die beiden erst recht ein Problem: Dies ist ein absolutes Tabu! Und auch Andrea ist noch in einer unglücklichen Ehe gefangen, hat ebenfalls drei Kinder: Ann (17), Axel (11) und Fredrik (4). In der Zwischenzeit ist Attilas älteste Tochter Solveig, 11, zu ihrem Vater gezogen. Die beiden wohnen in seinem Büro. Vorsichtig beginnen Attila und Andrea, seine Tochter und Andreas Restfamilie einander anzunähern. Andrea hat ihrem Mann Günther reinen Wein eingeschenkt, er ist nun ausgezogen. Dies ist für Andrea auch schon die dritte Ehe, die scheiterte. Zuvor war sie mit Klaus-Werner, dann mit Theo verheiratet.
Eines Tages muss Uschi von dieser neuen Liaison erfahren, Solveig ist die Überbringerin der Nachricht, weil sie ein Wochenende bei ihrer Mutter verbringt. Das ist der Auslöser für bodenlosen Hass, von diesem Moment an ist keine normale Kommunikation mit Uschi mehr möglich. Attila und Solveig ziehen in Andreas Reihenhaus, das sie mit ihren drei Kindern bewohnt. Zunächst scheint alles gut zu gehen. Die Kinder vertragen sich, auch wenn Attilas Kinder am Wochenende zusätzlich zu Besuch kommen.
Doch Andrea merkt, dass etwas nicht stimmt. Attilas Tochter ist ausgesprochen zickig, bekämpft sie, treibt ein hinterlistiges Spiel. Sie versucht, das Mädchen bei Laune zu halten, um Attila nicht zu verlieren. Dadurch fühlen sich wiederum Andreas Kinder zurückgesetzt, und der jetzt 12-jährige Axel zieht beleidigt zu seinem Vater, zu Andreas geschiedenem Ehemann Nr. 2, dem das nur recht ist, da er jetzt keinen Unterhalt mehr leisten muss. Währenddessen hetzt Uschi die Kinder gegen das neue Paar auf, begreift nicht, dass sie selbst es war, die Attila nur ausgenutzt und schließlich vertrieben hat. Sie stellt hohe Forderungen über Unterhalt, die Attila nicht bezahlen kann, meldet aber für sich selbst Privatinsolvenz an, um ihre Schulden bei der Firma nicht zurückzahlen zu müssen. Inzwischen ist Attila selbst Inhaber der GmbH. Das eifersüchtige Verhalten Solveigs wird immer extremer, Andrea hält es nicht mehr aus. Die Gesamtsituation ist nun für sie kaum mehr erträglich, denn sie weiß, dass sie zwischen allen Stühlen sitzt und Uschi vor allem ihretwegen diesen unerträglichen Hass schürt, unter dem so viele Menschen leiden müssen. Sich aufgrund dieser Umstände zu trennen, das kommt für Attila und Andrea nicht in Frage. Keiner kann sich vorstellen, ohne den anderen weiterleben zu können.
Gesprächsangebote von Attila lehnt Uschi kategorisch ab, stattdessen flattern ständig polemische Anwaltsschreiben ins Haus, die Uschi als armes Opfer darstellen. Die Fronten sind komplett verhärtet.
Nach den Sommerferien 2009 kommt Solveig nicht mehr zurück. Zusammen mit ihrer Mutter hat sie das Komplott geschmiedet, es dem Vati heimzuzahlen. Beim Jugendamt wird Attila hingestellt, als habe er die Kinder geschlagen, was dazu führt, dass ihm das Sorgerecht streitig gemacht wird. Vor Gericht glaubt man zunächst Uschis Darstellung, die auch zum Beginn des Trennungsjahres die Unwahrheit sagt. Attila ist entsetzt, erst jetzt den wahren Charakter seiner Noch-Ehefrau erkannt zu haben. Seine Tochter Solveig will keinen Kontakt mehr mit ihm haben. Uschi geht sogar mitsamt allen Kindern »taktisch« ins Frauenhaus, weil Attila angeblich brutal und unberechenbar ist.
Dabei hat sie ihn einmal mit einer Glasscherbe schwer verletzt, wodurch er immer noch Bewegungseinschränkungen hat.
Um Weihnachten 2009 herum fasst Andrea den Plan, Selbstmord zu begehen. Sie kann nicht mehr. Die Vorbereitungen sind getroffen, Attila ist nicht zu Hause. Er verbringt ein Wochenende mit seinen Kindern im Büro, damit nicht wieder Schwierigkeiten auftauchen. In letzter Minute taucht Attila auf, er hatte so eine Ahnung. Andrea fühlt, dass er sie wirklich liebt, kann es nicht tun. Allerdings liegen die Nerven derart blank, dass sie nun unter Panikattacken leidet.
Die folgenden Monate sind geprägt durch äußerst turbulente Ereignisse. Die Anwälte von Attila und Uschi duellieren sich, außerdem leiden Attilas Kinder sehr unter der Beeinflussung und dem Gezerre ihrer Eltern. Sie dürfen ihren Vater nicht mehr lieb haben, jedoch bekommt Attila immer wieder verzweifelte SMS, die das Gegenteil beweisen, auch gelegentlich Hilferufe seiner sensiblen Tochter Ronja, 9. Attila versucht, die elterliche Sorge zu bekommen, weil er um die seelische Gesundheit seiner Kinder fürchtet.
Seine Frau hat außerdem einer Freundin gegenüber behauptet, dass sie hoffe, Attila mache nie einen Vaterschaftstest. Das wäre nicht auszudenken ... So ist Attila gezwungen, genau solch einen Test durchführen zu lassen, er wird vom Gericht genehmigt. Es stellt sich heraus, dass er der Vater der Kinder ist und dass Uschi die Äußerung nur in böswilliger Absicht in den Raum gestellt hat. Dabei war es ihr egal, ob die Kinder davon versehentlich erfahren. Andrea liebt Attila über alles, erträgt den ganzen Wahnsinn ihm zuliebe und leidet. Mitunter führt die unsägliche Situation auch dazu, dass diese beiden trotz ihrer harmonischen Beziehung in Konflikt geraten. Zu präsent ist Attilas alte Familie im Leben des Paares.
Attila bekommt kein Sorgerecht, vielmehr erhält seine Ehefrau die alleinige Sorge für die medizinischen und schulischen Belange der Kinder, obwohl sie durch vielfältige Aktionen eigentlich bewiesen hat, dass sie dafür nicht verantwortungsvoll genug ist. Sie erzog die Kinder noch nie, stellte sie lieber mit Fernsehen ruhig,
förderte sie auch nicht in schulischer Hinsicht. Die düsteren Prognosen Attilas und Andreas bewahrheiten sich, als zwei von Attilas Kindern in die Psychiatrie des Bezirkskrankenhauses eingeliefert werden müssen, Ronja sogar ein halbes Jahr lang. Und Attila muss verzweifelt darum kämpfen, überhaupt die Diagnose zu erfahren. Die Situation ist nicht mehr zu ertragen. Inzwischen hat Uschi Andrea an ihrem Arbeitsplatz schlechtgemacht und ihre Tante Thea, Uschis Adoptivmutter, gegen sie aufgehetzt. Der Gerichtsvollzieher hat Attilas Konto eingefroren, obwohl Attila jetzt sämtliche Schulden aus der Ehezeit alleine abtragen muss. Uschi hetzt systematisch mit üblen Intrigen jeden auf, der Andrea und Attila kennt. Um es kurz zu machen: Es ereignen sich Dinge, mit denen zu Beginn des Scheidungsverfahrens niemand auch nur ansatzweise gerechnet hätte. Und die Behörden sehen zu, schieben einander die Verantwortung hin und her.
Schließlich sind sowohl Attila als auch Andrea in nervenärztlicher Behandlung, beide leiden unter Depressionen und müssen medikamentös behandelt werden. Anders ist für sie das Leben nicht mehr zu ertragen. Attila hat sich in Behandlung begeben, als er kurz vor einem Amoklauf stand. Spätestens jetzt ist klar: So kann es nicht weitergehen, sonst wird es am Ende noch Tote geben. Uschi unternimmt indessen alles, um nicht arbeiten gehen zu müssen. Sie lässt sich lieber ins soziale Netz fallen.
Die beiden Liebenden fassen einen kühnen Plan: Sie werden auswandern. Nach Spanien. Andrea wird ihren ohnehin ungeliebten Beruf als Beamtin aufgeben. Eine spanische Firma wird gegründet, die die GmbH ablösen soll. In der Hoffnung, dass sich die Situation dadurch entzerren wird, die Nerven sich mit der Zeit beruhigen. Auch die Lebenshaltung ist in Spanien günstiger, wird die beiden befähigen, den Kindesunterhalt für ihre insgesamt sechs Kinder zu leisten. Andrea und Attila wollen schon einmal dorthin fliegen, um sich ein Wohnbüro zu suchen ...
Kapitel I
Alles anders?
Attila und ich waren uns einig: Unser bisheriges Leben in Deutschland hatte ausgedient. Jetzt galt es, die Scherben aufzuklauben und etwas vollkommen Neues daraus zu basteln, das uns künftig Luft zum Atmen ließ. Selbst wenn unser neues Dasein nicht immer einfach werden würde, es fand immerhin unter der strahlenden Sonne Spaniens statt. Und vor allem: weit weg von Uschi!
Die Reise nach Spanien wurde zunächst ganz schön anstrengend. Wir fuhren am Dienstagabend nach einem langen Arbeitstag über vier Stunden lang zum Flughafen Frankfurt-Hahn, um dort das Auto auf einem Dauerparkplatz abzustellen. Dann war ein Fußmarsch zum Busbahnhof angesagt, weil die nahegelegenen Parkplätze sehr teuer waren. Es war eiskalt und windig, schnell waren wir durchgefroren, während wir auf den Shuttlebus warteten. Doch der würde erst in einer Stunde kommen. Nachdem wir schon eine halbe Stunde mit hochgestellten Jackenkragen frierend an der Bushaltestelle gesessen hatten, trafen wir einen eben gelandeten Teneriffa-Heimkehrer, der anregte, wir könnten genauso gut drüben im Terminal warten, weil sich davor eine zusätzliche Bushaltestelle befinde. Das taten wir dann erleichtert. Schließlich kam der Bus, der uns die lange Strecke zum Flughafen Frankfurt/Main beförderte. Wir versuchten, ein wenig zu dösen, was aber vor lauter Aufregung nicht so recht gelingen wollte. Attilas letzter Urlaub war 20 Jahre her gewesen, meiner noch länger. Gerädert stiegen wir aus dem Bus wieder in die Kälte und suchten das richtige Abflugterminal. Da wir noch Zeit hatten, konnten wir die Lebensgeister bei Starbucks mit einem Kaffee wieder etwas wecken. Dann unterzogen wir uns der üblichen Eincheckprozedur und saßen schließlich im Warteraum, bis unser Flug aufgerufen wurde.
Der Flug selber war recht kurz, dauerte nur knapp über zwei Stunden. Es gelang vor lauter Service und Verkaufsveranstaltungen kaum, im Flugzeug etwas Schlaf zu erwischen. So waren wir schon recht lädiert, als wir um 6.30 Uhr in Alicante landeten. Wir hatten seit über 48 Stunden keinen richtigen Schlaf mehr gehabt. Übernächtigt, aber glücklich verließen wir am »Aeropuerto« Alicante den Flieger und freuten uns, das uns lästig gewordene Leben in Deutschland hinter uns lassen zu können, auch wenn es nur für wenige Tage sein würde. Am Ausgang wollten wir uns mit Juan treffen, von dem wir lediglich wussten, dass er einen braunen Anzug tragen würde. Selbstverständlich liefen ab diesem Moment, da wir nach ihm Ausschau hielten, nur noch Leute mit braunen Anzügen durch die Gegend, doch keiner nahm Notiz von uns. So gingen wir nach draußen und begrüßten erst einmal die Palmen und das angenehme Klima, das trotz des bedeckten Himmels herrschte. Ich stellte erfreut fest, dass ich vieles aus der Unterhaltung der Taxifahrer auf Spanisch verstehen konnte. Da war das Lernen doch nicht umsonst gewesen. Aber bisher war kein Juan zu sehen. Schließlich steuerte ein wieselflinkes Kerlchen von ungefähr 1,60 m auf uns zu, Juan hatte auf der anderen Seite des Flughafengebäudes gewartet und uns erst jetzt gefunden. Lebhaft lotste er uns zu seinem schwarzen Opel Corsa und versprach, dass wir heute eine ganze Reihe von schönen Objekten ansehen würden. Ich hoffte nur, dass meine Augen lange genug offen bleiben würden, um sie auch alle wahrzunehmen. Wir verstanden uns auf Anhieb prima mit Juan, der uns gleich seine halbe Lebensgeschichte erzählte. Er war wie Attila jemand, der durch viele Widrigkeiten musste und trotzdem immer wieder auf die Füße fiel. Nicht aus Spanien kam er, sondern aus Kolumbien. Er hatte zahllose Berufe gehabt, konnte ebenfalls seine Töchter nach der Scheidung nicht sehen und vermittelte jetzt seit drei Jahren Immobilien.
Wir gingen im Städtchen Ciudad Quesada erst einmal mit ihm frühstücken. Die englische Kneipe hatte er ausgesucht, damit wir unseren in Deutschland üblichen Milchkaffee bekamen. Ach, wie ging uns das Herz auf, als wir feststellten, dass die Menschen dort ganz anders auf einen zugingen. Ob es nun Engländer oder Spanier oder Kolumbianer waren. Nicht die deutsche Muffigkeit, sondern Herzlichkeit. So verdrückten wir mit Juan zusammen ein leckeres Frühstück mit weißen Bohnen, ein Spezialrezept. Die Engländerin scherzte mit uns, als wären wir alte Freunde oder Stammgäste. Das fing schon einmal gut an, wir fühlten uns wohl. Erst recht, als die Rechnung kam. In Deutschland hätten wir das Doppelte bezahlt. Eine Tasse Kaffee für einen Euro, das hatten wir schon lange nicht mehr gesehen.
Und dann ging es los. Wir fuhren zum ersten Objekt, einem Reihenhaus. Das war nett, riss uns aber nicht vom Hocker. Trotzdem stellten wir schon fest, dass fast kein Häuschen dem anderen glich. Kein strikter, immer gleicher Baustil, sondern mal maurische Einflüsse, mal mit bunter Keramik, mal mit Türmchen oder als Rundbau. Herrlich für das Auge, wie sich das Weiß und Apricot und Türkis gegen den Himmel abhoben. Wir kamen mit dem Gucken gar nicht mehr nach.
Dann ging es nach La Mata. Juan warnte uns schon vor: ein Häuschen in Meeresnähe mit grandiosem Ausblick auf selbiges. Als wir nach La Mata hineinfuhren, war uns klar, dass uns der Ort alleine schon sehr gefiel. Er war an einen Hügel bis hinunter zum Meer gebaut, weiße Häuser reihten sich in Kaskaden anmutig aneinander. Als wir dann in die Siedlung einbogen, in der das zu besichtigende Haus stand, blieb uns schier der Atem weg. Wunderschöne Häuschen in hellem Orange, die wie in einer kleinen Burg abgetrennt von der Straße am Strand standen. Mit Pool und Tiefgarage. Und eines dieser Häuschen würden wir uns gleich ansehen.
Als wir das Reihenhaus betraten, fühlten wir uns drinnen auf Anhieb wohl. Nicht nur, dass es mit seinen hellen Steinfliesen und der schönen Einrichtung hübsch aussah, es war wie ein Gefühl des Nachhausekommens. Das Haus hatte im Erdgeschoss eine schöne große Terrasse und im 1. Stock einen Balkon. Wir verfielen in totale Begeisterung, als wir den Ausblick aufs Meer sahen. Wir konnten gar nicht glauben, dass dies die Wirklichkeit und für uns zum Greifen nahe war, in einem solchen Haus künftig leben zu dürfen. Für die halbe Miete, die wir bisher in Bayreuth zahlten. Der Ausblick von der riesigen Dachterrasse gab uns den Rest.
Auf einer Seite die weißen Häuserkaskaden und Palmen, auf der anderen der weiße Sandstrand und das Meer, das an diesem Tag eine türkisgrüne Farbe hatte. Wir konnten uns kaum losreißen von diesem Anblick und sagten zu Juan und Yvonne, die als Verwalterin die Schlüssel zu dem Haus gebracht hatte, dass es wohl schwer werden würde, dieses Haus noch zu toppen. Es würde auf jeden Fall in die nähere Auswahl kommen.
Wir sahen uns dann einige wirklich tolle Häuser in Los Montesinos in der Nähe der Salzseen und in Torrevieja an, die sehr schön lagen und auch teilweise toll eingerichtet waren. Auf der Fahrt unterhielten wir uns blendend mit Juan, stellten fest, dass er auch ein Skorpion war. Was für ein Wunder, diese Gattung verstand sich untereinander doch immer blendend. So war es vollkommen klar, warum wir uns blindlings für ihn entschieden hatten.
Zum Schluss sahen wir ein Haus, das uns die Entscheidung schwer machte. Es war etwas größer als das Reihenhaus in La Mata und freistehend. Außerdem hatte es einen Privatpool und eine ganz tolle Inneneinrichtung. Wir waren uns einig, dass die Entscheidung zwischen diesen beiden Objekten fallen würde. Juan erklärten wir, dass wir uns noch am selben Tag für eines der beiden Häuser entscheiden wollten. Wir überlegten, bis die Köpfe rauchten. In Los Montesinos hatte man Blick auf die Salzseen, doch zum Meer würde man mit dem Auto fahren müssen.
Wir fuhren mit Juan wieder zu den Engländern nach Quesada, um ein warmes Essen zu verdrücken. Wieder war die Rechnung überraschend niedrig. So viel zu den Lebenshaltungskosten an der Costa Blanca. Benzin rund 30 Cent pro Liter billiger, die Miete um die Hälfte, das Essen ebenfalls und dazu noch steuerliche Vorteile, wenn man dort eine Firma hatte, was ja bereits der Fall war. Die Tecnologia Anaconda SL musste nur noch vom Treuhänder auf mich umgeschrieben werden. Und zu all dem, quasi als Dreingabe, nette, offene Leute.
Juan musste tatsächlich den ganzen Tag für uns opfern, jedoch konnte er sich sicher sein, auch zu einem Abschluss zu kommen. Attila und ich waren uns schließlich einig, dass wir vom Gefühl her lieber in La Mata leben wollten. Erstens wegen der Nähe zum Meer und zweitens, weil dort das Leben tobte, das man aber hinter dem Tor auch aussperren konnte, wenn einem danach war. So teilten wir Juan mit, dass wir am liebsten noch heute den Mietvertrag hätten und dort einziehen wollten. Dieses Tempo konnte selbst einen Skorpion überraschen, und so musste er erst mit den Hausverwaltern Rücksprache halten, ob dies möglich sei. Diese waren sehr nette Holländer, die uns zusagten, den Vertrag für den nächsten Tag fertig zu machen. Wir würden somit nur eine Nacht im Hotel zubringen müssen und könnten dann am nächsten Tag gleich die Schlüssel zu »unserem« Haus erhalten.
Wir waren selig. Juan fuhr uns zu einem Hotel am Strand mit tollem Meerblick in dem Viertel, in dem auch unser Häuschen lag. So konnten wir dort schon einmal Probe wohnen. Das Hotel war für den Preis auch sehr schön. Wir tranken zum Abschluss des Tages noch einen Kaffee mit Juan im hoteleigenen Café. Am nächsten Tag wollte er uns dann zu den Hausverwaltern fahren, um den Vertrag abzuschließen.
Attila und ich beschlossen dann, uns den Strand anzusehen. In der Abenddämmerung machten wir einen langen Strandspaziergang, obwohl wir fix und fertig waren. Wir waren sehr zufrieden mit unserer Wahl und konnten kaum den nächsten Tag erwarten. Die Probleme aus Deutschland schienen schon ganz weit weg, so dass sie scheinbar gar nicht mehr belasten konnten. Jedenfalls schien das so. Dann waren wir so erledigt, dass wir nur noch wie Steine ins Bett fielen. Wir waren mit kurzen Dösunterbrechungen ja seit zwei Tagen nicht zum Schlafen gekommen und hatten dicke Augenringe.
In bester Laune wickelten wir am Donnerstag die Vertragsangelegenheiten ab und stellten erfreut fest, dass die Nebenkosten nur 60 Euro im Monat betrugen. Im Gegensatz zu 253 Euro in Deutschland. Dann setzte uns Juan bei unserem neuen Zuhause ab und versprach, am Abend noch auf ein Gläschen Wein vorbeizuschauen. Staunend und außerordentlich gut gelaunt gingen wir durch die Räume und waren glücklich. Wir hatten die richtige Wahl getroffen, da waren wir ganz sicher. Attila staunte immer wieder über den tollen Signalempfang für das Handy und das Internet, die UMTS-Verbindung hatten wir in Deutschland nicht. Und da glaubte man in Deutschland, die Spanier seien rückständig. Wir stellten fest, dass Torrevieja blitzsauber war, der Müll täglich abgeholt wurde, auch sonntags, und das gegen eine Minigebühr. Sie verfügten hier über eine tolle Infrastruktur, von der sich Deutschland eine Scheibe abschneiden konnte. Vom Klima gar nicht zu reden ... Man konnte Ende März im T-Shirt herumlaufen. Endlich fingen wir an, unsere eigene Zukunft zu zementieren. Ein gemeinsam ausgesuchtes Haus, ein gemeinsamer Auslandsaufenthalt und wieder einmal die Bestätigung, wie gut wir zusammenpassten. Es gelang uns, wieder zuversichtlicher in die Zukunft zu blicken. Deutschland musste nur noch abgewickelt werden, dann würden wir endgültig hierher zurückkehren. Diese Perspektive war mehr als erfreulich. Attila arbeitete zwischendurch etwas, aber das war auch nicht weiter belastend. Ich hatte ihn selten so gelöst und glücklich gesehen, er blühte richtig auf.
Dasselbe galt wohl für mich.
Am Abend kam Juan und erzählte noch weitere Geschichten aus seinem Leben, das in etwa so turbulent und oft auch unangenehm verlaufen war wie das unsere. Er plante, irgendwann nach Kolumbien zurückzukehren, auch wenn es ihm in Spanien durchaus gefiel. Er war schon ein netter, quirliger Kerl und obendrein zuverlässig.
Dann fing für uns ein gefühlter Kurzurlaub an. Wir schmiedeten Plänchen und unternahmen lange Spaziergänge, suchten einen nahegelegenen Supermarkt und freundeten uns mit den ersten Nachbarn an, die Engländer waren. Wir trafen keinen einzigen Menschen mit schlechter Laune, selbst auf der Straße kamen einem die Leute lächelnd entgegen. Und kreativ waren sie. Ein LKW, der einen Abhang nicht aus eigener Kraft den Hang hinaufkam, den schob mal eben ein Bagger mit der Schaufel hinauf. In Deutschland undenkbar; um Himmels willen, das könnte ja Lackschäden geben. Diese Mentalität lag uns, das war unübersehbar. Das Wetter erst recht, es war blitzblauer Himmel über unserer Siedlung zu sehen, das Meer hatte eine fast royalblaue Farbe.
Ich glaube, wir fühlten uns ein wenig wie die ehemaligen DDR-Bewohner, nachdem die Grenze geöffnet worden war. Da befand man sich plötzlich in Bereichen der Welt, die für einen vorher nicht wirklich erreichbar gewesen waren, auch wenn in unserem Fall die Mauer nur in unseren Köpfen bestanden hatte.
1989 – Der wilde Osten
Es war schon eine seltsame und nachhaltige Erfahrung, die ich mit meinen Eltern an einem sonnigen Sonntagnachmittag des Jahres 1973 machte. Mein Vater war auf die Idee gekommen, nach einigen Jahren wieder einmal in die Nähe der deutsch-deutschen Grenze zu fahren. Mir war dieses Thema der deutschen Teilung einschließlich Besatzung immer ein wenig unheimlich gewesen, besonders wenn die Nachrichten vermeldeten, dass an der Mauer wieder einmal jemand erschossen wurde. Beim besten Willen konnte ich mir keinen vernünftigen Grund vorstellen, warum jemand so etwas tat. Geschweige denn, einen Todesstreifen quer durch ein Land zu ziehen, der sogar Städte und Dörfer mitten hindurch in zwei Hälften teilte, Familien voneinander trennte.
Als wir unser Auto bestiegen, war mir einerseits etwas mulmig zumute, andererseits war ich echt gespannt, wie es dort an der Grenze überhaupt aussah. Normalerweise mieden die meisten Oberfranken die deprimierende Region bei den Wachtürmen, es sei denn, sie wohnten zufällig dort. Auf der Fahrt erzählten meine Eltern einige Details der Geschichte, die zur Teilung Deutschlands geführt hatte.
Der Blick aus dem Fenster verriet mir, dass sich bereits die Bauweise der Häuser veränderte. Hatten wir in Bayreuth hauptsächlich rote Ziegeldächer und farbige, freundliche Häuserfassaden, so duckten sich hier jenseits des Fichtelgebirges und des Frankenwaldes die Häuser düster zusammen, waren mit dunklen Schieferschindeln gedeckt und zum Teil auch noch damit verkleidet. Alles wirkte hier ein wenig unfreundlicher, ein wenig grauer, was zu den ohnehin schon dunklen Fichtenwäldern noch erschwerend hinzukam.
In einem Dorf namens Blechschmidtenhammer stiegen wir aus dem Auto, denn von hier aus konnte man die Grenze zu Fuß erreichen und auf die andere Seite hinübergucken. Da mein Papa sich überall bestens auskannte, weil er beim Straßenbauamt arbeitete, lotste er uns an eine Stelle, die die Teilung besonders unübersehbar machte. Mir lief ein Schauer den Rücken hinunter, als wir auf der aufgegebenen Bahnstrecke durch einen Tunnel wanderten. Dauernd fragte ich Papa, ob denn da wirklich kein Zug kommen könne. Er lachte, zeigte mir das meterhohe Unkraut. Nein, da sei schon sehr lange keiner mehr gefahren, die Schienen seien schon ganz verrostet. Das stimmte, trotzdem war mir komisch. Auch meine Mutter guckte betreten.
Kurz nach dem Verlassen des Tunnels wurde mir klar, warum diese Strecke für den Bahnverkehr tabu war: Sie endete genau an einem Zaun. Der Anblick war sehr merkwürdig, irgendwie nicht logisch. Erstaunt stellte ich beim Blick durch den hohen Zaun fest, dass dort drüben in der DDR die gleichen Häuser standen, sich nichts wirklich vom Westen unterschied. Das hatte ich mir anders vorgestellt, war doch immer die Rede von einem totalitären Regime und von eingesperrten Menschen, die nicht herüberkommen durften, sich dafür aber gegenseitig bespitzelten. Von einem Eisernen Vorhang. Und jetzt sah ich da drüben jenseits des Flusses ganz einfach ein normales Dorf, und ganz normale Leute winkten uns von dort freundlich zu. Keine Monster.
Ich wurde nachdenklich. Warum durften die denn nicht zu uns herüber und wir nur mit Schwierigkeiten dorthin? Wieso brauchte es den großen, grauen Wachturm und den Stacheldraht, als wäre hier die Welt zu Ende? Ich kannte die Geschichte dazu, doch wirklich verstehen konnte ich sie nicht.
Das änderte sich auch in den folgenden Jahren nicht, und so fahre ich noch heute mit einem leichten Schaudern zusammen mit meinem Mann Klaus-Werner ins Grenzgebiet. Dort, in der Nähe des Grenzüberganges Töpen, wohnen unsere besten Freunde, die unser Modellbahnhobby teilen.
Heute sind wir wieder einmal dorthin gefahren. Angeregt unterhalten wir uns über unsere neuesten Modellbahnerfolge, während so nebenbei der Fernseher läuft. Am Rande bekommen wir mit, dass sich nun endgültig etwas getan hat in der DDR – die Leute scheinen ausreisen zu dürfen. Wir können es gar nicht recht glauben, denn wir kannten Deutschland ja bisher wirklich nur in geteiltem Zustand. So registrieren wir diese Nachricht zwar, denken aber mit keiner Gedankenfaser an die damit verbundenen Folgen. Wir besprechen lieber, wie der Hintergrund der Modellbahnanlagen plastisch und damit realistisch zu gestalten sei und welche Arbeit es macht, wenn man eine Oberleitung installiert, um auch E-Loks fahren zu lassen. Kurz nach Mitternacht verabschieden wir uns von Jörg und Uta, wollen nach Hause fahren und ins Bett. Morgen früh würde wie immer Klaus-Werners Mutter unten lärmen, die Frühaufsteherin ist und im selben Haus wohnt. Schon beim Einbiegen auf die Landstraße merken wir, dass wir so schnell wohl nicht zu Hause in Gefrees eintreffen werden, denn lange Autokolonnen schieben sich über die sonst verschlafenen, halb verfallenen Sträßchen. Im ersten Moment kann ich mir gar keinen vernünftigen Grund vorstellen, was die ganzen Autos hier wollen. Doch dann trifft mich blitzartig die Erkenntnis: Klar, die DDR hat wirklich aufgemacht! Denn das, was sich hier stinkend und pötternd über die Straßen schiebt, sind Wartburgs und Trabis. Viele mit offenen
Fenstern, Fahnen schwenkend und in Jubelstimmung.
Na so was. Ich sehe es und kann es dennoch immer noch fast nicht glauben. Wir fahren mit in diesem Autokorso des Glücks, kommen nach Stunden irgendwann geschafft in Gefrees an, denn alle Straßen sind hoffnungslos verstopft. Auch in Gefrees herrscht trotz der vorgerückten Stunde eine Art Volksfeststimmung. Teile der Bevölkerung stehen erfreut winkend am Straßenrand, während der andere Teil ob der ungewohnten Invasion ängstlich hinter der Gardine hervorlugt.
Die nächsten Tage sind eigentlich richtig lustig. Überall sind die Bananen und die anderen Südfrüchte ausverkauft, denn die Neuankömmlinge stürzen sich mit Begeisterung auf alles, was sie von »drüben« nicht kennen oder was es viel zu selten gab in der Planwirtschaft. Man amüsiert sich darüber, dass die Leute noch immer die Mode aus den 70ern oder frühen 80ern tragen, einschließlich der einstmals beliebten »Vokuhila«-Frisuren. Die Jugend trägt »Moonwashed«-Jeans, im Westen längst ein »NoGo«, genau wie die ebenso noch getragenen »Minipli«-Frisuren. Man beschnüffelt sich gegenseitig, und so mancher bekommt Angst vor einer Heimsuchung durch die lange nicht gesehene Verwandtschaft, die kurz hinter der Grenze wohnt und nun garantiert das dringende Bedürfnis hegt, unangemeldet einzufallen. Sag mal, Schorsch, wie viele Kinder haben die jetzt eigentlich? Bringen wir die alle in unserem Gartenhäuschen unter, oder wie? Ich freue mich für die Leute, auch wenn deren unverhofftes Glück für mich Überstunden bei der Verwaltung bedeutet. Irgendwer muss schließlich das Begrüßungsgeld auszahlen, den Hunderter, den jeder »Ossi« nun zur Feier der Stunde bekommt. Manche auch mehrmals, denn die Registrierung ist schwierig und der Ansturm zu groß, um sich jedes einzelne Gesicht merken zu können. Ich freue mich auch für ein paar Südfruchtstandbesitzer, die sich jahrelang am Rande der Firmenpleite bewegten, um nun einen beispiellosen Boom zu erleben, der sie auf der Stelle finanziell saniert.
Nach ein paar Wochen lässt die Begeisterung der westlichen Grenzlandbevölkerung langsam etwas nach. Die einen ächzen unter dem Dauerbesuch der tatsächlich aufgetauchten Verwandtschaft, die anderen brauchen zum Einkaufen und für den Weg zur Arbeit viel mehr Zeit als bisher. Einkaufsmärkte und Straßen sind nach wie vor proppenvoll, stellenweise gibt es mittlerweile so etwas wie Versorgungsengpässe, vor allem bei Bananen oder Fernsehern. Die Ersten werden neidisch, dass die Ossis Geld geschenkt bekommen, für das sie keine Steuern bezahlt haben. Ja, der Mensch ist eben in erster Linie Egoist und damit sich selber der Nächste.
Ich freue mich nach wie vor für die Menschen, kann mir vorstellen, was das Großereignis Freiheit für sie bedeuten mag. Allerdings habe ich hie und da schon in sächsischem Dialekt mitbekommen, dass die Ersten überlegen, welche einzelnen Punkte »drüben« doch vielleicht besser gewesen waren als hier im Kapitalismus. Ihren Hunderter hauen sie natürlich trotzdem auf den Kopf, aber irgendwie kurbelt das ja auch wieder die Wirtschaft an, so denke ich mir.
Nervig finde ich nur den Weg von und zur Arbeit, ich muss täglich 30 km nach Bayreuth und zurück fahren. Während mein schneller Honda Prelude früher höchstens 15 Minuten für diese Strecke gebraucht hat, bin ich jetzt nicht selten zwei und mehr Stunden unterwegs, weil es wieder einmal gekracht hat und alle Umleitungsstrecken ebenfalls dicht sind. Meist musste gar kein Unfall der Grund für die Verzögerungen sein, es reichen auch ein paar rauchend liegengebliebene Trabis, die wir schon abwertend Plasteschaukeln nennen. Bis ich auf der Arbeit ankomme, ist der offizielle Dienstbeginn oft schon lange vorüber, und ich bekomme Ärger. Am Abend falle ich zu Hause mehr tot als lebendig auf die Couch, denn der stundenlange Stopand-go-Verkehr mit ständiger Auffahrgefahr ist nicht eben lustig. Na gut, dann fahre ich morgen früh eben schon um 5 Uhr weg, sonst komme ich am Ende wieder zu spät.
Gestern war ein besonders übler Tag. Erst hatte ich ziemlichen Stress auf der Arbeit, dann knallte mir auf der überfüllten Autobahn auch noch ein Fernseher vor meinem Fahrzeug auf die Fahrbahn. Meine unabwendbare Vollbremsung hätte mir beinahe einen im Kofferraum hängenden Trabi beschert, es ging nur um Millimeter. Weiter hinten hingegen hörte ich es krachen, die dortigen Autos konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen. Schon lange habe ich auf so was gewartet, denn die Ex-DDR-Bürger kaufen viele und große Sachen ein, die dann, oh Wunder, nicht in die Plasteschaukel passen. Da der Ossi an sich aber recht praktisch orientiert ist – er musste da drüben ja viel selber machen –, weiß er sich zu helfen. Und so bindet er schon mal einen riesigen Röhrenfernseher mit Stricken durch die geöffneten Fenster auf sein Autodach, um damit glücklich gen Bitterfeld zu schleichen. Bis zu einer stärkeren Bremsung. Da nämlich verbünden sich die Gesetze der Flie-hund Schwerkraft gleichermaßen gegen den Trabi-Besitzer, und das wertvolle Gut kracht vom Autodach. Ich unterdrücke meine aufkommenden Aggressionen, freue mich über mein heiles Auto und komme wieder einmal völlig fertig nach Hause. Klaus-Werner hat es gut, der braucht nur zu Fuß über die Straße zu gehen, wenn er heimwill. Er hat somit kaum Verständnis, dass ich abends erst sehr spät das Essen koche, wenn ihm schon lange gehörig der Magen knurrt. So muss ich mir von ihm auch noch Vorwürfe und Gemecker anhören, bevor ich endlich in mein Bett durfte. Die Videofilme, die ich für KlausWerner auf seinen Wunsch in der Mittagspause in Bayreuth noch ausgeliehen habe, sieht er sich alleine an. Ich kann nicht mehr.
So bin ich heute Morgen noch nicht richtig fit, als ich mich aus den Kissen schäle und im Bad versuche, die Augenringe zu bekämpfen. Es ist 4.30 Uhr, ein Mittwoch. Mittwochs haben wir länger geöffnet, so muss ich bis 18 Uhr Dienst schieben. Mir graut jetzt schon, um 5 muss ich los, weil ich ja wieder Stunden brauchen werde, bis ich meinen Arbeitsplatz erreiche. Dann mittags schnell die Videofilme wegbringen, weiterarbeiten bis Dienstende und zum Schluss über die vollgestopfte Autobahn quälen. Der Tag verspricht lustig zu werden.
Er hält sein Versprechen. Und wie. Ich brauche an diesem Tag drei Stunden und 5 Minuten, bis ich völlig entnervt und fluchend fünf Minuten zu spät auf der Arbeit erscheine und mir wieder einen verbalen Einlauf vom Chef abholen darf. Vor meiner Türe warten bereits Leute, die ungeduldig von einem Fuß auf den anderen treten, weil sie unbedingt einen Führerschein wollen. Das geht bis Mittag so: Beschwerden, Anträge, Telefonate. Dazu meine Kollegen, die dauernd ratlos fragen, ob man einen völlig unleserlichen DDR-Führerschein, genannt »Lappen«, umschreiben kann oder was man da macht. Als ich mittags die Türe absperren darf, will ich nur noch eines: kurz die Augen zumachen, etwas essen und das Telefon aushängen. Mittagspause eben. Da fällt mir ein, dass die blöden Videofilme ja noch zurück in die Videothek im Industriegebiet müssen. So ein Mist, der Klaus-Werner tut sich leicht. Der guckt nur, und ich habe die Umstände.
Es kommt anders. Als ich eben das Bürogebäude verlassen will, steht ein verzweifelter Bürger vor der Türe. Er ist ein echter Problemfall, und ich muss ihm gleich mit einem vorläufigen Führerschein helfen, denn die Polizei wird nicht länger warten. Er bekommt sonst Ärger. Also werfe ich im Büro die Filme zurück auf den Schreibtisch, gebe dem Mann, was er braucht. Die Mittagspause hat sich damit durch Zeitablauf erledigt.
Schon wieder bilden sich draußen vor meiner Türe lange Schlangen. Seitdem die Grenze offen ist, müssen wir reihenweise Ostführerscheine in Westmuster umtauschen. So arbeite ich im Akkord, über den Dienstschluss um 18 Uhr hinaus, denn der Letzte in der Schlange verlässt erst um 18.45 Uhr mein Büro. Zudem ist Vorweihnachtszeit, die Leute sind alle nervös und hektisch, gehen mir heute besonders übel auf die Nerven. Schnee ist gemeldet, hoffentlich verwandelt der nicht auch noch die Straßen in Rutschbahnen. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie die abgefahrenen Trabi-Reifen darauf reagieren würden.
Uff. Jetzt schnell ins Industriegebiet, die Filme weg und heim. Ich mag nicht mehr, habe Hunger und bin erledigt wie ein Marathonläufer. Schon wenige Meter, nachdem ich mich vom Amtsparkplatz heruntergehangelt habe, schwant mir etwas: Wenn schon die Kulmbacher Straße verstopft ist und nur wenige Fahrzeuge bei Grün über die Ampel kommen, wie sieht dann der Hohenzollernring aus? Genau. Bayreuths Lebensader ächzt unter einer ungewohnten Fahrzeuglast aus Berufsverkehr und Ostbesuchern, die allesamt noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen. Und das kann man speziell in diesem Jahr keinesfalls »daheeme« in der Zone kaufen. In diesem Moment hält sich mein persönliches Verständnis für diesen Umstand in sehr engen Grenzen, denn ich brauche bis zum Industriegebiet eine geschlagene Stunde. Auch dieses gleicht mehr einem Festivalgelände im Ausnahmezustand denn einer Einkaufsmeile.
Als die verdammten Filme endlich abgegeben sind und ich Klaus-Werner mindestens fünfmal verflucht habe, dass ich wegen seines Vergnügens den Umweg in Kauf nehmen musste, beruhige ich mich wieder etwas. Jetzt bin ich ja gleich auf der Autobahn und kann heimfahren. Noch durch einen Kreisel quälen, dann kann ich endlich durchstarten. Der Verkehr auf der Autobahn rollt einigermaßen zügig, das konnte ich von der Brücke aus schon erkennen. Wenigstens bis zu den neuralgischen Punkten, den Bergauffahrten, denn die machen den Plastebombern schwer zu schaffen.
Da, endlich, die Autobahnauffahrt! Ich atme durch, gebe Gas, nehme aus dem Augenwinkel noch den Anhalter wahr, der mit einem selbstgepinselten Schild am Straßenrand steht. Nach Halle möchte er, doch ich bin als Frau alleine im Auto, es ist dunkel und der Typ sieht nicht gerade Vertrauen erweckend aus. Somit gebe ich weiter Gas. Im nächsten Moment habe ich die Schrecksekunde meines Lebens, trete mit beiden Füßen aufs Bremspedal. Mein Herzschlag pocht in den Ohren, das Adrenalin ist auf nie gekanntem Höchststand. Instinktiv warte ich auf den Knall hinter mir, der signalisieren wird, dass mein Kofferraum nicht mehr existiert. Der bleibt aus, der Autofahrer hinter mir ist geistesgegenwärtig etwas zur Seite gezogen, konnte dort rechtzeitig bremsen. Es lebe der Sicherheitsabstand. Immer noch steigt das Adrenalin, bis unter die Schädeldecke. Wütend springe ich aus dem Fahrzeug, meine Müdigkeit ist wie weggeblasen. Ich packe den Vollidioten mit dem Pappschild, der nur Zentimeter vor meiner vorderen Stoßstange steht, am Kragen, bis die Knöchel meiner Hand unter der Haut weiß hervortreten. Ich frage ihn mit vor Wut und Entsetzen entstellter Stimme, was er sich dabei gedacht hat, mir einfach vor das Auto zu springen.
Entweder ist der Typ vollgekifft, besoffen oder einfach nur bescheuert. Denn ich bekomme zur Auskunft: »Anders haltet ihr Wessis ja nicht an, wenn man mal mitfahren will.« Der hat gar nicht realisiert, dass er soeben fast zu Brei gefahren worden wäre. Denken kann ich nun gar nicht mehr, der Schock wandelt sich blitzartig zu Wut. Noch immer halte ich den Kerl am Kragen fest, nehme gar nicht wahr, dass ich mit der Rechten aushole, eine Faust bilde und ihm volle Kanne eine ballere. Ich habe einen roten Film vor Augen, der erst nach dem Schlag nachlässt. Meine Wut wandelt sich nun in einen Riesenschreck, als ich den Anhalter mit blutendem Mund im Straßengraben sitzen sehe. Mein Fluchtreflex meldet sich, ich springe ins Auto und fahre mit quietschenden Reifen auf die Autobahn.
Ich habe keine, wirklich keine Ahnung, wie ich nach Hause gefahren bin. Als ich mit meinem Honda daheim auf dem Hof stehe, betrachte ich meine schmerzende, abgeschürfte rechte Hand und weiß nur eines: Ich habe etwas getan, was man nicht tun sollte. Schon gar nicht als Beamtin, die in einer Fahrerlaubnisbehörde arbeitet. Ich bekomme das Genörgel von Klaus-Werner über meine späte Heimkehr gar nicht mit, denn nun überschlagen sich die Gedanken in meinem Kopf. Was, wenn sich der Typ meine Autonummer gemerkt hat? Oder der Autofahrer hinter mir, wo war der dann nach der Bremsung eigentlich abgeblieben? Würde der jetzt dem Ossi helfen, mich zu verklagen? Und was genau hatte der Typ eigentlich an Verletzungen abbekommen? Er hatte aus dem Mund geblutet, und nach den Schmerzen in meiner Hand konnte es durchaus sein, dass er Zähne eingebüßt hat. Ich trage schließlich Ringe und ich hatte zum Schlag voll aufgezogen. Scheiße, keine dieser Fragen kann ich beantworten, und so steht mir eine Zeit voll ängstlicher Ungewissheit ins Haus. Nervös renne ich täglich zum Briefkasten, ständig in Sorge, ob dieser vielleicht eine polizeiliche Vorladung, eine horrende Zahnarztrechnung oder gar einen Strafbefehl enthalten könnte. Ich bin jedes Mal selig, wenn nichts dergleichen ankommt.
Und trotzdem – hat mich nicht der Chef heute seltsam angesehen? Wird er mich demnächst in sein Büro zitieren und mir erklären, dass »so eine« als Beamtin nicht taugt? Eine Führerscheinsachbearbeiterin, die unschuldige Verkehrsteilnehmer schlägt, die nur zu Weihnachten heim in den Osten wollen? Auweia. Das Ganze versaut mir glatt Weihnachten und Silvester zusammen. Auf Klaus-Werner bin ich leicht sauer, denn der hat sich über die Geschichte köstlich amüsiert. Aber was soll ich denn machen? Ich kann mich nicht einmal bei dem Ossi entschuldigen, habe keine Ahnung, wer er ist.
Jetzt haben wir Februar, und nichts ist passiert. Langsam entspanne ich mich, vielleicht geschieht ja doch nichts. Vielleicht war es dem Typen einfach auch peinlich, dass er von einem Mädel geschlagen worden ist. Wer weiß das schon. Am wahrscheinlichsten aber ist, dass ich einfach zu schnell weg war, bevor er überhaupt wieder wusste, wie er heißt und warum er hier sitzt.
Wie auch immer – ich bin erst einmal gerettet. Das glaube ich wenigstens. Und ich nehme mir vor, so etwas auch unter höchster Anspannung nie wieder zu tun. Nie wieder, auch wenn sämtliche Ossis auf einen Schlag die Straße verstopfen sollten. Wobei, es wird etwas besser in letzter Zeit. Mal sehen, vielleicht gehe ich ja drüben meinerseits mal die Straße verstopfen. Ich möchte auch gucken, wie die da in der ehemaligen Zone so leben.
* * *
Erstaunlicherweise hatte keiner von uns während des Spanienaufenthaltes Magenoder Darmprobleme, wie sie in Deutschland schon zur Normalität gehört hatten. Auch meine sonst von Ausschlägen gepeinigte Haut wurde innerhalb kürzester Zeit wesentlich besser. Wir hatten viel Bewegung und fühlten uns rundum klasse.
Am Samstag liefen wir am Strand entlang bis nach Torrevieja hinein, insgesamt dauerte der »Spaziergang« vier Stunden. Vorbei an Grundstücken, von denen eines schöner als das andere war. Neben Träumen aus »1001 Nacht« existierten Parks mit Palmen, Villen oder ganz kleine Häuschen. Alles top hergerichtet und sauber. Vor einem Supermarkt ließen wir uns mit Getränken nieder und ließen einfach alles auf uns wirken. Wie zwei Aussteiger, die gleich auf ihre Harley steigen. Attila weigerte sich mittlerweile, Schuhwerk zu tragen. Er war eben am liebsten barfuß und konnte dies dort auch endlich sein, ohne zu erfrieren. In einem Café ließen wir den Ausflug ausklingen, zahlten wieder nur einen Euro pro Kaffee und trafen nette Menschen. Na so was, es war ja anscheinend doch nicht die ganze Menschheit entartet. Wir konnten uns jetzt langsam denken, warum früher die Menschen jenseits der Alpen als »Barbarenvölker« galten.
Der schlimmste Gedanke war nun der an den Heimflug. Wir fühlten uns schon so zu Hause, dass wir uns fragten, was wir denn eigentlich in Deutschland noch sollten. Am Sonntagmorgen unternahmen wir unseren letzten Strandspaziergang, da bereits in deutlich gedrückterer Stimmung. Keiner von uns wollte hier wieder weg und sich erneut dem ganzen Mist aussetzen, der uns zweifellos erwarten würde. Ganz zu schweigen von den drohenden Angriffen von Leuten, die uns unser neues Leben nicht gönnen würden, auch wenn wir Kosten sparten und uns damit die Unterhaltszahlungen möglich wären. Neid und Missgunst waren eben Charaktereigenschaften, mit denen wir ständig zu rechnen hatten. Jetzt erst recht. Wir fuhren mit dem Taxi zum Flughafen und sahen noch einmal die schöne Gegend, in der wir uns nun niedergelassen hatten. Die Ryanair sorgte während des Fluges für ständige Abwechslung und am Abend landeten wir im kalten FrankfurtHahn. Durch eiskalten Wind kämpften wir uns zum Auto und wollten nur noch eines: zurück. Heim nach La Mata. Doch das ging leider nicht. Auf dem Heimweg planten wir, noch Attilas Kollegen Jürgen zu besuchen, der in ein Bauernhaus irgendwo bei Aschaffenburg gezogen war.
Die Adresse klang sehr abgelegen und ländlich, daher schalteten wir vorsichtshalber das Navi ein. Aber dass nicht einmal das Navi in der Lage sein würde, den Waldhof in Schaafheim zu finden, das hätten wir nicht erwartet. Wir gurkten mitten in der Nacht auf Feldwegen herum, während uns ständig Feldhasen vor das Auto hoppelten. Wir mussten also Jürgen anrufen und nochmal nachfragen. Und tatsächlich – geteerter Feldweg, mehr führte nicht zum Haus, das irgendwo mitten in der Prärie lag. Als wir endlich dort ankamen, waren wir erstaunt. Zum einen, wie man so abgelegen wohnen konnte. Zum anderen, wie toll das ehemalige Bauernhaus von Jürgen in Eigenleistung ausgebaut worden war. Wir tranken einen Kaffee mit ihm und erzählten über unseren neuen Wohnort. Jürgen fand unsere Idee gut. Die Heimfahrt wurde dann recht anstrengend, wir hatten ja noch eine lange Strecke vor uns. Gegen das Einschlafen fütterte ich Attila mit Käse aus Spanien, den wir mitgenommen hatten.
Am Tag danach herrschte bei uns Katzenjammer. Dass wir uns furchtbar lieb und nun auch eine Perspektive hatten, war total positiv. Aber der Rest ... Schnell fiel uns wieder die deutsche Engstirnigkeit auf und wurde zur Qual. Wir blickten in verkniffene oder leere Gesichter, alle anderen waren eher die Ausnahme. Die Häuser wirkten langweilig, der Alltag war nervig. Wir fühlten uns schon jetzt nicht mehr wohl und wollten alles daran setzen, so schnell wie möglich verschwinden zu können. Bei mir zu Hause klingelte ständig das Telefon, meine Mutter wollte ihre Ostergeschenkchen für die Kinder loswerden, und mein Chef hatte auch versucht, mich zu erreichen. So telefonierte ich pflichtschuldig alle ab. Ann hatte es natürlich nicht für notwendig befunden, in der Zwischenzeit ihren Krempel abzuholen.
Die Karten mussten nun auf den Tisch. So ließ ich schon mal vorsichtig bei meinem Chef anklingen, dass ich noch immer nicht voll einsatzfähig sei und er im Übrigen mit mir für Artis Stelle nicht zu rechnen brauche, da ich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit die Verwaltung verlassen würde. Er wusste erst gar nicht, was er sagen sollte, war schlichtweg sprachlos. Vielleicht hielt er es auch für eine momentane Laune, die ich mir schon noch überlegen würde. Von ihm war jedenfalls zu erfahren, dass er meinen alten Urlaub übertragen lassen wolle und dass Arti schon wieder seit Wochen krank sei. Einen Pilz habe er sich eingefangen und danach fahre er sowieso auf Kur. Wenn man bedachte, dass er auch noch Anspruch auf seinen Jahresurlaub 2010 habe, dann werde der vor seiner Pensionierung so gut wie gar nicht mehr auftauchen. Das bedeutete für mich Dauervertretung, sobald ich wieder einen Fuß ins Amt setzte. Womöglich zusätzlich noch im Vorzimmer.
Früher hätte ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Schließlich war ich krankgeschrieben und war trotzdem nach Spanien geflogen. Heute aber fand ich das nicht unfair, erstens wegen des Verhaltens der Kollegen und zweitens, weil der »Kuraufenthalt« in La Mata eindeutig meiner Gesundung gedient hatte. Und wie. Auch Attila hatte wieder mit den üblichen Torturen zu rechnen.
Es ging schon wieder hin und her wegen der leidigen Darlehensgeschichte, natürlich wurde nun Attila beschuldigt, er habe doch genau Bescheid gewusst und daher das »Darlehen« mutwillig als solches deklariert und damit Kosten verursacht. Über 700 Euro wollte der Anwalt für seine Vertretung von ihm haben, und Attila wollte nur noch eines: weg.
Ich auch. So schrieb ich am Abend meinen Antrag auf Entlassung aus den Diensten des Amtes in Bayreuth fertig, wohl wissend, welche Folgen dies haben würde. Adieu Sicherheit. Hallo Leben. Attila hatte schon Bedenken, ob ich diesen weitreichenden Schritt wirklich von mir aus wollen würde. Aber ja, ich wollte. Schon so lange. Auch, falls dies in einem finanziellen Desaster enden würde. Denn besser pleite und echtes Leben, als in Gefangenschaft dahinzuvegetieren. Ja, ich würde meine Kanonenkugel am Bein abstreifen und endlich frei herumlaufen. Mit meinem geliebten Attila, zusammen würden wir durch alle Unebenheiten schon durchkommen. Und zwar unter der Sonne Spaniens. Hoffentlich würde die Behörde zustimmen, dass ich zum 30.06. die Kurve kratzte.
Am Dienstag war Attila noch schlimmer frustriert, es war schon wieder Post in Sachen Scheidung gekommen. Dabei wollte sich Attila damit eigentlich gar nicht mehr befassen, nur noch abwickeln und gut. Aber nein – der Richter hatte beim Jugendamt wegen der Vaterschaftsklage anfragen lassen, was dort dazu gedacht wurde. Und wie bei der tollen Kompetenz nicht anders zu erwarten, war man dagegen, dass die Vaterschaft per Test überprüft werden solle. Weil Attila die Mails widerrechtlich erhalten habe und somit nicht anerkannt werden könne, dass ihm so Zweifel an seiner Vaterschaft entstanden sein könnten. Wie bitte? Uns war nicht wirklich ersichtlich, wo da der Zusammenhang sein sollte. Zumal Uschi ohnehin nachweislich log und betrog, wo es nur ging. Da waren Zweifel nicht berechtigt? Wieder einmal hatten wir die Nase von Deutschland und seinem Rechtssystem gestrichen voll.
Theo meldete sich nun bei mir und hatte endlich einen Termin für den Übertrag meines Hausanteils beim Notar vereinbart. So konnte ich wenigstens das Viertel, das mir am gemeinsam gekauften Haus noch immer gehörte, samt allen Pflichten loswerden. Am Tag von Attilas Scheidungsverhandlung. Er wollte außerdem mit mir über alles andere reden, über Axel und Ann, die Spanienpläne und so weiter. Das konnte er haben, schließlich kam jetzt alles auf den Tisch. Ein weiterer Termin war für diesen Mittwoch mit Günther geplant. Das würden schwierige Verhandlungen werden, ging es doch um den Verbleib von Fredrik, ob aus ihm nun ein kleiner Spanier werden würde oder eben nicht.
Juan hatte sich bei Attila gemeldet und geschrieben, dass für alle spanischen Formalitäten von Bankkonto bis N.I.E.-Nummer nur der Personalausweis gebraucht werde. Sonst nichts. Da konnte sich die deutsche Bürokratie eine Scheibe abschneiden und wir konnten uns freuen, dass wir sie demnächst los waren.
Leider erst demnächst. Attila hatte einen Termin mit seinem Anwalt vereinbart, weil auch wegen der Anzeige »Ausspähen von Daten«, die ihm Uschi verehrt hatte, Gesprächsbedarf angezeigt war. Die Staatsanwaltschaft wollte eine Stellungnahme.
Am Mittwoch, dem 31.03.2010 beantragte ich meine Freiheit. Ich setzte meinen Chef per E-Mail in Kenntnis, dass ich das Amt verlassen werde. Dann ging ich in die Stadt und warf feierlich meinen Antrag auf Entlassung aus dem Beamtenverhältnis in den Briefkasten. Ich kam mir vor wie ein Häftling, der seine Amnestie per Gnadengesuch beantragt, und fühlte mich hinterher ausgesprochen erleichtert.
Ich wusste nicht genau, was die Zukunft brachte. Aber konnte es schlimmer sein, als in einem Büro bei der Verwaltung eingesperrt zu sein? Nein, wohl kaum. Da war es wieder, dieses Gefühl. Das Gefühl, endlich am Leben zu sein. Und dieses Leben wollte ich mit Attila teilen. Der hatte an diesem Tag einen Schock erhalten, weil er die Abrechnung für das Roaming mit seinem Internetstick bekam: 1.200 Euro hatte es gekostet, sich von Spanien aus ins Internet einzuwählen. So war klar, dass wir umgehend eine spanische Internetkarte brauchen würden.
Abends hatte ich mein Gespräch mit Günther. Ich musste Farbe bekennen und mit ihm darüber sprechen, ob Fredi nun mit nach Spanien durfte oder nicht. Klar und deutlich gab mir Günther zu verstehen, er wünsche, dass Fredi in Deutschland bleibe. Er werde für ihn sorgen, auch wenn es schwierig zu koordinieren ginge. Ich hatte es mir schon gedacht und war somit gedanklich vorbereitet. Natürlich war dieser Gedanke sehr schwer für mich, im Endeffekt ging es mir nun wie Attila: Beide hatten wir drei Kinder, und beide mussten wir von ihnen Abschied nehmen, würden sie nicht mehr oft sehen können. Angenehm an Günther war nur, dass er keine Schuldzuweisungen vornahm und unsere Pläne nicht kritisierte. Er akzeptierte unsere Entscheidung, auch wenn er sie nicht in letzter Konsequenz verstehen konnte.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man zwar Kinder hat, diese einen aber abgewählt haben oder man sie aus anderen Gründen zurücklassen muss? Attila und ich versuchten, diese Gedanken nicht allzu sehr an uns heranzulassen. Es tat trotzdem weh. Und dennoch, nüchtern betrachtet war es doch so: Wir Menschen kommen ohne alles auf die Erde und wir werden irgendwann alleine wieder gehen müssen. Kinder sind kein Eigentum und verlassen einen daher ohnehin früher oder später, um ein eigenes Leben zu leben. Eine Garantie für Liebe und Respekt gibt es nicht, genauso wenig wie bei anderen Menschen, die einem im Laufe des Lebens so begegnen. Wir hatten somit eigentlich streng genommen den Ablöseprozess von den Kindern einfach etwas vorweggenommen. Beziehungsweise zum Teil sie von uns. Man würde sehen, was die Zukunft brachte. Jedenfalls konnten wir ihnen nun durch unser unstetes Leben nicht mehr schaden, sie würden beim verbleibenden Elternteil eine Konstante haben, nicht mehr hin und hergezerrt werden. Und als Erwachsene würden sie vielleicht auch verstehen können, was uns zu diesem Schritt bewogen hat.
Ansonsten hatte uns das ganz normale Leben in Deutschland zurück. Das, in dem es leider noch ein Amt und Uschi gab. Wenn uns auch die Zeit bis Ende Juni sehr, sehr lang vorkam, so mussten wir uns doch beeilen, unseren ganzen Kram zu ordnen und unsere Sachen so weit abzubauen, dass wir den Rest mit nach Spanien nehmen konnten. Attilas persönliche Habe hatten wir schon auf vier Umzugskartons reduziert. Wirklich traurig, wie wenig Dinge von einem 50-jährigen Leben so übrig blieben, an denen einem wirklich etwas lag. Vor allem dann, wenn man ständig wie ein Besessener gearbeitet hatte und einem alles zwischen den Fingern zerrann. Das sollte nun anders werden. Hoffentlich würde Attila in Spanien nicht mehr so viel arbeiten müssen, und wenn, dann selber was von seinem Geld haben. Das wünschte ich mir.
Ann rührte sich weiterhin nicht. Nur eine SMS kam, dass ich Frau Jahn vom Personalamt zurückrufen solle. Die hatte sich auf Anns Handy gemeldet. So mussten wir den Rest ihres Zimmers ausräumen, was alles andere als angenehm war. Die Dinge, die ihr wichtig waren, hatte sie bereits mitgenommen. Vor allem die Zwergkaninchen. Was zurückgeblieben war, waren hauptsächlich Müllsäcke, auf dem Boden verstreute Gegenstände und völlig verstaubte Möbelstücke. Bei jedem Anfassen bekamen wir eine Wolke aus Dreck und Hasenflusen in die Nase, und wir mussten alles hoch in die Garage schleppen. Als wir endlich die ganze Sauerei entsorgt hatten, war Attila schlecht. Kein Wunder. Ann konnte sich jetzt noch einzelne Dinge aus der Garage holen, ansonsten würden wir in zwei Wochen alles samt und sonders zur Mülldeponie fahren. Die Garage stand voll und wir brauchten den Platz für die weiteren, zu entsorgenden Gegenstände aus dem Haus. Mitnehmen konnten wir außer Klamotten und Bürogegenständen ohnehin fast nichts. Ich musste das Zimmer dann zweimal putzen, bevor wir Attilas Interimsbüro daraus machen konnten. Er brauchte nach der Auflösung des Büros in der Preuschwitzer Straße ja noch einen Raum, wo er arbeiten und seine Ordner unterbringen konnte. So fuhren wir am Ostermontag in sein altes Büro und zerlegten da schon mal die Möbel. Die Räume mussten noch im April zurückgegeben werden,
streichen und putzen mussten wir dort auch noch.
Ganz nebenbei guckte Attila in den Briefkasten und fand natürlich wieder einen schönen dicken Umschlag. Der war vom Gerichtsvollzieher, weshalb Attila vermutete, es gehe um den Kindesunterhalt. Doch dem war nicht so. Uschis Freundin Stohrer gab keine Ruhe und hatte in zweiter Instanz nun erwirkt, dass Attila im Wege einer einstweiligen Anordnung die von ihr geschriebenen und von uns mit geschwärzten Namen im Internet veröffentlichen E-Mails von der Internetseite nehmen musste. In erster Instanz hatte man dies abgelehnt, somit war das keine klare Entscheidung. Attila beschloss, diese Sache im Hauptsacheverfahren durchzufechten. Schließlich behaupteten Uschi und Delia, sie hätten die
»Vaterschaftsmail« absichtlich in die Welt gesetzt, um eine Reaktion bei Attila zu provozieren. Also hätten sie dann ja auch billigend in Kauf genommen, dass Attila diese gegen sie verwenden konnte.
Nach wie vor unlogisch war, dass danach noch wahre Geschichten über denselben Account geschickt wurden, wie etwa Uschis Kündigungsabsicht. Diese beiden Weiber waren echt klasse. Aber uns war schon klar, warum die Stohrer so sehr hinterher war, dass Attila nur ja keine weiteren ihrer privaten Mails ins Netz stellte. Schließlich hatte sie sich auch über einen gewissen Leo ausgelassen, von dem ihr Mann möglichst nichts wissen sollte ... Wie kann man eigentlich so blöd sein, solche Informationen abzusenden, wenn man den Verdacht hegt, dass Attila die Mails abfängt? Mit Logik hatte das nicht viel zu tun. Man sagt ja, ein Vorwurf, der nicht trifft, pflegt selten zu verletzen. Tja, die ins Netz gestellten Mails mussten wohl voll ins Schwarze getroffen haben, wenn die gute Delia Stohrer sogar bereit war, drei Viertel der Gerichtskosten dafür zu tragen, dass Attila die Passagen aus der Internetseite radierte.
Und er radierte sie heraus. Aber wirklich nur Delias Aussagen und nicht die von Uschi. Dafür kam eine schöne Passage in das fragliche Schriftstück, dass wir der Auffassung sind, dass hier die Pressefreiheit durch das Gericht untergraben werde. Der Sinn der Korrespondenz ließ sich ja trotzdem noch aus Uschis Äußerungen ablesen. Hatte Delia damit etwas gewonnen? Nein, im Gegenteil. Nur wir hatten wieder eine Baustelle mehr am Hals, die es zu beseitigen galt.
So langsam machte sich bei uns ein wenig Angst vor dem Scheidungstermin breit, denn der würde ja bereits in einer Woche stattfinden. Rational betrachtet wussten wir natürlich, dass eigentlich nicht viel passieren konnte. Aber irgendeine diffuse Angst, dass dieser Tag unsere Abreise behindern könnte, hatten wir beide in uns stecken. Man wusste ja nie, was dieser hinterlistigen Uschi noch alles einfallen würde. So war es auch wichtig, dass sie bis zum Termin nicht erfuhr, wohin wir ziehen würden. Aus Neid wäre sie sonst nämlich zu allem fähig.
Ich legte seit langer Zeit gerne Tarotkarten. Man mag davon halten, was man mag: Ich habe schon oft Warnungen erhalten, die tatsächlich gerechtfertigt waren. Attila bat mich, die Karten zu legen, um über den 14.04. mehr zu erfahren. Die Karten deckten dann die Warnung auf, sich an diesem Tag nicht zu sehr emotional hineinzusteigern. Die Karte mit dem durch drei Schwerter durchbohrten Herzen sprach Bände. Sonst würde eine Zeit der Depression folgen.
Ich konnte mir schon denken, worauf dies abzielte. Man würde Attila böse Vorwürfe machen, ihm ankreiden, dass er auf das Umgangsrecht mit den Kindern verzichten wollte, sobald er in Spanien lebte. Denn eines war ja klar: Uschi würde jetzt genau konträre Aussagen zu früher machen, wo er für die Kinder ein unmöglicher Umgang gewesen war. Plötzlich wäre Attila eine Bezugsperson und außerordentlich wichtig für die Kinder. Und da er die ganze Geschichte selber noch nicht richtig seelisch verarbeitet hatte, sondern mehr oder weniger von sich abspaltete, so als eine Art Sicherheitsabschaltung, war dies gefährlich. Würde es ihm nach der Verhandlung nämlich so richtig ins Bewusstsein drängen, so mochten die Karten recht haben. Wir sprachen an diesem Abend darüber, dass er es nicht geschehen lassen durfte. Ich genauso wenig, ich musste schließlich auch meine Kinder zurücklassen.
Ansonsten waren wir mit Hochdruck damit beschäftigt, alles für unseren Umzug vorzubereiten. Wohin mit den Möbeln? Noch schnell alle Arzttermine wahrnehmen, die Müllentsorgung planen, Versicherungen kündigen, Umzugsauto organisieren und so weiter. Mir lag wieder einmal im Magen, dass die Zeit meiner Krankschreibung ihrem Ende zuging. Das Amt konnte ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen, zumal mir sofort wieder Vertretung blühen würde. Ich ging zu Dr. Rahe mit der unangenehmen Überzeugung, dass er mich nicht mehr krankschreiben würde, weil es mir sichtlich besser ging. Ich hatte ja nun eine Perspektive. Aber es kam anders. Zu meinem Erstaunen war Dr. Rahe über unsere Pläne begeistert und meinte, das sei jetzt genau richtig für mich, um mich seelisch wieder auf die Reihe zu bekommen. Seine Frau habe auch den Beamtenjob aufgesteckt und es nicht bereut. Da bräuchte ich dann auch keine Medikamente mehr, nicht einmal Lithium. Und das Amt? Nein, damit solle ich mich jetzt auch nicht mehr belasten. Wenn ich ohnehin zum Ende Juni dort gehen würde, drohe mir vermutlich auch nicht mehr der Amtsarzt, wenn er mich jetzt weiter krankschreibe. Damit habe er gar kein Problem. Und schon hatte ich wieder eine Krankmeldung für 2 ½ Wochen in der Hand, mit der Aussicht auf Verlängerung. Strahlend verließ ich die Praxis. Mein Chef allerdings, der würde garantiert überhaupt nicht strahlen. Der hätte jetzt eben keine Vertretung für Arti. Ich hatte es ihm jahrelang immer wieder nahegelegt, sich um dieses Problem zu kümmern. Und er hatte es permanent ignoriert.
Ich hingegen konnte mich jetzt in Ruhe um alle Angelegenheiten kümmern und den Garten noch einmal ordentlich herrichten. Ann setzte ich nun auch eine letzte Frist für die Abholung ihrer Sachen.