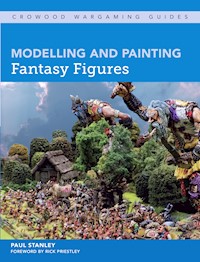Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hannibal Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seiner Autobiografie enthüllt der als »The Starchild« bekannte Paul Stanley erstmalig, wie es war, jeden Abend live mit KISS aufzutreten und jeden Tag eine wilde Party zu feiern. Gewohnt witzig und aufrichtig nimmt er den Leser mit auf eine bunte Reise durch die unglaublichen Höhen und Tiefen seines Lebens: von seiner schwierigen Kindheit in New York City über sein erstes Treffen mit Gene Simmons bis hin zur berüchtigten und alle Rekorde brechenden Alive!-Tour, der dramatischen Trennung, der überraschenden Wiedervereinigung und der triumphalen Aufnahme in die »Rock & Roll Hall of Fame«. Mit zahlreichen Goldenen Schallplatten und über 100 Millionen verkauften Tonträgern gehören KISS zu den kommerziell erfolgreichsten amerikanischen Bands der Pop-Geschichte. Paul Stanleys Buch ist das ausführliche und kompromisslose Selbstporträt eines Gitarren-Gottes, einer Ikone der Rockmusik. Er erzählt Geschichten über Streitereien und Verrat, auf und abseits der Bühne. Diese fesselnde Mischung aus privaten Enthüllungen, düsteren Episoden und lustigen Anekdoten wird sogar die treuesten Fans von KISS überraschen. Und er erzählt die Geschichten hinter den berühmten Hymnen wie »I Was Made For Loving You« oder »Rock'n'Roll All Nite«. »Hinter der Maske« ist ein schockierender, witziger, cleverer und unglaublicher – aber nichtsdestotrotz wahrer – Bericht über das Leben »einer der beständigsten und berühmtesten Frontmänner« der Rockgeschichte. Und über die unsterbliche Band KISS, die er mitgründete und prägte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus dem Englischen von
Paul Fleischmann
www.hannibal-verlag.de
Für meine Famile
Impressum
Die englischsprachige Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel Face the Music. A Life Exposed bei Harper-One (an imprint of Harper Collins Publishers, New York).
Soweit nicht anders angegeben, entstammen die Fotos der persönlichen Sammlung des Autors.
Copyright © 2014 by Paul Stanley
Deutsche Erstausgabe
© 2014 by Hannibal
Hannibal ist ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen
www.hannibal-verlag.de
Übersetzung: Paul Fleischmann
Redaktion: Rainer Schöttle
Foto Buchvorderseite: © Brian Lowe
Design Buchvorderseite: © Faceout Studio, Charles Brock
Foto Buchrückseite: © Ash Newell
Layout und Satz: Thomas Auer, www.buchsatz.com
Alle Texte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Verlages ist unzulässig. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-85445-456-4
Auch als Hardcover erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-455-7
Inhalt
Prolog
Teil 1
Keine Zuflucht, kein Entrinnen
Teil 2
Kampf ums Überleben in der City
Teil 3
Durch das Auf und Ab des Lebens
Bildstrecke
Teil 4
Unter Druck
Teil 5
Auf dem Highway zum Herzschmerz
Teil 6
Auf ewig
Über den Autor
Über den Mitautor
Danksagungen
Ich setze mich und blicke in den Spiegel. Einen Augenblick lang starre ich in die Augen meines Gegenübers. Der Spiegel ist umrahmt von hell strahlenden Glühbirnen und auf dem Tisch davor liegt ein kleines schwarzes Schminkset. In drei Stunden müssen wir auf die Bühne –Zeit also für das Ritual, das seit 40 Jahren mein Berufsleben bestimmt.
Zuerst trage ich ein Gesichtswasser auf, damit sich die Poren schließen. Dann schnappe ich mir eine dicke, weiße Grundierungscreme. Ich tunke meine Finger in die Pampe und beginne, sie auf meinem Gesicht zu verteilen, wobei ich um mein rechtes Auge genügend Platz freilasse, um dort anschließend die Umrisse des Sterns aufzuzeichnen.
Es gab Zeiten, in denen das Make-up eine Maske war, hinter der sich das Kind verbarg, das bis dahin einsam und unglücklich gewesen war. Ich wurde ohne rechtes Ohr geboren und bin auf dieser Seite auch taub. Eine meiner schlimmsten Kindheitserinnerungen ist mein Spitzname „Stanley, das einohrige Monster“. Oft kannte ich die Kinder, die mich so riefen, gar nicht. Dafür kannten sie mich, denn ich war das Kind mit dem verkümmerten Ohr. Wenn ich unter Leuten war, fühlte ich mich nackt. Ich war mir auf schmerzhafte Weise bewusst, dass ich ständig unter die Lupe genommen wurde. Und meine Familie zu Hause war zu zerrüttet, um mich auch nur irgendwie zu unterstützen.
Sobald das Weiß aufgetragen ist, zeichne ich um mein rechtes Auge mit freier Hand die Umrisse des Sterns, wobei sich die Linie stellenweise mit der weißen Grundierung überschneidet. Deshalb reinige ich im Anschluss das Innere des Sterns mit einem Ohrenstäbchen und säubere außerdem noch meine Lippen.
Die Figur, die sich auf meinem Gesicht abzuzeichnen beginnt, entstand ursprünglich als Tarnung, die verbergen sollte, wer ich wirklich war. Viele Jahre lang fühlte es sich so an, als würde eine andere Persönlichkeit zum Vorschein kommen. Das unsichere, unvollkommene Kind mitsamt seinen Selbstzweifeln und seiner inneren Zerrissenheit wurde überschminkt und dieser andere Typ kam ans Tageslicht. Ein Typ, den ich erschaffen hatte, um allen zu verdeutlichen, dass sie netter zu mir hätten sein sollen, denn ich war etwas Besonderes. Ich erschuf einen Kerl, der tatsächlich die Herzen der Mädchen eroberte. Leute, die ich aus meiner Kindheit kannte, wunderten sich über meinen Erfolg mit KISS. Und ich kann sie verstehen. Sie hatten ja keine Ahnung, wie es in mir aussah. Sie wussten nicht, warum ich so war, wie ich eben war, und welche Ziele ich mir gesetzt hatte. Über nichts von alldem wussten sie Bescheid. Für sie war ich nur irgendein verkorkster Freak – oder eben ein Monster.
Als Nächstes stehe ich auf und gehe in einen anderen Raum. Üblicherweise schließt ein Badezimmer an die Garderobe an. Ich halte die Luft an und pudere mein ganzes Gesicht mit weißem Pulver. Das ermöglicht mir, während der Show zu schwitzen, ohne dass dabei die Schminke verläuft. Ich kann die weiße Farbe in meinem Gesicht nun berühren, ohne dass sie an meinem Finger haften bleibt. Ich bin beim Herumprobieren auf diese Technik gestoßen. Anfangs konnte ich nämlich nichts mehr sehen, sobald das Make-up in meine Augen rann.
Als kleiner Junge träumte ich hin und wieder, dass ich als Erwachsener ein maskierter Verbrechensbekämpfer sein würde. Ich wollte der Lone Ranger oder Zorro sein. Ich wollte der Typ sein, der auf einem Pferd saß und eine Maske trug – so, wie ich das aus Filmen und dem Fernsehen kannte. Dieser einsame Junge wollte genau das tun – und dieser einsame Junge würde genau das tun. Ich erschuf meine eigene Realität. Die Figur, die ich erschuf – Starchild – würde auf die Bühne gehen und dieser Typ sein, der Superheld, der im Gegensatz zur Person stand, die ich eigentlich war. Ich genoss es, dieser Typ zu sein.
Aber über kurz oder lang musste ich wieder runter von der Bühne, und wenn ich diese Stufen hinabstieg, wartete bereits wieder die Totalität des Lebens auf mich. Jahrelang war Was nun? das Einzige, das mir dann in den Sinn kam. Damals war mein Zuhause eine Art Fegefeuer. Während der kurzen Phasen, in denen KISS gerade nicht auf Tour waren, saß ich in meiner New Yorker Wohnung auf dem Sofa und dachte darüber nach, dass mir niemand glauben würde, dass ich das beschissene Gefühl hatte, nirgendwo dazuzugehören. Die Band war mein Lebenserhaltungssystem, hielt aber auch die Art von Beziehungen, die zu einem echten Leben gehören, von mir fern. Zu Hause nagte etwas an mir – ein wichtiges Bedürfnis blieb unerfüllt. Einerseits war ich immer allein und unnahbar, aber andererseits hielt ich es nicht aus, auf mich allein gestellt zu sein.
Im Verlauf der Zeit verschwammen die Grenzen zwischen der Kunstfigur und dem Menschen, der ich war. Dieser Typ fing an, mich auch abseits der Bühne zu begleiten. Die Girls wollten ihn, diesen Typen. Die Leute nahmen einfach an, ich wäre dieser Typ. Ich konnte die Wirklichkeit von der Bühne verbannen, aber nicht dauerhaft aussperren. Einen ganzen Tag als Starchild zu bestreiten war keine einfache Angelegenheit, da ich es mir selbst nicht abkaufte. Ich kannte die Wahrheit. Ich wusste, wer ich wirklich war. Außerdem war ich sehr defensiv. Während sich Leute um mich herum über einander lustig machten, konnte ich zwar gut austeilen, war aber nicht bereit einzustecken. Mir war klar, dass es viel lustiger sein müsste, über sich selbst, seine Macken und Defizite lachen zu können, doch gelang es mir nicht, mich zu überwinden. Ich konnte einfach nicht locker lassen. Es war eine instinktive Reaktion darauf, als Kind ständig angestarrt und ausgelacht worden zu sein.
Ich war immer noch zu unsicher. Obwohl ich es selbst nicht ganz verstand (genauso wenig wie alle anderen, da ich mich ja nie zu meinem Ohr äußerte), wurde ich weiterhin von meiner bitteren Vergangenheit angetrieben. Meine Witze waren unterlegt mit einem boshaften Unterton und gingen allesamt auf Kosten anderer.
Schlägst du mich, schlag ich doppelt zurück.
Es lebt sich leicht, wenn man die Hand zur Faust geballt hat. Aber einer geschlossenen Hand kann man auch nichts geben, wohingegen eine offene Hand in der Lage ist, sehr viel entgegenzunehmen. Leider blieb mir diese Erkenntnis sehr, sehr lange verborgen. Während dieser Zeit spürte ich einen inneren Konflikt, der wiederum in ein Gefühl der Unzufriedenheit, Unzulänglichkeit und tiefen Einsamkeit eingebettet zu sein schien.
Nachdem ich die Schminke mit dem Puder präpariert habe, gehe ich zurück in die Garderobe, setze mich wieder vor den Spiegel und entferne Puderkörner, die sich in den sternförmigen Umriss um mein Auge verirrt haben. Nun fahre ich diesen Umriss mit einem schwarzen Augenbrauenstift nach. Anschließend nehme ich schwarze Schmierfarbe, die etwas zäher ist als die weiße Clownfarbe, und einen Pinsel, um den Stern aufzumalen. Dann wechsle ich wieder ins andere Zimmer und fixiere das schwarze Make-up mit Talkumpuder, das weniger matt als das andere Puder auf meinem restlichen Gesicht ist. Ich kehre erneut in die Garderobe zurück und umrande mein linkes Auge mit schwarzem, wasserfestem Eyeliner. Während das Ganze trocknet, betrachte ich mich im Spiegel.
In früheren Lebensabschnitten mochte ich die Person, die ich im Spiegel sah, nicht immer. Aber ich gab mir stets Mühe, nicht gleichgültig zu bleiben und der Mensch zu werden, der ich gerne sein wollte. Das Problem war, dass – egal, was ich tat – nichts mich meinem Ziel näher zu bringen schien. Während KISS einige Wellentäler durchfuhren, begriff ich, dass vieles, von dem ich annahm, dass es mich glücklich machen oder mir etwas Selbstsicherheit schenken würde, nichts brachte. Ich dachte, dass es mir helfen würde, berühmt zu sein. Ich dachte, dass Reichtum der Schlüssel wäre. Ich dachte, es ging darum, begehrenswert zu sein. 1976 gelang uns schließlich mit dem Album KISS Alive! der Durchbruch. Jedoch fühlte ich mich nicht im Geringsten besser, wenn ich Leuten meinen Ruhm unter die Nase rieb. Bis Ende der Siebzigerjahre hatten wir Millionen von Dollars eingenommen, doch realisierte ich, dass das Geld – und die Kleidung, die Autos und die seltenen Gitarren, die ich damit kaufte – mich auch nicht glücklich machen konnte. Und was das Stichwort „begehrenswert“ angeht, so war Sex ab der Veröffentlichung unserer ersten Schallplatte andauernd und überall verfügbar. Allerdings musste ich einsehen, dass es möglich war, mit jemandem zusammen zu sein und sich trotzdem einsam zu fühlen. Ich habe einmal gehört, dass man sich nie einsamer fühlen wird, als wenn man mit der falschen Person schläft. Das ist die Wahrheit. Auch wenn es schlimmere Formen des Leids gibt, als zwischen Penthouse-Pets und Playboy-Häschen zu nächtigen, so erwies sich die Glückseligkeit dieser Erfahrungen doch als flüchtig. Durchaus anregend, ja, aber vorübergehend. Ich machte die Erfahrung, dass nichts davon die Leere in mir auszufüllen vermochte.
Als KISS sich 1983 schließlich das Make-up aus den Gesichtern wischten, wurde ich noch mehr zum Starchild – oder eher noch: Die Kunstfigur wurde zu mir. Mein eigenes Gesicht wurde zu dem des Starchilds. Ich hatte bis zu einem gewissen Grad das schüchterne, defensive und unbeliebte Kind aus mir verbannt, doch hatte ich es weder ersetzt noch neu zusammengebaut. Ich war eine Art Hülle, ein leeres Gefäß. Ich befand mich noch immer auf der Suche nach der Person, die ich werden wollte, und Starchild – auch ohne den sichtbaren Stern – blieb weiterhin die Maske, die ich trug, um mit der Welt in Kontakt zu treten. Doch dachte ich – oder zumindest glaubte ich –, dass es leichter wäre, Leute auf Distanz zu halten, als ihnen auf einer persönlicheren Ebene zu begegnen. Letzten Endes muss man erst einmal mit sich selbst klarkommen, bevor man sich auf andere Menschen einlassen kann. Und das war noch immer nicht der Fall bei mir. Daher schien mein Leben keinen rechten Sinn zu ergeben. Wo war denn die Familie? Wo die Freunde? Wo war das „Zuhause“?
Es gab einfach kein Entkommen aus der fundamentalen Erkenntnis, dass ich mich immer noch nicht wohl in meiner Haut fühlte. Wenn man vor der Wahrheit nicht fliehen kann, muss man sie entweder verdrängen oder die Dinge in Ordnung bringen. So einfach ist das. Mir entspricht es eher, Dinge in Ordnung zu bringen, anstelle mich zu betäuben und sie dadurch zu verdrängen. Sogar in den schmerzvollsten Augenblicken meines Lebens – als etwa meine Band auseinanderzufallen schien, die Menschen um mich den Drogen zum Opfer fielen oder als ich wegen der Scheidung von meiner ersten Frau am Boden war – überwanden mein Selbsterhaltungstrieb und mein Drang, besser zu werden, alle anderen Impulse.
Manchen Menschen beschert eine Nahtoderfahrung die Art von Erleuchtung, die die Richtung ihres Lebens entscheidend verändert. Tatsächlich muss man nur ein paar Autobiografien von unterschiedlichen Rock ’n’ Rollern durchblättern, um zu dem Schluss zu kommen, dass jeder Musiker wohl schon einmal mit Ach und Krach dem Sensenmann entkommen ist, was in der Folge zum ultimativen Meilenstein seines oder ihres Lebens hochstilisiert wird.
Allerdings habe ich nie probiert, mich umzubringen. Auch habe ich mich nie so intensiv mit Drogen und Alkohol beschäftigt, dass ich irgendwann einmal im Krankenhaus aufgewacht wäre, nachdem ich wiederbelebt werden musste. Trotzdem kam auch ich schon mit dem Tod in Berührung. Und der Ernst der jeweiligen Lage führte mit Sicherheit dazu, dass auch ich in mich ging. Aber ehrlicherweise muss ich betonen, dass keines meiner Nahtoderlebnisse einen so starken Einfluss auf mich ausübte wie etwas anderes, das sich nicht so nach Rock ’n’ Roll anhört. Mein Erweckungserlebnis hatte ich nicht, als ich mit dem Lauf einer Pistole im Mund zum Höhepunkt kam, und auch nicht, als ein Defibrillator Stromstöße durch meine Brust jagte – nein, ich wurde am Set eines Broadway-Musicals erleuchtet.
1999 ergatterte ich die Titelrolle in einer Inszenierung von Andrew Lloyd Webbers DasPhantom der Oper in Toronto. Die Hauptfigur ist ein Komponist, der sich hinter einer Maske versteckt, um die schreckliche Entstellung seines Gesichts zu verbergen. Und hier kam nun ich ins Spiel, der Junge mit nur einem Ohr, Stanley das Monster, der sein Leben damit verbracht hatte, Musik zu machen und sein Gesicht mit Make-up zu verfremden und nun dieses Phantom verkörpern sollte. Besonders eine Szene traf einen Nerv bei mir. Mit seinem Umhang und seiner Maske hat das Phantom eine gefährliche, aber nichtsdestotrotz elegant anmutende Ausstrahlung. Kurz bevor er das Objekt seiner Begierde, Christine, in sein Versteck entführt, nähert er sich ihr und sie entreißt ihm seine Maske, womit sie sein abscheuliches Gesicht enthüllt. Dieser intime Augenblick, als das Phantom demaskiert war und von Christine berührt wurde, traf offenbar auf einen ganz besonders wunden Punkt in mir.
Während meiner Theaterzeit als Phantom erhielt ich eines Tages einen Brief, der von einer Frau stammte, die unlängst eine Aufführung besucht hatte. „Sie schienen sich mit ihrer Figur auf eine Weise zu identifizieren, die ich noch bei keinem anderen Schauspieler beobachtet habe“, schrieb sie mir. Sie teilte mir dann mit, dass sie für eine Organisation namens AboutFace arbeitete. Dort widmete man sich Kindern, deren Gesichter von der Norm abwichen. „Wären sie eventuell daran interessiert, sich bei uns zu engagieren?“, fragte sie mich abschließend.
Wow. Wie war ihr das denn aufgefallen?
Ich hatte zuvor noch nie über mein Ohr gesprochen. Sobald ich dazu in der Lage gewesen war, hatte ich mir die Haare lang wachsen lassen und mich nie mit meiner Taubheit auseinandergesetzt. Es war etwas, das ich für mich behielt. Ein Geheimnis. Es war einfach zu persönlich und schmerzhaft. Trotzdem beschloss ich, die Frau anzurufen. Ich war mir nicht sicher, was mich erwarten würde. Aber ich öffnete mich ihr und es fühlte sich gut an. Bald schon arbeitete ich für ihre Organisation und sprach mit Kindern und ihren Eltern über meinen Geburtsfehler sowie meine Erfahrungen und hörte mir auch ihre Geschichten an. Die Auswirkungen auf mich waren unglaublich.
Es befreite mich, über etwas zu sprechen, das stets so delikat, persönlich und schmerzvoll für mich gewesen war. Die Wahrheit hatte mich frei gemacht – die Wahrheit und Das Phantom der Oper. Irgendwie hatte die Maske des Phantoms mir erlaubt, meinen Käfig zu verlassen. Im Jahr 2000 wurde ich dann zum Sprecher von AboutFace. Ich fand heraus, dass mein eigener Heilungsprozess durch den Austausch mit anderen unterstützt wurde. Es kehrte eine Ruhe in mein Leben ein, die ich nie zuvor gekannt hatte. Ich war immer auf der Suche nach äußeren Faktoren gewesen, mit deren Hilfe ich mich aus der Dunkelheit hatte befreien wollen, während das Problem die ganze Zeit in mir selbst lag.
Du kannst niemandem die Hand halten, wenn du deine eigene zu einer Faust geballt hast.
Die Schönheit um dich herum bleibt dir verborgen, wenn du sie nicht in dir selbst findest.
Du kannst andere nicht entsprechend schätzen, wenn du dich deinem eigenen Unglück ergibst.
Ich begriff, dass nicht jene Menschen schwach waren, die ihre Emotionen zeigten, sondern die, die ihre Gefühle versteckten. Ich musste neu definieren, was es hieß, stark zu sein. Ein „echter Mann“ hatte stark zu sein. Ja, auch stark genug, um zu weinen, freundlich und mitfühlend zu sein. Stark genug, um die Bedürfnisse anderer über die eigenen zu stellen. Stark genug, Angst zu haben und trotzdem einen Ausweg zu finden. Stark genug, um zu vergeben und um Vergebung zu bitten.
Je besser ich mit mir selbst klarkam, desto mehr konnte ich anderen Menschen geben. Und je mehr ich anderen von mir gab, desto mehr fand ich, das ich geben konnte.
Kurz nach dieser Verwandlung traf ich Erin Sutton, eine smarte, selbstbewusste Rechtsanwältin. Von Anfang an waren wir total offen und ehrlich zueinander. Da war kein Platz für Schauspielerei. Sie war verständnisvoll, fürsorglich, anregend und – vor allem und am wichtigsten – konsequent und selbstsicher. Eine wie sie hatte ich noch nie getroffen. Wir stürzten uns nicht kopfüber in eine Beziehung, aber nach ein paar Jahren stellten wir fest, dass wir ohne einander gar nicht mehr sein konnten.
„Ich hatte noch nie eine solche Beziehung“, sagte ich zu ihr. „Ich hatte gar nicht gewusst, dass so etwas wie das hier überhaupt existiert.“
Das ist das Leben, nach dem ich gesucht habe.
Das ist der Lohn.
So ist es, wenn man sich … erfüllt fühlt.
Es war wie eine nie enden wollende Suche nach etwas, von dem ich meinte, es haben zu sollen. Dieses Verlangen bezog sich nicht ausschließlich auf materielle Dinge, sondern auch darauf, wer ich sein wollte. Dieser Antrieb befähigte mich, an diesem Punkt anzukommen. Das erste Ziel meiner Mission hatte darin bestanden, ein Rockstar zu werden, aber führte letztlich ganz woanders hin.
Und darum geht es eigentlich in diesem Buch. Deshalb wünsche ich mir auch, dass meine vier Kinder dieses Buch eines Tages lesen werden, obwohl der Pfad, für den ich mich entschied, lang und unwegsam war und mich mitunter durch ziemlich wilde Gegenden und Zeiten geführt hat. Ich möchte, dass sie verstehen, wie mein Leben war, ungeschönt und ehrlich. Ich möchte, dass sie verstehen, dass es in unseren eigenen Händen liegt, ein wunderschönes Leben zu haben. Es mag nicht immer einfach sein, und manchmal braucht man länger, um seine Ziele zu erreichen – aber es ist möglich. Für jeden von uns.
Ich sammle meine Gedanken und schaue erneut in den Spiegel. Von dort starrt mich das vertraute weiß geschminkte Gesicht mit dem schwarzen Stern ums Auge an. Nun muss ich bloß noch eine oder zwei Dosen Haarspray in meine Haare sprühen, um sie anschließend bis unter die Decke aufwölben zu können. Der rote Lippenstift muss natürlich auch noch drauf. Heutzutage ist es schwer für mich, nicht zu lächeln, wenn ich diese Maske trage. Ich merke, dass ich über das ganze Gesicht grinsen muss und bereit bin, mit dem Starchild abzufeiern, denn mittlerweile ist es eher zu einem guten, alten Freund geworden – und nicht länger ein Alter Ego, hinter dem ich mich zusammenkauere.
Draußen warten 45.000 Menschen. Ich stelle mir vor, wie wir die Bühne erstürmen. You wanted the best, you got the best, the hottest band in the world … Ich zähle „Detroit Rock City“ ein und ab geht die Post. Gene Simmons, Thommy Thayer und ich schweben aus zwölf Metern Höhe auf die Bühne, während ein riesiger schwarzer Vorhang fällt und Eric Singer unter uns das Schlagzeug bearbeitet. Feuerwerk! Flammen! Das nach Fassung ringende Publikum wirkt auf uns wie eine Naturgewalt. Kaawwuumm! Es ist der größte Rausch, den man sich nur vorstellen kann. Wenn ich auf der Bühne stehe, liebe ich es, die Menschen beim Springen, Tanzen, Küssen und Feiern zu beobachten. Sie verfallen in reinste Ekstase und ich genieße das. Es ist wie ein Stammesfest.
KISS sind mittlerweile Tradition, ein Ritual, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Es ist ein fantastisches Geschenk, mit so vielen Menschen auf dieser Ebene kommunizieren zu können – so viele Jahre nach unseren Anfängen. Ich werde wieder das ganze Konzert lang lächeln müssen.
Das Beste ist, dass ich auch nach dem Konzert, wenn ich wieder auf die bereits erwähnte Totalität des Lebens treffe, lächeln werde.
Es gibt Leute, die gar nicht mehr heimgehen wollen – nein, sie würden am liebsten nie mehr heimgehen. Und immer wieder mal wollte ich das auch nicht. Aber mittlerweile liebe ich es, nach Hause zu kommen, weil ich mir inzwischen ein Heim – ein echtes Zuhause – geschaffen habe, in dem ich mich von ganzem Herzen wohlfühle.
Ein „Zuhause“ kann sehr vieles bedeuten. Für die meisten Menschen ist es ein Ort der Ruhe und Geborgenheit. Mein erstes Zuhause war alles andere als das.
Ich kam am 20. Januar 1952 als Stanley Bert Eisen zur Welt. Das New Yorker Apartment, in das mich meine Eltern mitnahmen, befand sich an der Ecke West 211thStreet und Broadway, ganz im Norden Manhattans. Ich wurde mit einer Ohrmuschelfehlbildung namens Mikrotie geboren, wobei sich das Knorpelgewebe des äußeren Ohrs nicht ordentlich entwickelt, was dazu führt, dass einem stattdessen eine unterschiedlich ausgeprägte, knorpelig-deformierte Masse wächst. Ich hatte nur ein kleines Rudiment auf der rechten Seite meines Kopfes. Das hatte zur Folge, dass ich nicht bestimmen konnte, aus welcher Richtung ein Geräusch kam, und dass es mir sehr schwer fiel, Menschen akustisch zu verstehen, wenn irgendwelche Hintergrundgeräusche die jeweilige Stimme überlagerten. Das führte so weit, dass ich instinktiv solche Situationen mied.
In meiner frühesten Erinnerung sehe ich mich mit meinen Eltern in unserem abgedunkelten Wohnzimmer sitzen. Die Rollläden waren heruntergezogen, als ob die Unterhaltung, die wir führten, ein Geheimnis gewesen wäre: „Wenn dich je wer fragt, was mit deinem Ohr los ist, erzählst du, dass du so geboren wurdest.“
Meine Eltern schienen zu glauben, dass die Angelegenheit nicht existieren würde, wenn sie sie ignorierten. Diese Philosophie bestimmte unseren häuslichen Alltag und somit mein Leben über große Teile meiner Kindheit hinweg. Ich bekam simple Antworten auf komplexe Fragen. Aber wenn meine Eltern meine Problematik auch gerne ignorierten – außer ihnen tat das leider niemand. Die Kinder schienen mich auf meine Fehlbildung zu reduzieren. Ich war für sie ein Objekt und kein kleiner Junge. Jedoch waren Kinder nicht die einzigen, die mich anstarrten – auch Erwachsene taten es, was sogar noch schlimmer war. Eines Tages auf einem Markt an der 207thStreet, einen Katzensprung von unserer Wohnung entfernt, fiel mir auf, dass ein Erwachsener, der in der Schlange stand, mich angaffte, als wäre ich ein Ding und kein Mensch. Ich wünschte mir nur, dass er aufhören würde. Wenn dich jemand anstarrt, ist die Situation nicht nur auf dich und diese Person beschränkt. Ein solches Verhalten zieht Aufmerksamkeit auf sich – und im Mittelpunkt zu stehen, war der Horror für mich. Ich fand die musternden Blicke und das gnadenlose Interesse sogar noch übler als Spott und Hohn. – Fast überflüssig hinzuzufügen, dass ich nicht viele Freunde hatte.
An meinem ersten Tag im Kindergarten wollte ich, dass meine Mutter sobald wie möglich wieder ging, was sie stolz machte. Allerdings hatte ich dafür einen anderen Grund, als sie dachte. Es hatte nichts damit zu tun, dass ich nun unabhängig und selbstsicher gewesen wäre. Ich wollte nur nicht, dass sie mitbekäme, wie ich angestarrt würde. Sie sollte nicht sehen, dass ich anders behandelt würde. Ich befand mich in einer neuen Umgebung mit neuen Kindern und wollte nicht vor ihr gedemütigt werden. Dass sie stolz auf mich war, zeigte mir, dass sie keine Ahnung von mir hatte. Meine Ängste waren ihr zu hoch.
Eines Tages kam ich weinend heim. „Jemand hat mir ins Gesicht gespuckt“, schluchzte ich. Ich suchte Aufmunterung und Schutz bei meiner Mutter. Ich nahm an, sie würde mich fragen, wer das getan hätte, um im Anschluss die Eltern des anderen Kindes zu finden und ihnen klarzumachen, dass so ein Verhalten nicht akzeptabel wäre. Aber stattdessen sagte sie: „Heul dich nicht bei mir aus, Stanley. Du musst deine Kämpfe schon selbst austragen.“
Meine Kämpfe selbst austragen? Ich bin fünf!
Ich will niemandem wehtun. Ich will nur, dass mich die Leute in Frieden lassen.
Eine Stunde später ging ich allerdings wieder hinaus, fand den Jungen und verpasste ihm eine aufs Auge. Er konnte sich da aber schon nur mehr dunkel an den ganzen Vorfall erinnern und wusste sich gar nicht zu erklären, warum ich so eine große Sache daraus machte.
Eines war danach klar: Mein Zuhause war nicht der Ort, an dem ich Hilfe finden würde. Egal, ob ich verprügelt, gehänselt oder sonst irgendetwas würde, ich musste mich schon selbst darum kümmern.
Wir lebten praktisch neben der PS 98, der Grundschule, die ich besuchte. Der Schulkomplex umfasste drei verschiedene Höfe, die durch Maschendrahtzäune getrennt waren. Da gab es einen Jungen, dessen Name ich nicht kannte, der aber dafür meinen wusste. Aus sicherer Entfernung rief er mir, kaum dass er mich erblickt hatte, von der anderen Seite des Zauns hinterher: „Stanley, das einohrige Monster! Stanley, das einohrige Monster!“
Ich hatte keine Ahnung, woher mich dieser Junge kannte. Alles, was mir durch den Kopf schoss, war: Warum tust du mir das an? Du tust mir weh. Wirklich, wirklich weh.
Er war ein normaler, unauffälliger Schüler in meinem Alter und hatte braune Haare. Außerdem hätte ich ihn, wenn ich ihn in die Finger bekam, leicht verhauen können, da er nicht besonders groß war. Aber er blieb stets außerhalb meiner Reichweite auf der anderen Seite des Zauns oder auf der anderen Seite des Schulhofs, von wo er leicht in die nahe gelegenen Wohnblocks entkommen konnte, bevor ich ihn mir hätte vorknöpfen können.
Wenn ich diesen Jungen nur drankriegen könnte.
Aber eines Tages schnappte ich ihn tatsächlich. Ich hörte ihn wieder einmal rufen: „Stanley, das einohrige Monster!“ So wie immer eben. Zuerst zuckte ich zusammen. Die Stimme in meinem Kopf bettelte: Hör doch endlich auf damit! Alle können dich hören! Deinetwegen starren sie mich jetzt alle an!
Und so wie immer gab es kein Entrinnen vor den Blicken.
Aber dieses Mal war ich schneller als er und griff ihn mir. Er hatte eine Scheißangst. „Schlag mich nicht!“, heulte er. Er sah aus wie ein verängstigtes Kaninchen.
„Dann hör endlich auf damit!“, sagte ich ihm, während ich ihn festhielt. Ich schlug ihn nicht. Als ich ihn so sah, wollte ich nicht mehr. Ich hoffte, dass er mich in Ruhe lassen würde, wenn ich ihn verschonte. Also ließ ich ihn ziehen. Er war kaum 30 Meter von mir entfernt, da drehte er sich zu mir um und krakeelte erneut: „Stanley, das einohrige Monster!“
Warum?
Warum tust du mir das bloß an?
Warum nur?
Obwohl ich nicht in der Lage war, es in Worte zu fassen, fühlte ich mich unfassbar verwundbar und nackt, unfähig, mich vor den Blicken und den Hänseleien, die überall auf mich lauerten, zu schützen. Und so entwickelte ich schon früh ein explosives Gemüt.
Statt meine Ausbrüche als Hilferuf zu interpretieren, reagierten meine Eltern mit Drohungen. „Wenn du damit nicht aufhörst“, sagten sie in drohendem Ton, „schicken wir dich zum Psychiater.“ Ich hatte zwar keine Ahnung, wer oder was ein Psychiater war, aber es hörte sich bedrohlich an, nach einer diabolischen Bestrafung. Ich stellte mir vor, dass ich in ein Krankenhaus verfrachtet würde, wo man mich einer qualvollen Behandlung unterzöge.
Nicht, dass ich mich zu Hause jetzt besonders behütet gefühlt hätte: Meine Eltern gingen regelmäßig aus und ließen mich und meine Schwester Julia, die nur zwei Jahre älter als ich war, alleine zurück. „Macht bloß niemandem die Tür auf“, war alles, was sie uns rieten. Dann waren meine achtjährige Schwester und ich mit meinen sechs Jahren auf uns gestellt. Wir hatten eine solche Angst, dass wir mit Messern und Hämmern unter unseren Kissen zu Bett gingen. Am nächsten Morgen standen wir früh genug auf, um unsere Waffen wieder an ihre angestammten Aufbewahrungsorte zurückzuschmuggeln, um nicht von unseren Eltern angeschrien zu werden.
Ich teilte mir mit Julia ein kleines Zimmer. Meine Eltern schliefen auf einer ausziehbaren Couch im Wohnzimmer. Julia hatte schon sehr früh mentale Probleme. Meine Mutter sagte, dass sie schon immer „anders“ gewesen sei, sogar schon als Baby. Sie war wild und gewalttätig. Sie machte mir Angst, und während meine eigenen Probleme sich verschlimmerten, trug ich mich mit der Sorge, dass ich genau wie sie werden könnte.
Meine Eltern waren mir da keine große Hilfe, aber andererseits unterstützten sie sich auch gegenseitig nicht besonders. Meine Mom – sie hieß Eva – war sehr dominant, und mein Dad – William – nahm ihr das übel. Sie präsentierte sich gerne als stark und ihn als unterwürfig. Sie sah sich als die Klügere von beiden, aber eigentlich war es eher mein Dad, der sehr gescheit und belesen war.
Er hatte bereits mit sechzehn die Highschool abgeschlossen, und unter anderen Umständen wäre er womöglich aufs College gegangen. Jedoch bestand seine Familie darauf, dass er arbeiten ging, um Geld nach Hause zu bringen – was er dann auch tat. Als ich schließlich zur Welt kam, arbeitete mein Dad Vollzeit als Büromöbelverkäufer. Notgedrungen akzeptierte er diesen Job, aber er mochte ihn nie besonders.
Meine Mutter blieb nach meiner Geburt als Hausfrau daheim; vorher war sie als Krankenschwester und als Hilfslehrerin an einer Sonderschule tätig gewesen. Später arbeitete sie dann in einer Einlösestelle, wo Leute sich irgendwelche Sachen abholen konnten, nachdem sie Heftchen mit Stempelmarken gefüllt hatten, die in verschiedenen Läden für Kundentreue ausgegeben wurden.
Die Familie meiner Mutter war vor den Nazis aus Berlin zuerst nach Amsterdam geflüchtet. Sie hatten alles zurücklassen müssen. Meine Großmutter hatte sich von ihrem Mann scheiden lassen, was damals eher selten war. Nachdem sie erneut geheiratet hatte, zogen sie nach New York. Familienmitglieder meiner Mutter waren anderen Menschen gegenüber sehr herablassend. So waren sie sich nicht zu blöd, sich über meine Haare oder meine Klamotten lustig zu machen. Ich fand bald heraus, dass es für diese Arroganz und Selbstgerechtigkeit überhaupt keine Grundlage gab. Sie waren nicht erfolgreich, einfach nur respektlos. Wenn du nicht einer Meinung mit meiner Mutter warst, dann sagte sie einfach nur: „Oh, ich bitte dich“, was sie mit verachtungsvollem Ton ausstieß, um dir klarzumachen, dass deine Meinung nicht im Geringsten zählte.
Die Eltern meines Vaters stammten aus Polen. Er war das jüngste von vier Kindern. Mein Dad erzählte mir, dass sein ältester Bruder – Jack – als Buchmacher arbeitete und Alkoholiker war. Sein anderer Bruder – Joe – litt immer schon unter unkontrollierbaren manischen Stimmungsschwankungen, die ihn sein ganzes Leben lang stark einschränkten. Außerdem hatte Dad noch eine Schwester namens Monica, die anscheinend dem Druck ihrer Mutter nachgab, nicht das heimische Nest zu verlassen, und ihr Leben lang unverheiratet blieb. Schon als Kind fand ich diese Erwartungshaltung meiner Großmutter ziemlich selbstsüchtig. Mein Dad erzählte mir auch von einer schwierigen und unglücklichen Kindheit. Er verabscheute seinen Vater, der schon vor meiner Geburt verstorben war.
Meine Eltern waren keine glücklichen Menschen. Ich weiß nicht, worauf ihre Ehe beruhte, außer dem, was später als Co-Abhängigkeit bezeichnet werden sollte. Es gab keine Wärme oder Zuneigung bei uns. Freitag war meist der schlimmste Tag der Woche. Mein Vater regte sich auf, und das Resultat war unvermeidlich: Meine Eltern zerstritten sich und daraufhin sprach mein Vater dann das ganze Wochenende kein Wort mit meiner Mutter. Wenn man sich eine Stunde lang so benimmt, ist das schon kindisch, aber es ist echt verrückt, seine eigenen Eltern tagelang so zu sehen.
Zusätzlich zu den Problemen, die sie selbst miteinander hatten, beschäftigte meine Eltern auch noch meine Schwester, die jahrelang zwischen Nervenheilanstalten und zu Hause pendelte. Da ich als das gute Kind galt, bekam ich immer weniger Aufmerksamkeit von meinen Eltern. Das gute Kind zu sein hieß in meinem Fall nicht, gelobt zu werden – es bedeutete, dass ich ignoriert wurde. Deshalb ließ man mich so ziemlich alles tun, was ich wollte. Das gab mir nicht wirklich ein Gefühl von Sicherheit. Sicherheit kommt von Grenzen und Regeln – ohne solche fühlte ich mich verloren, ungeschützt und verletzlich. Ich wollte keine meiner Freiheiten und genoss sie nicht. Eigentlich war genau das Gegenteil der Fall: Ich war fast wie gelähmt vor Angst, weil niemand da war, um mir zu sagen, dass ich mich in Sicherheit befand.
Ich war sehr oft allein. Jeder neue Tag brachte Unsicherheit mit sich, als würde ich mich ohne Fangnetz über einem Abgrund bewegen. Jedes Mal hieß es, dass ich mich einer Welt stellen musste – für die ich mich aber unzureichend gerüstet fühlte. Und ich musste mir große Mühe geben, die unausgesprochenen Botschaften, die ich zu Hause erhielt, zu dechiffrieren.
In der Musik fand ich meine Zuflucht.
Musik war eines der wenigen großartigen Geschenke, das ich von meinen Eltern erhielt – dafür werde ich ihnen auch immer dankbar sein. Sie gaben mir zwar oft das Gefühl, wie ein Schiffbrüchiger zu treiben, aber trotzdem warfen sie mir – ohne es zu wissen – ein Rettungsseil zu. Ich werde nie vergessen, wie ich zum ersten Mal Beethovens 5. Klavierkonzert in Es-Dur hörte. Ich war fünf Jahre alt und war total von den Socken. Meine Eltern machten Kunst und Kultur zu einem natürlichen Bestandteil unseres Lebens. Sie liebten klassische Musik. Sie hatten eine große hölzerne Musiktruhe von Harman/Kardon und lauschten am liebsten den Klängen von Komponisten wie Sibelius, Schumann oder Mozart. Aber es war vor allem Beethoven, der mich in Staunen versetzte.
An den Wochenenden hörte ich mit meiner Mom Live from the Met auf WQXR, eine Tradition, die sich auch fortsetzen sollte, als ich älter wurde. Sobald ich begann, Radio zu hören, entdeckte ich auch den Rock ’n’ Roll. Egal, ob Eddie Cochran, Little Richard oder Dion & The Belmonts – es war reinste Magie. Sie sangen über das Leben der Teenager, von dem ich sogleich zu träumen anfing. All diese Oden an eine idyllisch verklärte Vorstellung von Jugendlichkeit berührten mich sehr. Sie erfüllten mich mit Vorfreude auf meine eigene Zeit als Teenager und transportierten mich an einen wunderbaren Ort, an dem die größten Sorgen den Beziehungen und der Liebe galten. Mensch, was für ein perfektes Leben diese jungen Leute haben mussten!
Eines Nachmittags ging ich mit meiner Großmutter spazieren. Wir überquerten die Brücke in die Bronx, wo ein Schallplattenladen lag. Wir gingen hinein und meine Großmutter spendierte mir meine allererste Schallplatte, eine Shellack-Single, die auf 78 Umdrehungen in der Minute lief: „All I Have to Do Is Dream“ von den Everly Brothers.
When I want you to hold me tight …
Während die meisten anderen Kinder durch die Nachbarschaft tollten und Cowboy und Indianer spielten, saß ich drinnen und hörte wie besessen Sachen wie „A Teenager in Love“ und „Why Do Fools Fall in Love“. Eine Zeit lang wurden viele alte Standards in Doo-Wop-Versionen neu eingesungen und ich war richtig genervt, wenn meine Mom einen davon in der Wohnung vor sich hin trällerte. „So geht der nicht, Mom! Hör zu, der geht so …“ Dann sang ich etwa den „dip da dip dip dip“-Teil aus „Blue Moon“, einem Klassiker aus den Dreißigerjahren, in der Version der Marcels. Manchmal gab sie sich respektlos gegenüber dem neumodischen Kram, doch zumeist fand sie es einfach nur amüsant.
Und dann sah ich schließlich auch einige der Sänger und Bands, die mir so gefielen, mit eigenen Augen.
Der berühmte Rock-’n’-Roll-DJ Alan Freed begann ungefähr gleichzeitig mit Dick Clarks neuer landesweit ausgestrahlten Sendung American Bandstand im Fernsehen aufzutreten. Die Wildheit und die Gefahr, die etwa ein Jerry Lee Lewis ausstrahlte, ließen mich alles andere als kalt – zum Beispiel, wenn er seinen Piano-Schemel wegtrat und seine Haare mit einer Kopfbewegung herumschleuderte. Was allerdings dochan mir vorbeiging, war die Sexualität der Musik. Das war auch nicht sonderlich überraschend angesichts dessen, was ich von zu Hause kannte. Die romantische Fantasie, die mir vorschwebte, war rein und steril, und sogar als ich älter wurde, behielt ich diesen Blick auf die Welt bei. Es sollten noch viele, viele Jahre vergehen, bis ich begriff, wovon ein Song wie „Will You Still Love Me Tomorrow“ von den Shirelles tatsächlich handelte.
Und trotzdem waren all diese Leute cool. Sie waren cool, weil sie sangen. Sie waren auch deswegen cool, weil ihnen andere ihre Aufmerksamkeit schenkten und ihnen zujubelten. In Form ihres Publikums hatten diese Musiker alles, nach dem ich mich als kleiner Junge verzehrte.
Bewunderung. Wow!
Außer uns lebten noch ein paar andere jüdische Einwandererfamilien im Norden Manhattans, aber die Gegend war überwiegend irisch geprägt. Unsere unmittelbaren Nachbarn waren zwei liebenswürdige katholische Schwestern namens Mary und Helen Hunt, die beide nie geheiratet hatten. Sie wurden zu so etwas wie Großmütter oder Tanten für mich. Als mein Zwang, es meinen neuen Idolen gleichzutun, stärker wurde, ging ich regelmäßig zu ihnen rüber in ihr Apartment, um für die beiden zu singen und zu tanzen. Sobald ich irgendeinen Song gelernt hatte, klopfte ich bei ihnen und trug ihn vor, während ich mich selbst mit einer kleinen Choreografie begleitete, was hieß, dass ich zumeist von einem auf das andere Bein hüpfte.
Wenn ich sang, milderte es vorübergehend meine Zweifel und meinen Schmerz.
Es fühlte sich einfach so richtig an.
Es war einmal … Paul „Starchild“ Stanley als Baby.
Meine Schwester, mein Dad und ich im Inwood Hill Park in der Nähe unseres Apartments, Uptown Manhattan, 1952.
Mit Mom und Dad im Lake Mohegan, New York.
Oberste Reihe, dritter von links: Meine Baseballspieler-Pose auf dem Klassenfoto der ersten Klasse. PS 98, 1958.
Kurz bevor ich mit acht in die dritte Klasse kam, übersiedelte meine Familie von Manhattan in ein jüdisches Arbeiter-Wohngebiet am hinteren Ende von Queens. So etwas hatte ich noch nie gesehen – Bäume umrandeten den Block und wuchsen direkt aus dem Gehsteig heraus. Und gegenüber an der Straße lag eine Baumschule, die einen ganzen Block einnahm. Anfangs dachte ich, dass da ein Förster herumstreifen müsste. Oder Lassie.
Die meisten Erwachsenen aus der Gegend fuhren zum Arbeiten nach Manhattan, aber dennoch funktionierte die Nachbarschaft wie in einer Kleinstadt mitten im Nirgendwo. Auf einer Länge von nur ein paar Blocks, die von Bäumen gesäumt waren, befanden sich eine Bücherei, ein Postamt, ein Metzger, eine Bäckerei, ein Schuhgeschäft, ein Lebensmittelmarkt, ein Spielzeugladen, ein Haushalts- und Eisenwarengeschäft, eine Pizzeria und ein Eissalon. Allerdings fiel mir auf, dass etwas fehlte: ein Plattenladen.
Die meisten Gebäude waren zweigeschossig. Manche waren als Doppelhäuser gebaut, andere – so wie unseres – waren in vier Apartments unterteilt, wovon sich zwei im Parterre (mitsamt straßenseitigem Garten) und zwei im ersten Stock befanden. Ich teilte mir immer noch ein Zimmer mit meiner Schwester Julia, aber meine Eltern hatten nun endlich ihr eigenes Schlafzimmer. Es lebten auch viele Kinder in der Gegend.
Meine neue Schule war die PS 164. In den Schulbänken saßen jeweils zwei Kinder. Ich betete darum, dass mich die Lehrer auf die rechte Seite des Pults setzen würden, damit meine Banknachbarn mein linkes Ohr – mein gutes – zu Gesicht bekämen. Ich wollte nicht, dass jemand das, was ich für meine schlechte Seite hielt, sehen konnte – mal ganz abgesehen davon, dass ich niemanden hören konnte, der mich von meiner gehörlosen Seite ansprach.
Irgendwann während des ersten Schultags rief mich eine Lehrerin namens Mrs. Sondike zum Lehrerpult, um mein Ohr zu begutachten.
Oh Gott, bitte tun Sie das nicht.
„Lass mich einen Blick auf dein Ohr werfen“, sagte sie.
Nein, nein, nein!
Sie nahm mich in Augenschein wie ein wissenschaftliches Präparat.
Es war mein schlimmster Albtraum. Ich war wie versteinert. Völlig am Boden zerstört.
Was soll ich bloß machen?
Voller Verzweiflung wollte ich meinen Mund aufmachen und sagen: „Tun sie das nicht.“ Aber ich blieb stumm. Ich atmete tief ein und wartete darauf, dass es vorbei war.
Wenn ich es ignoriere, dann existiert es nicht. Behalte deinen Schmerz für dich!
Kurze Zeit nach diesem Vorfall ging ich mit meinem Vater spazieren.
„Dad, findest du, dass ich gut aussehe?“
Er wirkte überrascht. Er blieb stehen und senkte seinen Blick.
„Nun“, sagte er, „du siehst nichtübel aus.“
Danke.
Zehn Punkte für meinen Dad! Das war genau die Art Aufmunterung, die ein hoffnungslos verunsicherter junger Einzelgänger wie ich nötig hatte. Leider wurde das zur Norm bei meinen Eltern.
Ich fing an, eine Mauer um mich herum hochzuziehen. Ich stieß die Kinder vorsorglich von mir weg. Ich fing an, mich wie ein Klugscheißer oder Clown aufzuführen, bis letztlich niemand mehr gerne in meiner Nähe war. Ich wünschte mir einerseits, nicht immer alleine zu sein, aber andererseits tat ich Dinge, die die Leute von mir fernhielten. Mein innerer Konflikt war mitunter qualvoll. Ich war hilflos. Viele andere Kinder aus der Nachbarschaft besuchten gemeinsam den Hebräischunterricht, was ihre Freundschaften aus der Schule 164 vertiefte bzw. zu neuen Bekanntschaften abseits der Schule führte. In meiner Familie zündeten wir Kerzen an und feierten oberflächlich jüdische Feiertage, aber sehr religiös waren wir nicht. Ich hatte auch keine Bar-Mizwa. Aber der Grund, warum ich nicht dorthin ging, hatte nichts mit alldem zu tun. Ich sagte meinen Eltern ganz einfach, dass ich keine Lust darauf hatte. Allerdings klärte ich sie nicht über das Warum auf: Klar, ich fühlte mich schon als Jude, aber ich wollte nicht noch mehr Leuten ausgesetzt sein. Das Leben war auch so schon trist genug, da musste ich mich nicht noch in zusätzliche Situationen bringen, in denen ich durch die Angst vor Demütigung wie gelähmt gewesen wäre.
Okay, die Schule ist um drei vorbei. Wie wärs denn mit einer Zugabe um halb vier mit ein paar anderen Kindern? Großartig.
Die Schule hatte einen Glee-Club, eine Art Schulchor, der mich interessierte. Eine Chance zu singen! Jedes Jahr studierte man dort ein Musical ein, und jeder durfte für eine Rolle vorsingen. Gleich im ersten Jahr entschloss ich mich, mein Glück zu versuchen. Als ich an der Reihe war, ging ich auf die Bühne, die sie im Schulsaal hatten, und öffnete den Mund, um vor all den anderen Leuten meine Stimme ertönen zu lassen. Jedoch war alles, was herauskam, ein schwaches Piepsen. So landete ich schließlich, statt eine eigene Rolle zu bekommen, im Chor – als einer der Matrosen in HMS Pinafore oder was auch immer. Ich bewarb mich jedes Jahr für eine Rolle in einer dieser Inszenierungen, aber jedes Mal blieb mir beim Vorsingen die Stimme im Hals stecken – ein kleines Stimmchen war alles, was ich hervorbrachte. Also sang ich jedes Mal im Chor, obwohl ich wusste, dass ich die meisten der anderen Schüler, die sich die Hauptrollen sicherten, hätte an die Wand singen können.
Auch Pfadfinder gab es an meiner Schule. Nachdem ich ein paar meiner Mitschüler in ihren blauen Uniformen gesehen hatte, dachte ich darüber nach, mich ihnen anzuschließen, und als ein neuer Freund namens Harold Schiff ebenfalls in Uniform aufkreuzte, nahm ich sein Angebot an, ihn auf eines der Treffen zu begleiten. Harold gehörte zu den Mainstream-Kids, freundete sich aber auch mit ein paar Außenseitern wie mir an. Und er verstand sich gut mit einigen anderen Jungs aus der Pfadfindergruppe. So etwa mit Eric London, der mit ihm gemeinsam im Schulorchester spielte, oder mit Jay Singer, der Klavier lernte. Ich hatte Eric und Jay zwar im Glee-Club kennengelernt, aber ihre Freundschaft mit Harold basierte hauptsächlich auf dem gemeinsamen Besuch des Hebräischunterrichts. Ich blieb lieber für mich. Auch wenn ich mal wo mitmachte, hielt ich mich eher am Rande des Geschehens auf.
Jeder bei den Pfadfindern war hinter Leistungsabzeichen her. Es gab zum Beispiel welche für Fertigkeiten im Knotenbinden oder dafür, alten Ladys über die Straße zu helfen. Mir war das eigentlich scheißegal. Mich interessierte nur das Camping. Und das machten wir auch immer wieder an den Wochenenden. Ich hatte aber stets ein Problem, wenn ich bei Wanderungen die anderen aus den Augen verlor. So fand ich heraus, dass man keinen Orientierungssinn hat, wenn man halbseitig taub ist. Ich erinnere mich, dass ich auf einer Lichtung stand und jemanden rufen hörte: „Wir sind hier drüben!“ Ich hatte null Ahnung, woher die Stimme gekommen war. Ohne die Fähigkeit, die Herkunft von Geräuschen zu peilen, war das unmöglich. Ich fühlte mich ausgeliefert, da ich nicht wusste, wo ich war. Wieder einmal fühlte ich mich verloren.
Mein Instinkt sagte mir, ich müsste mich an meine Eltern halten, aber immer, wenn ich von so einer Situation zu ihnen kam und nach Sicherheit suchte, ließen sie mich wieder hängen. „Ignoriere es, dann wird schon alles gut“, blieb das Credo unseres Haushalts. Die alte Leier. Ich hätte mich über etwas mehr Rückendeckung anstelle von Haue gefreut, aber da war einfach nichts zu machen. Meine Eltern weigerten sich standhaft, meine Probleme wahrzunehmen, obwohl sie nicht von der Hand zu weisen waren. Ich schlafwandelte zu Hause. Manchmal kam ich dann in der Nacht zu mir und realisierte, dass ich im Wohnzimmer stand. Manchmal bekam ich auch mit, wie mich meine Eltern zurück in mein Zimmer führten. Sie wussten Bescheid, wollten es aber nicht wahrhaben, und was wirklich schieflief, wollten sie gar nicht wissen.
Ich hatte auch zwei wiederkehrende Albträume. In einem davon war es stockfinster und ich befand mich auf einem Schwimmdock auf einer riesigen Wasserfläche, weit von jeder Küste entfernt. Ich war gestrandet und ganz allein. Schließlich schrie ich um Hilfe. Nacht für Nacht. Ich wachte dann schreiend in meinem Bett auf.
Im zweiten Albtraum saß ich auf der Fahrerseite eines Autos, das einen dunklen, leeren Highway entlang schoss. Das Gefährt hatte kein Lenkrad. Ich versuchte es durch Gewichtsverlagerung zu manövrieren, aber hatte letztlich keine Chance, es unter Kontrolle zu bringen.
Jede Nacht weckten mich diese Albträume ruckartig, sodass ich schrie, verwirrt und zu Tode erschrocken war.
Auch der Zustand meiner Schwester verschlechterte sich zusehends. Als ich in die Junior-High kam, wurde Julias Verhalten immer selbstzerstörerischer. Meine Eltern begannen, sie vorübergehend in staatliche Heilanstalten zu geben. Nachdem das wenig Wirkung zeigte, gaben sie ein Vermögen für eine teure psychiatrische Privatklinik aus. Wenn sie zu Hause war, büxte sie oft aus und meine Eltern verbrachten ihre Tage damit, sie zu suchen. Ab und an wachte ich morgens auf und sah, dass meine Eltern wieder einmal keinen Schlaf gefunden hatten. Ich wunderte mich dann: Wird sie das alles noch umbringen?
Julia hing zumeist im East Village ab, schlief in den Wohnungen diverser Leute und nahm Drogen und Medikamente. Als sie einmal wieder bei uns war, klaute sie die Silberdollars, die meine Mutter in einer Schublade gesammelt hatte, um sich Medikamente zu besorgen. Ich weiß mittlerweile, dass das, was sie tat, Selbstmedikation heißt, aber damals durchblickte ich das Ganze nicht wirklich. Wenn sie weg war, war sie weg. Und wenn sie da war, hatte ich Schiss vor ihr.
An einem Nachmittag holten meine Eltern Julia von einer Einrichtung ab, wo man sie einer Elektroschock-Therapie unterzogen hatte – und ließen mich mit ihr allein. Sie lieferten sie einfach bei uns ab und ließen mich mit dieser Spinnerin von Schwester, die gerade einmal ein paar Stunden aus der Nervenheilanstalt draußen war, alleine zurück! Während sie weg waren, wurde Julia sauer und jagte mich mit einem Hammer bewaffnet durch die Wohnung. Ich hatte eine Heidenangst.
O Gott, kommt doch endlich zurück.
Dann hörte ich einen Mordskrach. Julia schwang den Hammer wie wild gegen die Tür und ließ nicht mehr locker.
Bäng! Bäng! Bäng!
Sie hämmerte mit voller Kraft, bis das Holz nachgab und splitterte. Dann hörte sie plötzlich auf. Der Hammer war im Holz steckengeblieben, und auf einmal herrschte Stille. Ich kauerte mich zusammen und zählte die Minuten und Stunden.
Werden sie kommen, bevor es wieder losgeht?
Dann kamen sie endlich.
„Was ist denn hier passiert?“, fragten sie. Ich erklärte ihnen, dass Julia mich mit einem Hammer verfolgt hatte. Aber nun fuhren sie mich an, als ob es meine Schuld gewesen wäre. Zuerst schrien sie mich an, dann schlugen sie mich. Ich hatte solche Angst gehabt, und nun kannte ich mich überhaupt nicht mehr aus.
Ihr habt mich mit ihr allein gelassen! Das war eure Entscheidung, nicht meine! Sie hat versucht, mich umzubringen!
Auch die Schule war weiterhin eine Herausforderung. Noch in der Grundschule wurde ich in den Begabtenzweig geschickt, und auch in der Junior-High landete ich wieder in der Begabtenklasse.
Ich hätte das nicht auf Grundlage meiner Noten geschafft, da ich kein sehr guter Schüler war, jedoch öffnete mir eine Art Intelligenztest die Tür in diese Klasse. Obwohl mein IQ es rechtfertigte, dass ich die Begabtenklasse besuchte, war ich einer der schlechteren Schüler dieses Zweigs. Ich denke, alle wunderten sich über mich und dachten, dass ich nicht lernen wollte. Was allen verborgen blieb, war, dass mein Gehör einen schrecklichen Nachteil für mich darstellte. Vieles konnte ich einfach gar nicht wahrnehmen. Und wenn ich erst einmal einen Satz überhört hatte, kannte ich mich nicht mehr aus. Sobald ich den roten Faden verloren hatte, gab ich auf.
Bei Elternabenden erzählten meine Lehrer meinen Eltern stets dasselbe: „Er ist intelligent, aber er bringt sich nicht ein“, oder „Er hat Köpfchen, aber er schöpft sein Potenzial nicht aus.“ Kein Lehrer sagte jemals: „Er ist ein aufgeweckter Junge, aber er kann nicht verstehen, was ich sage.“
Damals blieben derartige Einschränkungen einfach unbemerkt.
Andererseits: Meine Eltern wussten, dass ich auf einer Seite taub war – und trotzdem kamen sie nach jedem Elternabend nach Hause und rügten mich: „Gott hat dir dieses wundervolle Gehirn geschenkt und du benutzt es nicht.“
Ich weinte und fühlte mich schuldig. „Ab morgen werde ich mich bessern“, gelobte ich.
Zweifellos ein guter Vorsatz. Dann ging ich am nächsten Tag in die Schule und war immer noch taub, worauf ich mich bald wieder wie ein Loser fühlte.
Ich wusste, dass die Dinge einen üblen Verlauf nehmen würden, wenn ich nichts unternahm. Sollte das bedeuten, dass ich scheitern würde? Dass ich mich umringen würde? Ich war mir nicht sicher. In diesem Unglück zu leben, eine Lüge zu leben, andere Menschen darunter leiden zu lassen – ich wusste, dass das alles falsch war. Ich wusste nicht, wo es enden würde, aber ich wusste, dass es schlecht enden würde. Es war eine schreckliche Lage, die mich vor allem in der Nacht sehr beschäftigte. Zusätzlich zu den Albträumen und dem Schlafwandeln wurde ich nun auch noch ein Hypochonder: Ich dachte, ich würde abkratzen. Ich lag nachts wach und hatte Angst einzuschlafen, weil ich befürchtete, nicht mehr aufzuwachen. Irgendwann döste ich dann doch ein, da ich meine Augen nicht mehr offenhalten konnte. Das wiederholte sich jede Nacht.
Du stirbst. Du steckst in der Scheiße.
Dann – sieh da! – bekam ich mein erstes Transistorradio. Es eröffnete mir den Zugang in ein ganz neue Welt, in die ich gehen konnte, wann immer ich den Ohrhörer in mein funktionierendes linkes Ohr steckte. Musik gewährte mir wieder einmal Zuflucht und bescherte mir zumindest ein flüchtiges Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit.
Und im Februar 1964, ein paar Wochen nach meinem zwölften Geburtstag, sah ich die Beatles in der Ed Sullivan Show. Als ich ihren Auftritt verfolgte, durchfuhr es mich: Das ist meine Fahrkarte in die Freiheit. Hier war das Transportmittel, das mich aus dem Unglück führen und mit dessen Hilfe ich berühmt, bewundert und beneidet werden würde.
Und ohne jegliche rationale Grundlage war ich überzeugt: Das kann ich auch. Ich kann in dieselbe Kerbe schlagen. Ich hatte noch nie zuvor Gitarre gespielt und schon gar keinen Song geschrieben. Und doch war dies mein Ticket in die Freiheit.
Ich wusste es einfach.
Ich fing sofort an, mir die Haare wachsen zu lassen, da ich eine Pilzkopffrisur wie die Beatles anstrebte. Natürlich tat ich dies nicht nur, weil mir der Schnitt gefiel, sondern auch, um mein Stummelohr auf der rechten Seite meines Kopfes zu verbergen. Irgendwie ging dieses Motiv völlig an meinen Eltern vorüber. Sie gingen mir wegen meiner Haare auf die Nerven und drohten mir, sie mir abzuschneiden.
An einem Nachmittag, kurz nachdem ich die Beatles bei Ed Sullivan gesehen hatte, traf ich einen Jungen aus meiner Nachbarschaft namens Matt Rael. Er erzählte mir, dass er eine E-Gitarre besäße und Musik machte. Er war eine Klasse unter mir, aber ich war trotzdem sehr beeindruckt. Ich brauchte nun auch eine E-Gitarre, damit ich ebenfalls Musik machen konnte. Und bald hatte ich auch eine Idee, um an so ein Instrument ranzukommen: Die nächsten elf Monate, während die British Invasion nicht nur die Beatles, sondern auch die Dave Clark Five, die Kinks, die Rolling Stones, die Searchers, Manfred Mann, Gerry and the Pacemakers, die Animals und viele andere zu uns brachte, lag ich meinen Eltern in den Ohren, mir zu meinem 13. Geburtstag eine E-Gitarre zu schenken.
„Das ist mein größter Wunsch“, erklärte ich ihnen.
Ich sollte noch herausfinden, dass ich besser geeignet war, ein eigenes Team zu haben, als nur in einem zu spielen.
Meine Schwester (14) und ich (12) stehen vor unserem Wohnhaus in der 75th Road in Queens … und sind angezogen, als wollten wir bei den Sopranosmitspielen.
Am Morgen des 20. Januar 1965 erwachte ich voll Aufregung. Endlich meine E-Gitarre! „Sieh unter dem Bett nach“, sagte meine Mom. Ich schaute erwartungsvoll unters Bett. Dort sah ich einen Karton, der, von der Form her, etwas zu enthalten schien, das wie ein akustische Gitarre aussah.
In mir stieg Enttäuschung hoch.
Ich zog den Karton unter dem Bett hervor. Ohne jeden Zweifel, es war eine gebrauchte japanische Akustikgitarre, die mit Nylonsaiten bespannt und mit ein paar notdürftig geflickten Rissen übersät war. Ich war am Boden zerstört und schob die Kiste samt Gitarre zurück unters Bett. Ich wollte nicht darauf spielen.
Meine Eltern entstammten Familien, denen es sinnvoller erschien, Kinder am Boden zu halten, als ihnen Hochgefühle zu verschaffen. Das war ihr Erziehungsansatz. Sie schenkten mir aus Prinzip nicht das, was ich mir gewünscht hatte, obwohl es für sie nicht schwieriger gewesen wäre. Ich glaube, sie hatten verhindern wollen, dass mir die Erfüllung meines Wunsches zu Kopfe stieg.
Nachdem ich die Gitarre verschmäht hatte, begannen sie, mir Schuldgefühle einzureden – wobei sie ihre eigene Rolle in dieser riesengroßen Enttäuschung niemals anerkannt hätten.
Mein Freund von den Pfadfindern, Harold Schiff, bekam ein paar Wochen später eine E-Gitarre – eine hellblaue Fender Mustang mitsamt einem Perlmutt-Pickguard. Er gründete dann sofort eine Band. Und er wollte mich als Sänger!
Harolds Freunde Eric London und Jay Singer, die ich ein wenig vom Glee-Club und den Pfadfindern kannte, stiegen auch ein. Eric spielte Kontrabass im Schulorchester und zupfte nun dasselbe Instrument auch bei uns. Jay, der Klavierunterricht bekam, hatte seit Kurzem ein elektrisches Keyboard, eine Farfisa-Orgel. Harold holte noch einen weiteren Jungen dazu, den er aus dem Hebräischunterricht kannte. Er hieß Arvin Mirow und sollte Schlagzeug spielen. Auch ihn kannte ich aus dem Glee-Club. Dann schlug ich vor, dass wir noch Matt Rael, der Tür an Tür mit Eric wohnte, dazuholen sollten. Er wurde unser Leadgitarrist. Matt und ich waren die einzigen Jungs aus dieser Truppe, deren Eltern nicht irgendwelche Doktoren waren.
Anders als wir wohnten die Familien von Harold und Matt nicht in Apartments, sondern hatte eigene Häuser, die auch unterkellert waren. Matts älterer Bruder Jon hatte ebenfalls eine Band – seine Eltern waren sehr tolerant gegenüber dem Krach. Auch Harolds Mom war Lärm egal. Außerdem konnten wir den Keller der Schiffs alleine benutzen, sodass wir uns dort zuerst einquartierten. Der Kellerraum war fein eingerichtet – die Wände waren mit hübschen Holzpaneelen ausgekleidet, der Boden war mit Linoleum ausgelegt, und es gab sogar ein Fenster. Außerdem führte eine Tür hinaus zum Hinterhof.
Harold und Matt steckten ihre Gitarren im selben Verstärker an, und meine Stimme lief über den Amp, der auch Jay Singers Keyboard abnahm. Ich schlug, wenn ich sang, auch gegen ein Tamburin – etwas, was man oft im Fernsehen sah. Eric musste nur den Bass so laut wie möglich zupfen. Wir versuchten uns an Songs wie „Satisfaction“ von den Stones und anderen Songs von Bands der British Invasion, wie etwa den Kinks und den Yardbirds. Um größtmöglichen Nutzen aus Jays Farfisa zu ziehen, lernten wir auch „Liar, Liar“ von den Castaways.
Ich liebte es von Anfang an. Obwohl alle Kids damals vage davon träumten, Rockmusiker zu sein – die Beatles und die Stones standen Pate für diesen Wunsch –, so hatten doch ihre Eltern ihren Lebensweg bereits vorausgeplant. Diese Kinder sollten Zahn- oder Augenärzte werden, so wie ihre Eltern auch. Eine Band war nicht mehr als ein Jux für sie.
Aber ich wurde nicht müde zu betonen: „Ich werde ein Rockstar!“
Matt Rael und ich begannen, regelmäßig im Haus seiner Familie abzuhängen. Wir übten teils selbst, teils waren wir bei den Proben der Band seines Bruders Jon dabei. Matt und ich machten so oft Musik bei ihm zu Hause, dass seine Mom einen Deal mit uns aushandelte: Wenn wir ein altes Bücherregal, das sie in Upstate New York gekauft hatte, etwas aufpolierten, dürften auch wir ihren Keller offiziell als Proberaum benutzen. Wir ließen uns nicht zweimal bitten, kratzten die alte weiße Farbe von dem Möbelstück und übten weiter in ihrem Keller.
Matts Eltern waren so etwas wie Ur-Hippies. Seine Mom hatte sogar auf den ersten Aufnahmen der Weavers mitgesungen und war mit Pete Seeger befreundet. Sie hatte auch auf Woody Guthries Kinder aufgepasst. Zur Zeit, als ich Matts Eltern kennenlernte, buchte seine Mom immer noch prominente Folk- und Bluesmusiker für Musikfeste in Manhattan, darunter Leute wie Sonny Terry, Brownie McGhee und Leadbelly. Und natürlich auch Pete Seeger.
Ich hörte wie besessen Radio und kannte die aktuellen Hits, aber bei Matt kam ich in Kontakt mit der unglaublichen Folksammlung seiner Eltern. Sie hatten tonnenweise Country-Blues und ganz alte, traditionelle Sachen sowie zeitgenössischen Folk, etwa von Bob Dylan, Eric Andersen, Tom Rush, Phil Ochs, Buffy St. Marie und Judy Collins. Schließlich kramte ich meine Akustikgitarre doch wieder unter dem Bett hervor und Matt brachte mir ein paar Akkorde bei. Dann nahm ich auch ein paar Stunden bei einer Frau, die in einer Lokalzeitung inseriert hatte. Der erste Song, den ich spielen konnte, hieß „Down in the Valley“. Bald schon hatte ich eine Mundharmonika um den Hals und versuchte, die Folkmusic, die ich bei Matt zu Hause gehört hatte, zu imitieren.
Auch die Band probte weiterhin, und im Sommer 1965 hatten wir unseren ersten Auftritt. In diesem Jahr wurde ein neuer Bürgermeister gewählt, und John Lindsays Wahlkampfteam hatte ein Büro bei uns in der Nachbarschaft eröffnet. Es war in einem Laden untergebracht und war nichts außer einem hell erleuchteten Raum.
Harold half freiwillig im Wahlkampf aus und teilte Flugzettel aus – ich glaube, er hielt das für eine reife und coole Tätigkeit.
Eines Tages sprach einer der Typen, der das Wahlkampfbüro leitete, davon, ein Fest zu veranstalten. Er erwähnte auch, dass man dafür ein Unterhaltungsprogramm auf die Beine stellen müsste. Obwohl er sich dabei nicht unbedingt auf Harold bezog, machte dieser sich nun bemerkbar und verkündete: „Ähm, ich hätte da eine Band.“
Sie luden uns auch tatsächlich ein, bei dieser Veranstaltung aufzutreten. Ich nehme an, dass es sich für die Demokraten ganz gut machte, ein paar Kids aus der Nachbarschaft spielen zu lassen. Wir bekamen keine Gage und es kamen auch nicht viele Leute vorbei, aber es war ein Gig. Mein erster Gig!
Hin und wieder, wenn wir probten, brachte mir Harold Barré-Akkorde auf seiner Fender Mustang bei. Die Grundlagen waren ziemlich einfach, aber wenn ich gewusst hätte, wie lange ich brauchen würde, um ein einigermaßen annehmbarer Gitarrist zu werden, hätte ich es wohl gleich wieder sein lassen. Damals allerdings fühlte ich mich wie getrieben. Ein bisschen Krach im Keller zu machen war ganz cool, aber ich wollte meine eigene E-Gitarre haben und Nägel mit Köpfen machen. Ich begann, so oft wie möglich mit der U-Bahn nach Manhattan zu fahren, um die Musikläden in der 48thStreet nach erschwinglichen Gitarren zu durchstöbern.
Diese Ausflüge wurden zu so etwas wie Pilgerreisen für mich. Zwischen der Sixth und Seventh Avenue säumten kleine Instrumentengeschäfte beide Seiten der 48thStreet. Und einen Block weiter, an der der Ecke 49thStreet und Seventh Avenue, gab es einen Sandwich-Laden namens Blimpies. Dort holte ich mir ein Sandwich oder bei Orange Julius einen Texas-Chili-Dog, der nur so vor zähflüssigem Käse triefte. Dann machte ich mich auf die Suche nach Gitarren. Damals durfte man gar nichts anfassen. Wenn man ein Instrument spielen wollte, erkundigten sich die Angestellten erst einmal, ob man vorhatte, etwas zu kaufen. Wenn man nicht so aussah – wie etwa in meinem Fall –, dann forderten sie einen auf: „Zeig mir, ob du Geld dabei hast.“ Deswegen ging es bei diesen Trips eigentlich nicht darum, auf Instrumenten zu musizieren, sondern darum, die Ausrüstung einer Rock-’n’-Roll-Band zu bestaunen: Schlagzeug, Gitarren, Bässe. Und manchmal erspähte man sogar einen Musiker, den man aus dem Fernsehen oder einem der Magazine, die ich anfing zu sammeln, kannte. Ich war dann wie im Himmel.
Als die Junior-High voranschritt, begann ich die Schule zu schwänzen, um immer öfter die 48thStreet anzusteuern. Ich kam dann schon früh am Morgen an, noch bevor die Läden geöffnet hatten – deshalb ging ich, der jüdische Junge, dann schnurstracks in die St. Patrick’s Cathedral an der Ecke 49th