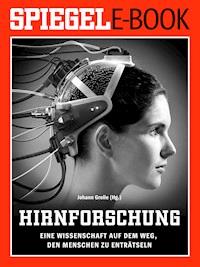Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Brücke zum Bewusstsein
Bilanz der vergangenen zehn Jahre Hirnforschung
Im Flug durch das Gehirn
Hirnforscher wollen den Schaltplan aller 100 Milliarden Nervenzellen kartieren
„Wir sind nur Maschinen“
SPIEGEL-Gespräch mit dem Neurowissenschaftler Michael Gazzaniga über die Illusion des freien Willens
Die Hirningenieure
Die Ära der Maschinenmenschen bricht an
Kompass im Kopf
Osnabrücker Forscher schenken dem Menschen einen sechsten Sinn
Die Macht des Mitgefühls
Die Fähigkeit, am Erleben anderer Menschen teilzunehmen, ist tief in unserem Gehirn verankert
„Eine fast mystische Verbindung“
SPIEGEL-Gespräch mit dem Neurowissenschaftler Christian Keysers über das Gehirn als soziales Organ
Lob der Angst
Psychologen und Hirnforscher ergründen, wie stark die Angst unsere Persönlichkeit prägt
„Messfühler ins Unbewusste“
Im SPIEGEL-Gespräch streiten der Hirnforscher Gerhard Roth und der Psychoanalytiker Otto Kernberg über Grenzen und Möglichkeiten von Therapien
Wenn die Seele dick macht
Hirnforscher entschlüsseln, wie Fettleibigkeit im Kopf entsteht
Heilen mit dem Geist
Schulmediziner entdecken die Heilkraft positiver Gedanken
Großhirn-Voodoo
Die trügerische Bilderflut der Kernspintomografen
Gefangen im Jetzt
Der „Mann ohne Gedächtnis“ gilt als berühmtester Patient der Neuropsychologie
Flattern, quieken, zucken
Neurobiologen hoffen, Autismus könne helfen, das Hirn zu verstehen
Superhelden aus dem Museum
Super-Recognizer haben die Fähigkeit, sich an fast jedes Gesicht erinnern zu können
Versöhnung mit der Heimat
Hirnforscher und Nobelpreisträger Eric Kandel versucht sich an einer Theorie der Neuroästhetik
Impressum
Vorwort
Aus Afrika stammt eine Affenart mit höchst bizarrem Verhalten. Ohne erkennbaren Anlass versammeln sich die Tiere, um im Verlaufe allgemeinen Schnatterns in Anfälle unwillkürlicher, krampfhafter Atemstöße auszubrechen. Das kollektive Keuchen kann so stark werden, dass es die Tiere förmlich lähmt.
Dieses im Tierreich einzigartige, groteske und unproduktive Verhalten hat die Affen nicht gehindert, zur erfolgreichsten Spezies des Planeten zu werden. In über sieben Milliarden Exemplaren bevölkern sie mittlerweile nicht nur Afrika, sondern auch alle anderen Kontinente. Ihr wissenschaftlicher Name ist Homo sapiens, das beschriebene Verhalten heißt Lachen.
Der Mensch lacht und weint nicht nur, er gebärdet sich auch sonst absonderlich. Er lässt sich durch etwas auf Papier verschmierte Tinte zu Tränen rühren. Er beobachtet stundenlang Licht, das flackernd auf eine Leinwand fällt. Und er kann eine befremdliche Passion für das Herumrücken von Holzfiguren auf einem karierten Brett oder für das Sammeln gezackter Papierschnipsel entwickeln.
Der Schlüssel zu Komik, Angst und Stolz, zu Langeweile, Abenteuerlust und Spieltrieb liegt hinter seiner Stirn verborgen: in einem grauweißen Klumpen aus Eiweiß, Kohlenhydrat und Fett, zerfurcht wie eine Walnuss, weich wie eine reife Avocado. Vor allem aber machte das Gehirn den spektakulären Erfolg des Menschen erst möglich. Deshalb ist seine Entschlüsselung zur vielleicht größten wissenschaftlichen Herausforderung des 21. Jahrhunderts geworden.
In der Tat haben die Neurobiologen Beeindruckendes vorzuweisen: Mit raffinierten Methoden gelingt es ihnen inzwischen nicht nur, einzelne Nervenzellen abzuhorchen, sie können auch in ihr Geplauder eingreifen. Sogar die Vision, einen vollständigen Schaltplan des zentralen Nervensystems anzufertigen, haben sie ins Visier genommen.
Und doch regen sich auch Zweifel: Wenn die Erkenntnisse tatsächlich so bahnbrechend sind, wie die Forscher es verkünden, warum ist dann ihr pharmakologischer Ertrag so dürftig? Wird der Aussagewert der bunten Tomografenbilder womöglich überschätzt? Und: Übernehmen sich die Hirnforscher, wenn sie inzwischen auch im Terrain der Psychologen, Pädagogen und Philosophen wildern? Sechzehn SPIEGEL-Beiträge aus den letzten vier Jahren beleuchten die Debatte.
Johann Grolle
SPIEGEL 9/2014
Brücke zum Bewusstsein
Warum es sich lohnt, das Gehirn einzuschalten, bevor man selbiges erforschen will. Von Felix Tretter
Psychiatrische Störungen machen bereits heute einen Großteil aller Krankheiten aus, mit steigender Tendenz. Es geht um Autismus oder ADHS bei Kindern, Erwachsene leiden an Süchten und Depressionen, ältere Menschen rutschen in die Demenz. Deshalb erhoffen Patienten ebenso wie Ärzte nichts sehnlicher als Fortschritte durch die Neurowissenschaften in Diagnostik und Therapie.
Auch existentielle Antworten erwarten wir von der Hirnforschung: Sie soll uns helfen, das Geistige zu verstehen. Es ist von größter Bedeutung für das Selbstverständnis des Menschen, legt es doch den Grund für die rechtliche, soziale und kulturelle Ordnung unserer Gesellschaft.
Es geht um nichts weniger als die Frage: Was ist der Mensch? Nur sein Gehirn? Viele Neurowissenschaftler glauben, diese Fragen hinreichend bearbeiten, wenn nicht gar beantworten zu können. Aber sie täuschen sich.
Vor knapp zehn Jahren wurde ein recht optimistisches, viele Dutzend Seiten langes „Manifest“ von Neurowissenschaftlern zu der damaligen Lage und zukünftigen Möglichkeiten der Hirnforschung publiziert. In der Zeitschrift „Gehirn und Geist“ wird das Jubiläum jetzt mit einem Interview gewürdigt. Gibt es einen Grund zu feiern?
Zweifellos hat in den vergangenen Jahren vor allem die experimentelle Hirnforschung an Tieren durch neue Technologien vertiefte Einblicke und Möglichkeiten des Eingriffs in das Gehirngeschehen erbracht: Mit der Optogenetik beispielsweise lässt sich die Genaktivität modulieren, mit raffinierter Elektrodentechnik lassen sich die „Gespräche“ der Neuronen registrieren. Kernspinuntersuchungen liefern Bilder vom Gehirn beim Denken, Fühlen und Handeln, und ausgefeilte Methoden der Hirnstimulation haben die psychiatrische Diagnostik und Therapie erweitert. Es geht noch weiter: Das Human Connectome Project soll einen Katalog der Faserverbindungen im Gehirn erstellen, und das mit einer Milliarde Euro ausgestattete Human Brain Project soll ein wahrhaftiges Computermodell des Menschengehirns liefern - was an sich sehr zu begrüßen wäre! Nur: Bringen solche teuren Giga-Projekte am Ende das, was wir uns davon erhoffen?
Immerhin: Auch schwere sensorische und motorische Störungen lassen sich inzwischen besser behandeln: Wir können nun Sinnesorgane - Ohr und Auge beispielsweise - nachbilden, Neuroprothesen unterstützen die Motorik. Allerdings: Diese Technologien sind keine neuen Errungenschaften der modernen Hirnforschung. Im Prinzip kennen wir sie seit den siebziger Jahren aus dem Versuchslabor. Auch die sogenannte tiefe Hirnstimulation, die sich bei Tausenden Parkinson-Kranken - allerdings nicht ohne Nebenwirkungen - bewährt hat, hat ihren Ursprung in den sechziger Jahren; Verhaltensexperimente bei Tieren zeigten ihre Wirkung.
Das Manifest versprach 2004, dass für psychiatrische Erkrankungen bald ganz spezielle, bessere Psychopharmaka zur Verfügung stünden. Diese Medikamente gab es jedoch bereits. Sie wirken leider nicht so gut, wie Ärzte es sich wünschen, außerdem haben auch sie zuweilen problematische Nebenwirkungen. Letztlich stagniert die Entwicklung von Psychopharmaka seit mehreren Jahren.
Überzogen erschien schon vor zehn Jahren die Behauptung im Manifest, man könne bereits beurteilen, „welche Lernkonzepte - etwa für die Schule - am besten an die Funktionsweise des Gehirns angepasst“ seien. Wenn das so wäre - wieso muss man dann weiterforschen? Weil man das Gehirn offensichtlich doch noch nicht so gut verstanden hat?
Zumindest aus klinischer Sicht ist also die Bilanz der vergangenen zehn Jahre Hirnforschung nicht besonders positiv. Woran liegt das? Könnte es sein, dass die Theorie der Neurowissenschaft auf ungenügend durchdachten Annahmen und Konzepten beruht? Fundierte, seriöse Brückenschläge zur Psychologie, Philosophie und Kulturwissenschaft fehlen - wie lässt sich ohne sie das Geistige begreifen?
Vier wichtige Probleme werden von Neurobiologen gewohnheitsmäßig übergangen oder ungenau beantwortet. Alles fängt an mit der Frage: Was genau ist das Geistige? Schon über das „Bewusstsein“ sind die diversen Hirnforscher sich uneinig, wie die Psychologin und Schriftstellerin Susan Blackmore gezeigt hat. Interpretationen reichen von der Wachheit über das Wissen, das Selbstbewusstsein, das phänomenale Bewusstsein bis zum sogenannten Zugriffsbewusstsein.
Wie wird aber ein solch offensichtlich heterogenes Phänomen experimentell beforscht? Bei der Untersuchung von „Wachmachern“ gegen Schlafanfälle beispielsweise kann nur die Dauer der Wachheit, die Aufmerksamkeit, die geistige Leistungsfähigkeit und die Fehlerrate gemessen werden. Damit entsteht im Labor aber nur eine Karikatur des Bewusstseins. Mit dem Erleben - wie es ist, ein Bewusstsein zu haben, bekannt als Qualia-Problem - hat dies wenig zu tun.
Die Frage ist doch: Wie finde ich für das phänomenale Erleben einen angemessenen Versuchsaufbau und passende Messmethoden? Dazu braucht es mehr als Neurobiologen und Mediziner, das ist vor allem Aufgabe von Psychologen.
Meist sind diese Fachkollegen nicht oder kaum beteiligt an den teils spektakulär erscheinenden Erkenntnissen der Hirnforschung. Und so liefern oft eindimensionale Versuche eindimensionale Ergebnisse. Die dann der Öffentlichkeit präsentiert werden, ohne Risiken und Nebenwirkungen - ein Defizit, das besonders eklatant zutage tritt, wenn es um Themen wie Liebe, Persönlichkeit oder Religiosität geht. Also: Brauchten wir nicht auch ein milliardenschweres „Human Mind Project“, um nicht ständig den Pudding an die Wand zu nageln?
Die zweite Frage, über die sich Hirnforscher nicht einig sind, lautet: Was genau ist das Gehirn? Meist ist das Großhirn gemeint. Es hat sich aber gezeigt, dass auch das Kleinhirn bei vielen geistigen Prozessen - Wahrnehmung, Denken, Gedächtnis, Aufmerksamkeit - beteiligt ist. Und was ist mit Hirnstamm und Rückenmark? Wo ist die Grenze? Wer nur das „Gehirn im Tank“ betrachtet, ignoriert, dass der Mensch über die Sinne, seinen Körper und vermittels seiner Sprache verbunden und eingebettet ist in eine soziale und kulturelle Umwelt - er lässt sich nicht auf sein Gehirn reduzieren. Zumal die Umwelt maßgeblich beeinflusst, wie sich ein Mensch entfaltet und was ihn einschränkt, kurz: was ihn krank oder glücklich macht.
QUAGGA ILLUSTRATIONS / PICTURE ALLIANCE / DPA
Ohne Gehirn ist alles nichts, das zeigt sich an Menschen mit schweren Hirnverletzungen. Aber das Gehirn ist nicht alles.
Wo im Gehirn sitzt eigentlich der Geist? Dieses - dritte - Problem der Neurowissenschaften zeigt sich immer dann, wenn es gilt, bestimmte psychische Funktionen im Gehirn zu verorten. In Studien heißt es dann, dass die Gehirnregion X an der psychischen Funktion Y „beteiligt“ sei, oder Y in X „verankert“. Hier finden Forscher Korrelationen wie die berühmte Beziehung zwischen Storchenflug und Kindsgeburten - aber verkauft werden sie als ursächliche, als Kausalbeziehungen. Dabei sind die Grundfragen noch gar nicht geklärt: ob das Gehirn das Geistige „erzeugt“ und, wenn ja, wie? Und ob das Geistige, auch wenn es etwas nicht weiter definierbar Körperliches wäre, auf das Gehirn einwirken, Handlungen steuern kann?
Zu klären ist, was notwendige und was hinreichende körperliche Bedingungen für das Psychische sind.
Unbedacht dieser Fragen wird von Neurobiologen häufig ein monistisches Bild vom Zusammenhang von Gehirn und Geist vertreten („der Geist ist das Gehirn“), aber das ist Metaphysik und aus der Philosophie der griechischen Antike wohlbekannt. Es stammt also nicht aus Erkenntnissen der Hirnforschung der vergangenen Jahre. Daher scheint es sehr hilfreich zu sein, wenn Neurobiologen die Philosophie des Geistes mit größerer Aufmerksamkeit zur Kenntnis nehmen.
Hier kommt die vierte Frage ins Spiel: Wie sollten Hirnforscher umgehen mit den Ergebnissen ihrer Versuche? Die experimentelle Methode liefert nur indirekte und höchst unterschiedliche Bilder vom räumlichen und zeitlichen Charakter der jeweiligen Gehirnprozesse. So sind die beliebten bunten Hirnbilder nicht Messungen, sondern Konstruktionen von Konstruktionen: Weil wir da etwas sehen / messen, nehmen wir an, dass da etwas geschieht, das für unsere Messung wichtig sein könnte.
Schnell übersehen wir auch, dass Sinn X eben nicht einfach nur im Gehirnort Y wohnt: Beispielsweise ist das Sehen in Dutzenden Gehirnarealen verankert. Andererseits ist ein einzelner Ort im Gehirn zuständig für mehrere psychische Funktionen zugleich: Dem präfrontalen Cortex verdanken wir Aufmerksamkeit, Handlungsplanung, Bewertungsprozesse und vieles mehr. „Sitzt“ also die Aufmerksamkeit in den hemmenden oder in den aktivierenden Neuronen? Und wenn ja, in Schicht 5 oder 4 des präfrontalen Cortex?
Die Neurobiologie stößt hier an ihre Grenzen. Solange sie erklärt, was Nervenzellen im Gehirn so machen, funktioniert sie. Sobald sie beginnt, damit seelische Zustände und Prozesse präzise erklären zu wollen, ist Obacht geboten. Wie sollen krankhafte Interaktionen von etwa 100 Milliarden Nervenzellen mit 100 Billionen Synapsen bei Angst oder Depression „verstanden“ werden?
Die Gehirnforschung ist eine Domäne der Biologie und der Medizin, die aber von einer Vielzahl methodischer Probleme herausgefordert ist. Die moderne Psychologie kann hier an allen Ecken und Enden helfen. Und im Umgang mit den vielfältigen Daten, die neurowissenschaftliche Experimente hervorbringen, sind Physiker und Mathematiker notwendig. Sie werden auch gebraucht, wenn es darum geht, Modelle und Theorien zu entwickeln. Wie sonst lassen sich das Gehirn und seine Funktionen vernünftig simulieren? Und zwar so, dass auch der Neurobiologe und Mediziner auf Anhieb versteht, was da geschieht? Es darf hier keine Königsdisziplin geben; niemand darf Vorrang haben.
An einer derartig engen Zusammenarbeit sollten sich unbedingt die Philosophen beteiligen. Wir brauchen: die Wissenschaftstheorie, die Philosophie des Geistes, die Anthropologie, und nicht zuletzt die Ethik. Dazu müssten Neurologen und Psychiater eingebunden werden. Dann könnte die nötige Transdisziplinarität zustande kommen, die eine neue, nachdenkliche Neurowissenschaft entstehen lässt. Eine Hirnforschung, die auch ihre eigenen Grundlagen hinterfragen und ihre Grenzen erkennen kann.
Vielleicht brauchen wir dazu ein neues akademisches Fach: die Neurophilosophie.
Felix Tretter (*1949) ist Nervenarzt am Isar-Amper-Klinikum und klinischer Psychologe an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Er hat ein Netzwerk von Neurowissenschaftlern mitbegründet: Kollegen verschiedener Fachrichtungen, die in Theorie, Labor und Praxis der Hirnforschung tätig sind.
SPIEGEL 50/2012
Im Flug durch das Gehirn
Hirnforscher wollen den Schaltplan aller 100 Milliarden Nervenzellen kartieren. Kann das gelingen? Es lockt ein großer Preis: das Verständnis des Bewusstseins, die Enträtselung seelischer Krankheit - und womöglich die Unsterblichkeit. Von Johann Grolle
Durch ein Gewirr grauer Fäden geht der rasende Flug. Nur im Augenwinkel sieht der Pilot, wie rechts und links unförmige, verästelte Gebilde vorübersausen. Sein Blick ist auf eine Art Tunnel gerichtet, der sich direkt vor dem Cockpit öffnet. Seine Mission: nie diesen Schlauch verlassen.
Es ist ein Flug durch nie zuvor erkundetes Gelände. Aus Simulationen in Kino und Fernsehen mag sie geläufig sein, doch hier, am Münchner Max-Planck-Institut (MPI) für Neurobiologie, wird sie Wirklichkeit: die Reise durch Gehirnsubstanz. Denn jeder der Tunnel, die hier zu sehen sind, gehört zu einer realen Nervenzelle.
Die kleinen Schnürringe rechts und links, die der Kommunikation mit anderen Zellen dienen; die dicken Fettschichten, die einzelne Nervenfasern umschlingen; die Botenstoffbläschen, die, Staubwolken gleich, unvermittelt die Sicht nehmen können: alles echt, alles Abbild real existierenden Nervengewebes.
Der MPI-Forscher und Mediziner Moritz Helmstädter hat ein winziges Würfelchen Gehirnsubstanz, kaum größer als ein Zuckerkorn, in einige tausend hauchfeine Scheiben zerschnitten, jede von ihnen mit dem Elektronenmikroskop fotografiert und anschließend am Computer wieder zusammengesetzt. Jetzt kann er nach Herzenslust spazieren fliegen durch den Stoff, aus dem die Wünsche, Hoffnungen und Träume sind.
Denn es sind Zellen wie diese, in denen sich Neugier oder Begierde regt. Es ist elektrisches Geflacker in einem solchen enggeknüpften Neuronennetz, das uns trauern oder kichern lässt, das unsere Arme und Finger lenkt, das Liebesnächte erinnert und Mathe-Formeln knackt.
Das spezielle Nervengewebe allerdings, durch das Hirnforscher Helmstädter manövriert, ist nicht fürs Rechnen zuständig und auch nicht für romantische Gefühle. Hier werden Signale verarbeitet, die ein Mäuseschnurrhaar sendet - für Helmstädter ein ideales Studienobjekt, das Rückschlüsse auf den Menschen erlaubt.
Mäuse sind nachtaktive Tiere, Schnurrhaare für sie ein wichtiges Sinnesorgan. Unentwegt tasten sie damit ihr Umfeld ab. Jedes der 32 hochsensiblen Schnurrhaare meldet Berührungen aller Art an einen Klumpen aus rund 4000 Nervenzellen in Schicht 4 der Großhirnrinde.
Einen dieser Klumpen hat Helmstädter aus dem Hirngewebe einer Maus herausgeschnitten. Das Geflecht der feinverästelten Neuronen, so vermutet der Hirnforscher, berge das Geheimnis, wie sich die Vibration eines Haars in den Eindruck von Form, Bewegung oder Konsistenz eines Gegenstands verwandeln kann.
Wie aber sollte Helmstädter herausfinden, welches der vielen Ästchen sich wohin windet? Insgesamt 40 Meter Nervenfasern galt es zu erfassen, verknäult in einem Hirnklümpchen von nur einem halben Millimeter Kantenlänge.
Bald war klar: Ein Computer kann das bisher nicht. Er irrt zu oft, zu leicht verwechselt er zwei nah beieinanderliegende Nervenfasern. In Zweifelsfällen kann allein ein Mensch, durch sorgfältigen Abgleich der einzelnen Hirnschnitt-Fotos, den Weg durch das Labyrinth der Nervenzellen finden.
Doch welch unermessliches Arbeitspensum bedeutet das! „Die Erkundung würde ungefähr 200 000 Stunden dauern“, sagt Helmstädter, „so viel arbeitet ein Mensch im ganzen Leben nicht.“
Unmöglich also, eine solche Titanenaufgabe zu vollbringen? Helmstädter wollte sich damit nicht zufriedengeben - und fand einen Ort, an dem er eine ganze Armada menschlicher Hilfskräfte zu rekrutieren hofft: das Internet.
Zusammen mit Spiele-Designern und Informatikstudenten hat Helmstädter „Brainflight“ ersonnen, ein Computerspiel, das jedermann Gelegenheit geben soll, sich auf die Reise ins Gehirn zu machen. Vom simulierten Cockpit eines Flugzeugs aus steuert der Spieler durch Scheiben echten Hirngewebes. Und wer am erfolgreichsten den Nervensträngen folgt, der bekommt die meisten Punkte.
Im März soll „Brainflight“ online gehen. Wenn sich dann genügend Spieler auf die Jagd durchs Hirn begeben, kann das Abbild des Mäuseschnurrhirns binnen Wochen fertig sein.
Moritz Helmstädter zählt zu einem Trupp Rebellen, die sich vorgenommen haben, die Hirnforschung gründlich umzukrempeln. Ihr Credo: Das Fach stecke in einer Sackgasse. Nur mit einem radikal neuen Ansatz werde sich ein Ausweg finden.
Zwar boomen die Neurowissenschaften wie kaum eine andere Disziplin. Die Bilanz aber fällt in zweierlei Hinsicht ernüchternd aus: Zum einen bleibt die philosophische Frage, die aller Hirnforschung zugrunde liegt, weiterhin ungelöst. Spätestens seit René Descartes seinen berühmten Lehrsatz „Ich denke, also bin ich“ formulierte, arbeiten sich Forscher daran ab, das Verhältnis von Geist und Körper zu verstehen. Und doch vermag bis heute niemand zu erklären, wieso einem Klumpen aus anderthalb Kilogramm Eiweiß und Fett ein immaterielles Fluidum entströmen kann: die Gedanken. Anders ausgedrückt: Unklar bleibt, wie aus Materie Geist entsteht.
Zum anderen hat das Heer der Hirnforscher auch in praktischer Hinsicht erschreckend wenig Handfestes vorzuweisen. Gleichgültig ob Autismus, Schizophrenie, Hyperaktivität oder Depression - bei keinem dieser weitverbreiteten Leiden vermögen sie die Ursachen zu benennen. Was im Hirn der Kranken falschläuft, wissen die Forscher nicht.
Helmstädter und seine Mitstreiter glauben, einen Grund für das doppelte Versagen ihrer Zunft zu kennen: Bei all ihrem Eifer hätten die Forscher bisher die wesentliche Eigenschaft des Gehirns schlicht übersehen: dass es nämlich ein komplex verdrahtetes Netzwerk ist.
In der Tat wissen die Forscher über die Verschaltung der 100 Milliarden Zellen im Kopf fast nichts. Zwar haben sie einzelne Neuronen ausgiebig studiert. Sie haben untersucht, wann sich welche molekularen Kanäle in der Zellmembran öffnen, welcher Botenstoff an welcher Art von Synapse ausgeschüttet wird und wie elektrische Signale die Nervenfasern hinabschießen.
Doch daraus allein wird sich kein Verständnis geistiger Prozesse ableiten lassen. „Aus ein paar vereinzelten Bäumen können sie nicht auf die Gesamtheit des Waldes schließen“, konstatiert der Hirnforscher Sebastian Seung vom Massachusetts Institute of Technology (MIT).
„Eine einzelne Zelle wird niemals fähig zu verständigem Handeln sein“, erklärt er. Erst indem sie miteinander verschaltet werden, gehe aus bloßen elektrischen Impulsen ein Geist, eine Persönlichkeit, ein denkendes, empfindendes Ich hervor.
„Connectome“ lautet das Schlagwort. Es bezeichnet die Gesamtheit aller Verdrahtungen im Gehirn. „Die gilt es zu kartieren“, erklärt der Heidelberger Forscher Winfried Denk, der seinen Kollegen Helmstädter in der Kunst der Hirnvermessung ausgebildet hat.
Denk skizziert damit ein Vorhaben abenteuerlicher Dimension: Bisher haben die Forscher erst das Connectome eines einzigen Organismus vollständig erfasst: von Caenorhabditis elegans, einem etwa einen Millimeter langen Fadenwurm. Zelle für Zelle hat das Team um den britischen Nobelpreisträger Sydney Brenner alle 302 Neuronen dieses Tiers vermessen. Zwölf Jahre dauerte die Tüftelei.
Um wie viel schwieriger wird es erst sein, dieselbe Aufgabe im Fall des Homo sapiens zu bewältigen! Gut fünf Millionen Kilometer misst die Gesamtlänge aller Nervenärmchen unter der menschlichen Schädeldecke. Wie soll es da gelingen, jedes einzelne von ihnen durch das neuronale Labyrinth zu verfolgen?
Auf zwei verschiedenen Wegen packen die Forscher jetzt dieses ehrgeizige Ziel an. Zum einen hat die US-Regierung vor zwei Jahren 40 Millionen Dollar für das „Human Connectome Project“ bereitgestellt. Ziel ist es, mit Hilfe moderner Tomografen einen Atlas des zentralen Nervensystems zu erstellen, eine Art groben Schaltplan des menschlichen Denkorgans.
Allerdings wird es so nur möglich sein, die langreichweitigen Nervenbahnen zu kartieren, die quer durchs Gehirn laufen. Um einzelne Zellen zu sehen, ist das Auflösungsvermögen selbst der besten Tomografen viel zu gering.
Deshalb gehen Helmstädter, Denk und Seung noch einen Schritt weiter: Mit Hilfe des Elektronenmikroskops wollen sie die Verdrahtung jeder einzelnen Zelle vermessen.
Es ist ein aberwitziger Plan. Doch sind sich die Hirnvermesser sicher, dass die Mühe lohnt: Wenn erst das Connectome entschlüsselt sei, werde es auch gelingen, das Rätsel des Bewusstseins zu knacken und Krankheiten wie der Schizophrenie auf die Spur zu kommen.
„Sehen Sie da, ist das nicht faszinierend?“, fragt Van Wedeen und zeigt auf das knallbunte Bild auf seinem Monitor: Lianengleich umschlingen giftgrüne Stränge ein violettes Faserbündel, karminrote, gelbe und hellblaue Bahnen durchdringen einander. „Da, der Hippocampus“, sagt Wedeen und ist, atemlos, quirlig, ohne Pause, schon beim nächsten Bild: „Hier sieht man die Netzwerkstruktur besonders gut“, erklärt er. „Wie das Straßennetz von Manhattan, nur eben dreidimensional.“
Zack, schon erscheint das nächste Tomografenbild, nicht weniger prachtvoll als die anderen, und wieder zeigt es verschlungene und doch regelhaft verflochtene Nervenfasern. Aber Wedeen begnügt sich inzwischen schon nicht mehr mit der bloßen Beschreibung. Er ist längst bei den Gesetzen der Evolution angekommen und bei denen der Hirnreifung im Embryo. Für ihn hat all das etwas mit diesen Bildern zu tun.
Ohne Unterlass sprudeln die Ideen, die Theorien, die Spekulationen aus Wedeen hervor. Als Mathematiker hat er seine Karriere begonnen. Doch hier, in der Hirnforschung am Martinos Center for Biomedical Imaging in Boston, hat er seine Bestimmung gefunden.
Mit Kernspin- und Positronenemissionstomografen, mit Magnetstimulation und Elektroenzephalografen durchleuchten die Forscher hier menschliche Gehirne. Sie schieben Mäuse und Ratten in mächtige Röhren, um deren Nervengewebe detailgenau zu erkunden. Sie halten Probanden an, zu lesen und zu singen, zu lachen und zu horchen, zu rechnen und zu beten, und währenddessen verfolgen sie, was sich in ihrem Hirn tut.
Den wohl erstaunlichsten der Tomografen aber betreibt Wedeen. Das Gerät steht im Nebengebäude des Martinos Center, einer langgestreckten Baracke, in der einst, als das Gelände noch Teil der Bostoner Marinewerft war, die Taumacher Flachs zu Seilen flochten.
In einer Kammer steht hier, fast raumfüllend von mächtigen Magneten eingefasst, ein sogenannter Diffusionstomograf. Wie ein gewöhnlicher Kernspintomograf fängt er die Signale von im Magnetfeld taumelnden Atomen auf. Doch mehr noch: Er registriert auch, in welche Richtung sich diese Atome bewegen. Und da Moleküle im Gehirn meist entlang der Nevenfasern fließen, gelingt es, diese sichtbar zu machen. „Es ist, wie wenn Sie Tinte auf ein Tischtuch kippen“, erklärt Wedeen. „Die breitet sich auch entlang der Fäden aus.“
Wedeen gelang es, das Verfahren so weit zu verfeinern, dass er auch sich kreuzende Bündel voneinander unterscheiden kann - der Weg war geebnet für eine völlig neue Form der Hirnerkundung. Wedeen dringt vor auf ein Terrain, das wissenschaftlich noch weitgehend Neuland ist: die „weiße Substanz“.
In sechs Schichten, insgesamt zwei bis vier Millimeter dick, umschließen die sprichwörtlichen grauen Zellen sämtliche Wölbungen und Furchen des Großhirns. Weitgehend strukturlos dagegen erscheint die weiße Masse darunter: Hier verlaufen die Fasern, welche die verschiedenen Hirnregionen miteinander verbinden. Hier tauschen die Sinnesorgane ihre Informationen aus, hier werden Erinnerungen, Wahrnehmungen, Gefühle und Pläne miteinander vernetzt. Hier sitzt, mit anderen Worten, die Schaltzentrale des Bewusstseins.
Als Flaggschiff des „Human Connectome Project“ produziert Wedeens Maschine nun dutzendweise bunte Bilder, wie sie nie zuvor zu sehen waren. In knalligen Farben zeigen sie sich kreuzende und umschlingende Bahnen: gleichsam den Kabelbaum im Maschinenraum des menschlichen Neurocomputers.
In der ganzen Natur, meint Wedeen, gebe es nichts, mit dem sich diese Strukturen vergleichen lassen. Netz? Matrix? Maschenwerk? Schon mit der Bezeichnung tat er sich schwer. Wedeen googelte alle Begriffe, die ihm in den Sinn kamen. Am Ende entschied er sich für „grid“, zu Deutsch: „Gitter“. Hier wiesen die Fundstellen der Suchmaschine am ehesten Ähnlichkeiten mit den Hirnaufnahmen seines Tomografen auf.
Gerade erst hat die Auswertung begonnen, Wedeen jedoch ist viel zu ungeduldig, als dass er nicht schon seine Deutungen parat hätte. Vor allem die regelmäßige Gitterstruktur begeistert ihn: „Da dachten die Leute immer, die Nervenbahnen seien verknäult wie gekochte Spaghetti. Und stattdessen jetzt das hier!“, sagt er und zoomt in einen Knotenpunkt des Neuronetzes hinein: „Alles brav in rechten Winkeln angeordnet.“
Eigentlich sei das auch gar nicht so erstaunlich, meint Wedeen. „Stellen Sie sich vor: Rund 100 Milliarden Nervenzellen sind in unserem Kopf verschaltet, und jede davon bildet 1000 Synapsen. Wie soll das gehen, gesteuert von nur ein paar tausend Genen?“ Das könne doch nur klappen, wenn alles nach einfachen Regeln vor sich geht.
In der jetzt offenbarten Gitterstruktur sieht Wedeen nichts anderes als eine Art neuronales Koordinatensystem: „Die Natur macht es genau wie wir mit unseren Längen- und Breitengraden“, sagt er. Vorne - hinten; oben - unten; rechts - links: Das Gitter gibt seiner Überzeugung nach die drei Körperachsen vor, und das vermutlich schon seit vielen Jahrmillionen. Am liebsten würde er jetzt die neuronale Gitterstruktur von Lurch, Maus, Affe und Mensch vergleichen, um so die großen Entwicklungsschritte der Evolution nachzuvollziehen.
Auch sonst mangelt es Wedeen nicht an Plänen: Zum Beispiel würde er gern Frühchen in den Tomografen schieben, erste Gespräche mit örtlichen Neonatologen hat er schon geführt. „Die Babys könnten während der Untersuchung ganz friedlich schlafen“, sagt er.
Vielleicht ließen sich auf den Hirnscans ja frühzeitig Verschaltungsprobleme im Hirn diagnostizieren, meint Wedeen. Vor allem aber könnte er studieren, wie das Nervengitter im Laufe der embryonalen Entwicklung erst entsteht.
Oder Leichen: Zu gern würde Wedeen auch ihrer habhaft werden. Schon hat er sich auf die Suche nach Hirnspendern gemacht. Ihre Zustimmung vorausgesetzt, könnte er ihr Hirngewebe kurz nach dem Tod fixieren und sie dann durchleuchten. Anders als bei Lebenden, würden Tote die Scan-Prozedur auch tagelang über sich ergehen lassen. Die so entstehenden Hirnbilder hätten deshalb bis zu zehnmal mehr Details.
Auch Winfried Denk kennt die bunten Tomografenbilder von Van Wedeen. „Sehr interessant“ finde er sie, sagt er, aber es klingt durchaus zögerlich. „Kein Zweifel, Van sieht da etwas. Das Problem ist nur: Er weiß nicht, was.“
Denk fehlt Wedeens Überschwänglichkeit. Spekulationen sind ihm suspekt, er wägt seine Worte ab, hält sich an das, was sicher ist. Deshalb fragt er sich, was auf Wedeens bunten Bildern eigentlich zu sehen ist.
Genau weiß das bisher niemand. Einzelne Nervenzellen jedenfalls, so viel ist sicher, sind es nicht. Um die Verästelungen der Neuronen erkennen zu können, müsste das Bild etwa um den Faktor 100 000 schärfer sein.
Gut möglich, dass Wedeens Methode geeignet ist, den Datenfernverkehr im Hirn besser zu verstehen, meint Denk. Die eigentliche Rechenarbeit aber vollziehe sich im Geplauder dichtbenachbarter Zellen. Und deren Geflecht lasse sich nur auf Aufnahmen höchster Genauigkeit erkennen - an solchen Bildern arbeitet Hirnforscher Denk.
„Alles, was Sie hier sehen, schrumpft in einem Tomografen auf einen Punkt“, sagt er. Er steht im Treppenhaus des Heidelberger Max-Planck-Instituts für medizinische Forschung. Treppenabsatz und Wände sind mit Elektronenmikroskopaufnahmen tapeziert, die hier am Institut entstanden sind: ein staubkornkleines Stückchen Retina, aufgebläht zur Größe eines Kleiderschranks.
Zu erkennen sind drei Schichten Nervenzellen aus der Netzhaut, zwischen ihnen unübersichtliches Drahtgeknäuel. Fünf verschiedene Neuronentypen, von den Experten in bis zu 70 Untersorten eingeteilt, bilden hier eine Art neuronalen Computerchip.
Spezialisiert auf die Bildverarbeitung, hat dieser winzige Neurocomputer die Aufgabe, Lichtreize auf Farbe, Helligkeit, Kontrast, Kontur oder Bewegung hin zu analysieren. Erst die aufbereiteten Daten werden dann über den Sehnerv ans Gehirn geschickt.
Für Hirnforscher ist das Neuronennetzwerk in der Retina ein geradezu idealer Untersuchungsgegenstand: Es bildet eine weitgehend abgeschlossene Einheit; es lässt sich vergleichsweise einfach präparieren; und bei Bedarf kann es im Labor sogar einige Zeit lang funktionsfähig am Leben erhalten werden.
Denk steigt hinab in den Keller des Heidelberger Instituts, er will zeigen, wo die Bilder im Treppenhaus entstanden sind. Etwas schlurfend weist er den Weg, das eine Bein zieht er dabei nach. „Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass es ausgerechnet mich erwischt hat“, erklärt er. Vor fünf Jahren musste sich der Hirnforscher von den Ärzten sagen lassen, dass etwas in seinem eigenen Gehirn nicht stimmte: Parkinson.
Als er die Diagnose hörte, wusste Denk: Die fortschreitende Schüttellähmung, unter der er litt, würde sich zwar medikamentös hinauszögern lassen, aufhalten aber lässt sie sich nicht. Am eigenen Leib erfuhr der Forscher, wie hilflos Medizin und Wissenschaft oft sind, wenn das Hirn von Krankheit befallen ist.
Damals, erzählt er, habe er überlegt, ob er sich fortan der Erforschung dieses Leidens widmen sollte. Doch die Vorstellung, von den Kollegen als Patient behandelt zu werden, schreckte ihn. „Vor allem aber wollte ich meine Talente dort einsetzen, wo ich den größtmöglichen Nutzen erreichen kann.“