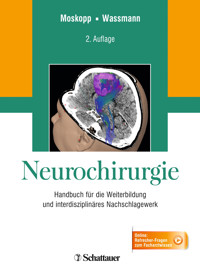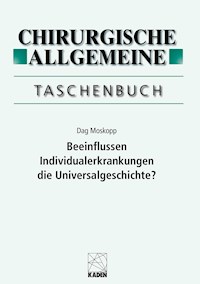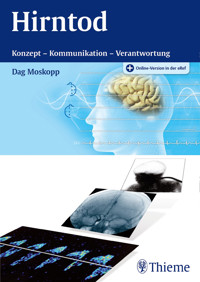
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Diagnose Hirntod ist für Ärzte, Pflegekräfte und Angehörige ein belastendes Thema. Neue Gesetze und Richtlinien zur Hirntoddiagnostik sowie unterschiedliche ethisch-moralische Vorstellungen führen zu Unsicherheiten im Handeln. Dieses Handbuch bietet einen Leitfaden sowohl für die Diagnosestellung, als auch den sicheren Umgang mit der schwierigen Situation Hirntod. - gesetzlich vorgeschriebene klinische Hirntoddiagnostik - Schnittstelle zur Transplantationsmedizin und Organspende - Entscheidungsfindung für das weitere Vorgehen - Beendigung der Therapie und Weiterbehandlung bis zur Organentnahme - rechtliche, ethische und religiöse Aspekte - Umgang und Kommunikation mit Angehörigen JJederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen eRef App haben Sie zahlreiche Inhalte auch offline immer griffbereit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Hirntod
Konzept - Kommunikation - Verantwortung
Dag Moskopp
42 Abbildungen
Danksagung
Der Autor bedankt sich beim Thieme Verlag, besonders bei den Damen Korinna Engeli und Dr. Andrea Busche, die dieses Buchprojekt angenommen und freundlich begleitet haben.
Besonderer Dank gebührt der eigenen Familie für ihr Verständnis, wenn der Autor eine Zeit lang seine Achtsamkeit weniger auf die Lebenden als eher auf die Erstellung eines Buches über den Tod gerichtet hat.
Gedankt sei ebenfalls aktuellen (Drs. Axel Rahmel, Detlef Bösebeck, Ulrike Wirges) und früheren (Herrn Heiner Smit, ▶ [92]) leitenden Mitarbeitern der Deutschen Stiftung Organtransplantation für die Überlassung von Daten an der Schnittstelle von Hirntod zu Organspende.
Ganz herzlich bedankt sich der Autor für ungezählte, wertvolle Hinweise, Dialoge und ggf. Manuskriptdurchsichten bei:Univ.-Prof. Dr. Hugo Van Aken (Anästhesiologie und operative Intensivmedizin/Münster); Elisabeth Boening (Physiologie/Münster); Univ.-Prof. Dr. Heinz Angstwurm (Neurologie/München); Univ.-Prof. Dr. Stephan Brandt (Neurologie/Berlin); Gottfried Brezger (ev. Theologie/Berlin); em. Univ.-Prof. Dr. Hartmut Collmann (Neurochirurgie/Würzburg); Alexandra von Cube (Informationstechnologie/Dortmund); Maria Degkwitz (Altphilologie, kath. Theologie/Meißen); Dr. Markus Dröge (ev. Theologie/Berlin); Diplomtheologe Mehmet Erol (Islamwissenschaften/Berlin); Prof. Dr. Gerd Fasselt (kath. Theologie/Münster) †; Prof. Dr. Andreas Ferbert (Neurologie/Kassel); Univ.-Prof. Dr. Karsten Fischer (Politikwissenschaft/München); Familie Genthon-Troncy (Lyon); Prof. Dr. Christoph Gestrich (ev. Theologie/Berlin); Prof. Dr. Hermann Girschick (Pädiatrie/Berlin); Dr. Thomas Hagen (kath. Theologie/München); Dr. Stefanie Hammersen (Neurochirurgie/Berlin); PD Dr. Lars Hellmeyer (Geburtshilfe/Berlin); Univ.-Prof. Dr. Frank Heppner (Neuropathologie/Berlin), Prof. Dr. Christian von Heymann (Anästhesie/Berlin); Facharzt Henning Hosch (Neurochirurgie/Berlin); em. Univ.-Prof. Dr. Dr. Wolfgang Huber (ev. Theologie/Berlin); Angelika Huck (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung/Bonn); Prof. Dr. Sami Hussein (Neurochirurgie/Jerusalem); PD Dr. Günter Jautzke (Pathologie/Berlin); Dr. Patricia Klein (LÄK-Sachsen/Dresden), PD Dr. H.-C. Koennecke (Neurologie/Berlin), Matthias Krieser (ev. Theologie/Berlin); Univ.-Prof. Dr. Martin Kurthen (Epileptologie/Zürich); Dipl.-Ing. (FH) Hans-E. Kuttner (Medizinelektronik/Halle); Univ.-Prof. Dr. Hubert Martin (Pathologie/Berlin); Dr. Claus-Dieter Middel (Bundesärztekammer/Berlin); Mischa Moriceau (Pressestelle Vivantes/Berlin); Karin Mutlaq (Bibliothek/Bonn); Hans Eike von Oppeln-Bronikowski (Notar/Berlin), PD Dr. Michail Plotkin (Nuklearmedizin/Berlin), Univ.-Prof. Dr. Hans-Christian Pape (Physiologie/Münster); Dr. Katja Reikert (MdB, Gesundheitsausschuss/Berlin); Dr. Elke Rutzenhöfer (Verlagswesen/Berlin); Prof. Dr. Dagmar Schmauks (Semiotik/Berlin); Dr. Markus Schomacher (Neurochirurgie/Berlin); Univ.-Prof. Dr. Lázló Solymosi (Neuroradiologie/Würzburg); em. Univ.-Prof. Dr. Josef Speckmann (Physiologie/Münster); Dr. Ing. Andreas Spiegelberg (Meßtechnik/Zürich – früher Hamburg); Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Stock (Journalismus/Berlin); Dr. Alexandros Tassinopoulos (Arbeitsagentur/Berlin); Univ.-Prof. Dr. Michael Tsokos (Rechtsmedizin/Berlin); Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim Wagner (Radiologie/Berlin); Wolfgang Weiss (ev. Theologie/Berlin), Diakon Klaus Wilmer (kath. Theologie/Münster); Doerthe Worm (Sekretariat/Berlin). Ganz besonderer Dank gilt Frau Dr. Daniela Watzke (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln), die mir überaus sorgsam, sachkundig und kontinuierlich bei der Manuskripterstellung geholfen hat.
Außerordentlicher Dank gebührt Herrn em. Univ.-Prof. Dr. Reinhold A. Frowein (ehemaliger Direktor der Kölner Universitätsklinik für Neurochirurgie) für seine unschätzbare prompte und sachkundige Kooperation während der letzten Jahrzehnte, inklusive der Überlassung des Manuskripts seines unveröffentlichten Vortrags aus dem Jahre 2004 „Geschichte der neurochirurgischen Hirntod-Diagnose in Deutschland“ ▶ [125].
Berlin, im August 2015
Dag Moskopp
Abkürzungen
AEP
akustisch evozierte Potentiale
AMV
Atemminutenvolumen
a.p.
anterio-posteriorer Strahlengang einer Röntgenprojektion (d.h. von vorn nach hinten in der Frontalebene)
BÄK
Bundesärztekammer
BGBl
Bundesgesetzblatt
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BWV
Bach-Werke-Verzeichnis
BZgA
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
CBF
cerebral blood flow, Hirndurchblutung
cf.
confer (vergleiche)
CO
2
Kohlendioxid
CPP
cerebraler Perfusionsdruck
CT
Computertomographie
CTA
CT-Angiographie; Computertomographie-Angiographie
DAAF
Deutsche Akademie für Anästhesiologische Fortbildung
DGN
Deutsche Gesellschaft für Neurologie
DGNC
Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie
DGNI
Deutsche Gesellschaft für Neurointensiv- und Notfallmedizin e.V.
DIVI
Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin
DSA
digitale Subtraktionsangiographie
DSO
Deutsche Stiftung für Organtransplantation
ECD
Ethyl-Cysteinat-Dimer (Neurolite)
EEG
Elektroenzephalogramm
EKD
Evangelische Kirche in Deutschland
EP
evozierte Potentiale
FAEP
frühe akustisch evozierte Potentiale
FAZ
Frankfurter Allgemeine Zeitung
GCS
Glasgow Coma Scale oder Score
HMPAO
Hexamethyl-Propylen-Amin-Oxim
ICB
intracerebrale Blutung
ICP
intrakranieller Druck, Schädelinnendruck
i-EEG
invasive Ableitung aus dem Gehirn selbst
IMPP
Institut für Medizinische und Pharmazeutische Prüfungsfragen
kPa
Kilopascal
MAP
arterieller Mitteldruck
MCA
A. cerebri media
MHz
Megahertz
MRA
Magnetresonanztomographie-Angiographie
MRT
Magnetresonanztomographie, Kernspintomographie
OP
Operationsraum
p
a
CO
2
arterieller Kohlendioxidpartialdruck
pH
a
arterieller pH
o-EEG
oberflächliche Ableitung von der Kopfhaut
SAB
Subarachnoidalblutung
SEP
somatosensibel evozierte Potentiale
SPECT
Single-Photon-Emissionscomputertomographie
SSW
Schwangerschaftswoche
SZ
Süddeutsche Zeitung
TAZ
die tageszeitung
99m
Tc
Isotop des Technetiums
TCD
transkranielle Doppler-Sonographie
TPG
Transplantationsgesetz
VEP
visuell evozierte Potentiale
ZNS
Zentralnervensystem
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Abkürzungen
1 Vorbemerkungen
1.1 Warum dieses Buch?
1.1.1 Aufbau
1.1.2 Über den Autor
1.1.3 Zielgruppe
1.1.4 Anliegen
1.1.5 Sehweise des em. Univ.-Prof. Dr. Reinhold A. Frowein
1.2 Entstehung des Buches
1.2.1 Zur Bezeichnung „Hirntod“
1.2.2 Hirntod als medizinhistorische Neuheit
1.3 Kommunikation
1.3.1 Kommunikationspartner
1.3.2 Probleme
1.3.3 Rahmenbedingungen
1.4 Prädikationsparadigma
1.5 Zur Definierbarkeit von Tod
1.5.1 Tod und Sterbeprozess
1.6 Hirntod im deutschen Sprachgebrauch
1.6.1 Unverzichtbare Bestandteile im Rahmen der Feststellung des Hirntodes
1.7 Sprachregelung
1.7.1 Tiefes Koma, Schwebezeit, Hirntod
2 Zum Hirntod-Konzept
2.1 Historische Wurzeln
2.1.1 Analogie zur Enthauptung
2.2 Relevanz des Themas
2.2.1 Rolle des Neurochirurgen
2.2.2 Allgemeine Relevanz
2.3 Todeshäufigkeit in Deutschland
2.4 Wie sicher sind die Todeskonzepte?
2.4.1 Hirntod
2.4.2 Herz-Lungen-Tod
2.5 Zum Menschenbild in der Geschichte
2.5.1 Kardiozentrisches Menschenbild
2.5.2 Enzephalozentrisches Menschenbild
2.6 Hirntod bei Schwangeren
2.6.1 Fetomaternaler Grenzbereich
2.7 Sprachbarrieren und Sprachprobleme
2.7.1 Fremdsprachen
2.7.2 Grenzen und Leistungsschwächen von Sprache
2.7.3 Missverständnisse durch Sprache
2.7.4 Verunsicherung wegen Auslassungen
2.7.5 Unglückliche Formulierungen
2.7.6 Umgang mit Beiwörtern
2.7.7 Absurde Bezeichnungen
2.7.8 Unzulängliche Bezeichnungen
2.7.9 Wortwahl in den Medien
2.8 Vier-Ebenen-Modell nach Martin Kurthen
2.8.1 Ebene der Attribution: Subjekt des Todes
2.8.2 Ebene der Definition: der Begriff „tot“
2.9 Getrennte Entwicklung von Transplantationsmedizin und Hirntod-Konzept
2.9.1 Entwicklung der Transplantationsmedizin
2.9.2 Harvard-Publikation zum Hirntod
2.9.3 Entwicklung des Hirntod-Konzepts auf Intensivstationen
3 Feststellung des Hirntodes
3.1 Entscheidungshilfen und Richtlinien in Deutschland seit 1982
3.1.1 Entscheidungshilfen
3.1.2 Richtlinien
3.2 Das Drei-Stufen-Modell zur Feststellung des Hirntodes
3.2.1 Stufe I: Voraussetzungen
3.2.2 Stufe II: klinisches Syndrom
3.2.3 Stufe III: Unwiederbringlichkeitsnachweis
3.3 Besonderheiten bei der Feststellung des Hirntodes
3.3.1 Schwierigkeiten bei der Befundung
3.3.2 Feststellung des Hirntodes vor Vollendung des 2. Lebensjahrs
3.4 Zusammenfassung
4 Situation auf Intensivstationen nach Hirntodfeststellung
4.1 Wie führe ich ein Gespräch?
4.1.1 Zeitpunkt der Frage nach der Bereitschaft zur Organspende
4.1.2 Ärztliche Erfahrung unerlässlich
4.1.3 Ganz besondere Schnittstelle
4.1.4 Einfühlungsgabe gefragt
4.1.5 Konditionierung des Hirntoten
4.2 Anwesenheit eines Anästhesisten bei der Organentnahme
4.2.1 Aufgaben des Anästhesisten
4.3 Ist die Anwesenheit von Angehörigen möglich?
4.4 Kritik am Hirntod-Konzept und dessen Schnittstelle zur Organspende
4.4.1 Ebenen der Hirntod-Problematik
4.4.2 Seriöse Journalisten
4.4.3 Infobrief zum Hirntod: schwierige Teilkompetenzen
4.4.4 Empfindungen nur mit dem Herzen?
4.4.5 Kritikpunkte in der derzeitigen Laienpresse
4.4.6 Widerlegung der Kritikpunkte
4.5 Weltanschauliche Sicht zum Hirntod-Konzept
4.5.1 Menschenbild der Bibel
4.5.2 Keine Frage der Religionszugehörigkeit
4.5.3 Glaubensgemeinschaften
4.6 Das Hirntod-Konzept im internationalen Vergleich
4.6.1 Unterschiede und Gemeinsamkeiten
4.6.2 Hirntodfeststellung in weiteren Ländern
5 Aufgabe unserer Generation
5.1 Das Bild der Brücke verständlich machen
5.1.1 Trauerverarbeitung mithilfe von Musik
5.1.2 Hirntod-Problematik in die Schulen bringen
5.2 Ausblick
6 Ansprache von Papst Pius XII. 1957 in Rom
6.1 Rechtliche und sittliche Fragen der Wiederbelebung(1)
6.1.1 Einleitung
6.1.2 Segen
7 Literaturverzeichnis
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum
1 Vorbemerkungen
1.1 Warum dieses Buch?
Das vorliegende Buch will in der komplexen Gesamtsituation zum Thema Hirntod Ruhe und Zuversicht ausstrahlen: Die Diagnose des Hirntodes ist – wenn der vorgenannte Rahmen eingehalten wird – absolut sicher! Es ist seit dem 09.04.1982 bis zum Redaktionsschluss dieses Buches keine falsch positive Diagnose in Deutschland bekannt geworden, wenn man sich bei seiner Feststellung an die Richtlinien hält. Desweiteren ist es gesetzlich vorgeschrieben, auch unabhängig von jedweder Erwägung zu einer Organ- oder Gewebespende, diejenigen Patienten auf einer Intensivstation, die hirntot sein könnten, entsprechend zu untersuchen, und für den gegebenen Fall den Hirntod zu diagnostizieren.
Die 4. Fortschreibung der Richtlinie ▶ [396] legt fest, dass Einrichtungen, in denen der Hirntod bestimmt wird, zur Qualitätssicherung verpflichtet sind, damit die Feststellung des Hirntodes ausnahmslos und in persönlicher Verantwortung sorgsam und kenntnisbasiert erfolgt. Der Hirntod ist verständlich zu erklären. Zumindest wer heute in Zentraleuropa lebt, kommt um diese Realität nicht herum. Der Begriff gehört nach Ansicht des Autors in das Curriculum eines jeden Schulabschlusses ▶ [245].
Die nachstehenden Ausführungen sind etwas detailliert, weil das Problem einerseits eine Historie hat und weil andererseits bis heute Einwände zum Thema Hirntod formuliert werden (▶ [29]; ▶ [85]; ▶ [104]; ▶ [373]). Diese Einwände beziehen sich oft nicht auf das Hirntod-Konzept als solches, sondern meist darauf, dass dieses Konzept in Einzelfällen nicht hinreichend angemessen angewendet worden sei. So wurde kritisiert, dass zum einen der grundsätzliche Kenntnisstand in Teilen der Ärzteschaft zu gering und zum anderen die Anwendungspraxis zur Feststellung des Hirntodes unzulänglich gewesen sei oder dass formal unzureichend dokumentiert worden sei. Wohlgemerkt, in nachweislich keinem der Fälle, die aktuell in der Presse als kritisch aufgeworfen werden, liegt eine falsch positive Feststellung des Hirntodes vor.
Merke
Der Hirntod ist das sicherste Kennzeichen des menschlichen Todes.
1.1.1 Aufbau
Das Thema wird im Wesentlichen in 4 Teile gegliedert vorgestellt:
Kap. ▶ 2 befasst sich mit Historischem und Konzeptionellem.
In Kap. ▶ 3 folgt die Beschreibung des handwerklichen Rüstzeugs für die konkrete Feststellung des Hirntodes – letztlich eine kommentierende Umschreibung der aktuellen Richtlinie, wie sie jüngst in 4. Fortschreibung ▶ [396] im Ärzteblatt publiziert wurde – und zwar aus eigenem Erleben anhand von 435 Hirntod-Diagnostiken während der vergangenen 24 Jahre. Sofern man zur entsprechenden Zielgruppe gehört, ersetzt das Studium des vorliegenden Buches ein Durcharbeiten der Richtlinie nicht!
In Kap. ▶ 4 werden einige Probleme nach der Feststellung des Hirntodes an der Schnittstelle zur Organspende sowie einige wenige weltanschauliche und internationale Korrelationen thematisiert.
In Kap. ▶ 5 wird reflektiert, welche Aufgaben für unsere und die nachfolgende Generation verbleiben.
1.1.2 Über den Autor
Der Autor des Buches ist Direktor der Klinik für Neurochirurgie des Vivantes-Klinikums Friedrichshain (Berlin). Die Letalitätsrate der Patienten dieser Klinik weist keinen Unterschied zu vergleichbaren Institutionen auf. Er legt als sowohl mikrochirurgisch als auch intensivmedizinisch erfahrener Neurochirurg Zeugnis davon ab, was er in den letzten 3 Jahrzehnten im Umfeld des Problems „Hirntod“ erlebt, gelesen und reflektiert hat.
Im Sinne der Zusammenstellung einer Klein-Monographie, wurde der Autor erstmals 1994 für Heft 2 des 16. Bandes von „Das EEG-Labor – Zeitschrift für Neurophysiologische Funktionsdiagnostik“ um einen Beitrag gebeten. Auf den 42 Seiten dieses Heftes finden sich dort in nuce die vor 2 Jahrzehnten sorgsam zusammengetragenen Daten: Roland Besser referiert zu den Empfehlungen der Deutschen EEG-Gesellschaft im Rahmen der Feststellung des Hirntodes. Wolfgang Wagner fasst den Gehalt seiner Habilitationsarbeit unter dem Titel „Die Bedeutung der somatosensibel evozierten Potentiale (SEP)“ im Rahmen der Hirntod-Diagnostik zusammen. Und der Autor, sekundiert von Martin Kurthen und Hansdetlef Wassmann schildert problemorientiert den diagnostischen Gang der Feststellung des Hirntodes eines 60-jährigen Unfallopfers. Dort werden nicht nur die Parameter im Rahmen des Apnoe-Tests detailgetreu wiedergegeben, sondern es erfolgt auch die a.p.-Abbildung einer Katheterangiographie – separat für alle 4 hirnversorgenden Arterien – nach der klinischen Feststellung des Hirntod-Syndroms in sonst selten gefundener Vollständigkeit.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!