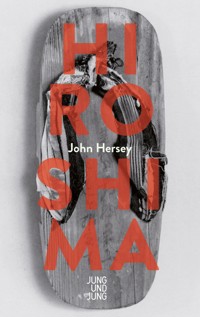
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Entsetzen der Weltöffentlichkeit war groß, als am 31. August 1946 in der Zeitschrift The New Yorker eine Reportage erschien, deren Titel Hiroshima an das lang ersehnte Ende des Krieges erinnerte, aber zugleich die Schrecken einer neuen Zeit heraufbeschwor. Ihr Autor, John Hersey, war kein Unbekannter: Er hatte 1945 für seinen ersten Roman den Pulitzer-Preis gewonnen, nachdem er seine schriftstellerische Laufbahn als Sekretär und Chauffeur von Sinclair Lewis und als Kriegsreporter begonnen hatte. Im Mai 1946 reiste er nach Japan, um über die Folgen des Atombombenabwurfs zu recherchieren. Bei seinen Nachforschungen stieß er auf erheblichen Widerstand von Seiten der amerikanischen Behörden. Trotzdem gelang es ihm, sechs Überlebende des 6. August 1945 zu befragen. Was er von ihrem Schicksal erzählte und wie er es tat, war in seiner ganzen Nüchternheit so erschütternd und berührend, dass der Text nicht wie geplant in Fortsetzungen, sondern in seiner vollen Länge von rund 31.000 Wörtern in einer einzigen Ausgabe erschien. Es heißt, Albert Einstein habe davon 1000 Exemplare bestellen wollen, sie war allerdings nach wenigen Stunden ausverkauft. Der Text, der seither in zahlreichen Buchausgaben erschienen ist, gilt bis heute als eine der wichtigsten journalistischen Arbeiten des 20. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2023 Jung und Jung, Salzburg
This translation published by arrangement with Alfred A. Knopf,an imprint of The Knopf Doubleday Group,a division of Penguin Random House, LLCAlle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung,Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehaltenUmschlagbild: Hiromi Tsuchida, Geta (Wooden Clog)© Hiroshima Peace Memorial MuseumUmschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.comISBN 978-399027-196-4eISBN 978-3-99027-196-4
JOHN HERSEY
Hiroshima
aus dem amerikanischen Englisch übersetztvon Justinian Frischund Alexander Pechmann
EINSEin Blitz ohne Donner
ZWEIDas Feuer
DREIDie Einzelheiten werden untersucht
VIERHeidekorn und Fieberkraut
FÜNFDie Nachwirkungen
Eins
EIN BLITZ OHNE DONNER
Am Morgen, Punkt 8 Uhr 15 japanischer Zeit, am 6. August 1945, in dem Augenblick, da die Atombombe über Hiroshima explodierte, hatte sich Fräulein Toshiko Sasaki, Beamtin in der Personalabteilung der Ostasiatischen Zinnwerke, eben auf ihrem Platz im Fabrikkontor niedergelassen und wandte den Kopf, um mit dem Mädchen am Nachbartisch zu sprechen. Im selben Augenblick setzte sich Dr. Masakazu Fujii mit gekreuzten Beinen in der Vorhalle seines Privatsanatoriums nieder, um die in Osaka erscheinende Zeitung Asahi zu lesen; das Sanatorium hing über einem der sieben Mündungsarme, die Hiroshima durchschneiden; Frau Hatsuyo Nakamura, die Witwe eines Schneiders, stand am Fenster ihrer Küche und sah zu, wie ihr Nachbar sein Haus niederriss, weil es am Weg einer Luftschutzfeuerlinie gelegen war; Pater Wilhelm Kleinsorge, ein deutscher Priester der Gesellschaft Jesu, lag in Unterwäsche im obersten Stockwerk des dreistöckigen Missionshauses auf einem Feldbett und las in der Jesuitenzeitschrift Stimmen der Zeit; Dr. Terufumi Sasaki, ein junges Mitglied des chirurgischen Stabs des großen, modernen Rot-Kreuz-Spitals, ging, eine Blutprobe, die für eine Wassermann-Untersuchung bestimmt war, in Händen, einen Korridor entlang; und der Reverend Kiyoshi Tanimoto, Pastor der Methodistenkirche von Hiroshima, stand vor der Tür des Hauses eines reichen Mannes in Koi, der westlichen Vorstadt, und schickte sich an, einen Handkarren abzuladen, der voller Dinge war, die der Pastor aus Furcht vor den stündlich erwarteten schweren Luftangriffen der B-29 aus der Stadt fortgeschafft hatte. 100 000 Menschen wurden von der Atombombe getötet, und diese sechs gehörten zu den Überlebenden. Noch heute fragen sie sich verwundert, warum sie am Leben blieben, da so viele andere starben. Jeder von ihnen weiß viele kleine Einzelheiten zu erzählen, zufällige und beabsichtigte – ein rechtzeitig getaner Schritt, der Entschluss, ins Haus zu gehen, mit dem einen Straßenbahnwagen zu fahren statt mit dem nächsten –, Einzelheiten, die ihn gerettet haben. Und heute weiß jeder, dass er im Verlaufe seiner Rettung ein Dutzend Leben gelebt hat, dass er mehr Menschen hat sterben sehen, als er je hätte ahnen können. Damals wusste keiner von ihnen irgendetwas.
Der Referend Tanimoto war an jenem Morgen um fünf Uhr aufgestanden. Er war allein im Pfarrhaus, weil seine Frau seit einiger Zeit mit ihrem einjährigen Baby über Nacht zu einem Freund in Ushida zu fahren pflegte, einer Vorstadt im Norden. Von allen bedeutenden Städten Japans waren nur zwei, Kyoto und Hiroshima, von ausgiebigeren Besuchen von B-san, des »Mr. B.«, wie die Japaner in einer Mischung von Respekt und bitterer Vertraulichkeit die B-29 nannten, verschont geblieben, und Tanimoto war, wie alle seine Nachbarn und Bekannten, beinahe krank vor Furcht. Er hatte unangenehm detaillierte Berichte über Massenangriffe auf Kure, Iwakuni, Tokuyama und andere nahegelegene Städte gehört. In der vergangenen Nacht hatte er schlecht geschlafen, weil mehrmals Luftalarm gewesen war. Seit Wochen gab es in Hiroshima fast allnächtlich solche Alarme, denn damals benutzten die B-29 den Biwa-See nordöstlich von Hiroshima als Treffpunkt, und egal welche Stadt die Amerikaner zu bombardieren beabsichtigten, die Superfestungen flogen über die Küste bei Hiroshima ein. Die Häufigkeit der Alarmsignale und die fortgesetzte Zurückhaltung von »Mr. B.« im Hinblick auf Hiroshima hatte die Einwohner der Stadt nervös gemacht, und es ging das Gerücht, die Amerikaner hätten Hiroshima für etwas Besonderes aufgespart.
Herr Tanimoto war ein kleiner Mann, der gern sprach, schnell lachte und leicht weinte. Er trug das schwarze Haar in der Mitte gescheitelt und ziemlich lang. Die unmittelbar oberhalb der Augenbrauen vorgewölbten Stirnknochen, der kleine Schnurrbart, der kleine Mund und das kleine Kinn verliehen ihm ein seltsames, altjunges Aussehen, knabenhaft und doch weise, schwächlich und doch temperamentvoll. Er bewegte sich rasch und nervös, aber mit einer Zurückhaltung, die den Eindruck erweckte, als sei er ein bedächtiger, vorsichtiger Mann. Ja, gerade diese Eigenschaften hatte er in den ungemütlichen Tagen vor der Atombombe an den Tag gelegt. Tanimoto hatte nicht nur seine Frau über Nacht nach Ushida geschickt, sondern auch alles Bewegliche aus seiner Kirche, die in dem dichtbevölkerten Wohnviertel Nagaragawa lag, ins Haus eines Kunstseidefabrikanten in Koi geschafft, zwei Meilen vom Zentrum der Stadt entfernt. Der Kunstseidefabrikant, ein gewisser Herr Matsui, hatte seinen damals unbewohnten Besitz einer großen Zahl von Freunden und Bekannten geöffnet, damit sie alles, was sie in sicherer Entfernung von dem voraussichtlichen Zielgebiet wissen wollten, hierher übersiedeln könnten. Es bereitete Tanimoto keine Schwierigkeiten, Stühle, Gesangbücher, Bibeln, Altargeräte und Kirchenbücher eigenhändig mittels eines Schubkarrens zu transportieren, aber der Orgelkasten und ein Pianino erforderten immerhin Hilfe. Tags zuvor hatte ihm ein Freund namens Matsuo geholfen, das Pianino nach Koi hinauszuschaffen, und im Gegenzug hatte Tanimoto ihm versprochen, die Sachen seiner Tochter heute hinausbringen zu helfen. Deshalb war er so zeitig aufgestanden.
Tanimoto machte sich sein Frühstück selbst. Er war furchtbar müde. Die Anstrengung mit dem Transport des Pianinos tags zuvor, eine schlaflose Nacht, Wochen von Unruhe und unregelmäßiger Ernährung, die Sorge um seine Pfarrei – alles zusammen sorgte dafür, dass er sich der Arbeit des neuen Tages kaum gewachsen fühlte. Dazu kam noch etwas anderes: Tanimoto hatte am Emory College in Atlanta, Georgia, Theologie studiert. Im Jahre 1940 hatte er seinen Doktor gemacht. Er sprach ausgezeichnet Englisch. Er trug amerikanische Kleider. Er war bis unmittelbar vor Kriegsausbruch mit vielen amerikanischen Freunden im Briefwechsel gestanden. Und unter Menschen, die von der Angst besessen waren, ausspioniert zu werden – vielleicht war er davon selbst besessen –, fühlte er sich von Tag zu Tag unbehaglicher. Mehrmals war er von der Polizei verhört worden, und erst vor wenigen Tagen hatte er erfahren, dass einer seiner einflussreichen Bekannten, ein gewisser Herr Tanaka, pensionierter Offizier der Toyo-Kisen-Kaisha-Schifffahrtslinie, ein Gegner des Christentums, ein Mann, der wegen seiner ostentativen Wohltätigkeit in Hiroshima berühmt und wegen seiner persönlichen Herrschsucht berüchtigt war, herumerzählt habe, man solle Tanimoto nicht trauen. Tanimoto begegnete dieser Verdächtigung damit, dass er, um sich öffentlich als guter Japaner zu erweisen, den Vorsitz in seiner lokalen tonarigumi, der Bezirksvereinigung, annahm, und diese Stellung hatte ihm nebst seinen übrigen Pflichten und Sorgen die Aufgabe eingetragen, den Luftschutz für etwa 20 Familien zu organisieren.
An diesem Morgen machte sich Tanimoto vor sechs Uhr auf den Weg zu Matsuos Haus. Hier erfuhr er, dass sie einen tansu, einen großen japanischen Schrank, fortschaffen sollten, der voller Kleider und anderer Einrichtungsgegenstände war. Die beiden Männer brachen auf. Der Morgen war vollkommen klar und so warm, dass man sich auf einen ungemütlichen Tag gefasst machen musste. Wenige Minuten nach dem Aufbruch der beiden ertönte die Alarmsirene – ein minutenlanges Heulen, das die Annäherung feindlicher Flugzeuge ankündigte, das aber gleichzeitig besagte, es handle sich nur um eine geringe Gefahr, da das Signal ja jeden Morgen zu dieser Stunde ertönte, sobald ein amerikanisches Wetterflugzeug einflog.
Die beiden Männer zogen und schoben den Handwagen durch die Straßen der Stadt. Hiroshima breitete sich fächerförmig aus und lag zum größten Teil auf den sechs Inseln, die von den sieben Mündungsarmen des Ota gebildet werden. Die wichtigsten Geschäfts- und Wohnbezirke, die sich über rund vier Quadratmeilen im Zentrum der Stadt erstreckten, beherbergten drei Viertel der Gesamtbevölkerung, die durch mehrere Evakuierungen von einem Maximum von 380 000 während des Krieges auf etwa 245 000 Einwohner vermindert worden war. Fabriken und andere Wohnviertel oder Vororte gliederten sich eng an die Stadtränder an. Im Süden lagen die Docks, ein Flughafen und das inselreiche Binnenmeer. Die anderen drei Seiten des Deltas sind von einem Kranz von Bergen umgeben.
Tanimoto und Matsuo wählten den Weg durch das Geschäftsviertel, das schon von Menschen wimmelte, und über zwei Flussarme zu den steilen Straßen von Koi, dann über diese hinauf an die Peripherie und zu den Ausläufern der Berge. Als sie aus der dicht bebauten Zone in ein Tal hinauskamen, ertönte das Entwarnungssignal. (Die japanischen Radar-Operateure, die nur drei Flugzeuge entdeckten, nahmen an, dass es sich um einen Erkundungsflug handle.) Es war sehr ermüdend, den Handwagen zum Haus des Kunstseidefabrikanten hinaufzuschieben, und nachdem die beiden Männer ihre Fracht auf die Zufahrtsrampe und bis an die Stufen des Eingangs manövriert hatten, machten sie halt, um ein bisschen auszuruhen. Sie standen an einem Flügel des Hauses, der zwischen ihnen und der Stadt lag. Wie die meisten Häuser in dieser Gegend Japans bestand auch dieses aus hölzernem Fachwerk und Holzwänden, die ein schweres Ziegeldach trugen. Die Eingangshalle, voll von Bettwäsche- und Kleiderbündeln, sah aus wie ein kühles Gewölbe voller dicker Kissen. Gegenüber dem Haus, rechts von der Eingangstür, lag ein großer, kunstvoll angelegter Felsengarten. Von Flugzeugen war nichts zu hören. Der Morgen war still, der Ort kühl und angenehm.
Da zerriss ein grauenvoller Lichtblitz den Himmel. Tanimoto erinnerte sich genau, dass der Blitz von Osten nach Westen ging, von der Stadt nach den Bergen. Es schien ein flammendes Stück Sonne zu sein. Tanimoto und Matsuo reagierten mit Entsetzen; beide hatten Zeit zu reagieren, denn sie befanden sich 3500 Yards, das sind etwa zwei Meilen, vom Zentrum der Explosion entfernt. Matsuo stürzte die Stufen des Eingangs hinauf ins Haus hinein, tauchte zwischen die Bettwäschebündel und vergrub sich dort. Tanimoto machte vier, fünf Schritte und warf sich im Garten zwischen zwei große Felsblöcke. Er stieß mit dem Bauch hart auf einen dieser Felsen. Da nun sein Gesicht an dem Stein lag, sah er nicht, was sich ereignete. Er spürte einen plötzlichen Druck, dann regnete es Holzsplitter und Holzstücke und Bruchstücke von Ziegeln über ihn. Er hörte kein Getöse. (Fast keiner der Einwohner von Hiroshima erinnerte sich, ein Geräusch von der Bombe vernommen zu haben. Aber ein Fischer in seinem Sampan auf dem Binnenmeer bei Tsuzu, der Mann, bei dem Tanimotos Schwiegermutter und Schwägerin wohnten, sah den Lichtblitz und hörte eine furchtbare Explosion. Er befand sich etwa zwanzig Meilen von Hiroshima entfernt, aber der Donner war stärker als damals, als die B-29 Iwakuni, fünf Meilen entfernt, bombardierten.)
Als Tanimoto endlich den Kopf zu heben wagte, sah er, dass das Haus des Kunstseidefabrikanten eingestürzt war. Er glaubte, es sei direkt von einer Bombe getroffen worden. Es waren derartige Staubwolken aufgestiegen, dass ringsumher eine Art Dämmerung herrschte. In panischem Schrecken stürzte er, ohne in dem Moment an Matsuo zu denken, der unter den Ruinen lag, auf die Straße hinaus. Im Laufen bemerkte er, dass die Betonmauer des Anwesens eingestürzt war, und zwar mehr gegen das Haus als vom Haus weg. Das Erste, was er auf der Straße sah, war ein Trupp Soldaten, die in der gegenüberliegenden Bergflanke gegraben hatten – sie machten dort einen von den 1000 Unterständen, in denen die Japaner offenbar einer Invasion Widerstand zu leisten und jede Erderhebung, jedes Menschenleben zu verteidigen beabsichtigten. Aus dieser Höhle, in der sie hätten sicher sein sollen, kamen die Soldaten heraus, Kopf, Brust und Rücken blutüberströmt. Sie waren betäubt und stumm.
Unter der Staubwolke, die über dem Ort zu liegen schien, wurde der Tag dunkler und dunkler.
In der Nacht vor der Bombe, gegen Mitternacht, hatte der Ansager der städtischen Radiostation gesagt, dass etwa 200 B-29 auf das südliche Honshu im Anflug wären, und hatte der Bevölkerung empfohlen, sich nach den zugewiesenen »Sicherheitsgebieten« zu begeben. Frau Hatsuyo Nakamura, die Schneiderswitwe, die im Bezirk Nobori-cho wohnte und seit langem gewohnt war, alle Weisungen zu befolgen, holte ihre drei Kinder – den zehnjährigen Toshio, die achtjährige Yaeko und die fünfjährige Myeko – aus den Betten, zog sie an und ging mit ihnen auf das Militärareal am nordöstlichen Stadtrand, bekannt als Östlicher Exerzierplatz. Dort entrollte sie einige Matten und legte die Kinder darauf nieder. Sie schliefen bis etwa zwei Uhr; dann wurden sie vom Lärm der Flugzeuge, die Hiroshima überflogen, geweckt.
Sobald die Flugzeuge fort waren, ging Frau Nakamura mit ihren Kindern wieder zurück. Sie erreichten ihre Wohnung kurz nach halb drei. Sie machte sofort das Radio an, das zu ihrer Verzweiflung eben wieder eine neue Luftwarnung aussandte. Als sie die Kinder anschaute und sah, wie müde sie waren, und als sie an die vielen Wanderungen dachte, die die Kleinen in den letzten Wochen zum Exerzierplatz hatten machen müssen, immer ohne Zweck und Grund, konnte sie sich trotz der Instruktionen aus dem Radio nicht dazu entschließen, noch einmal das Haus zu verlassen. Sie steckte die Kinder in die Schlafkissen auf dem Fußboden, legte sich um drei Uhr selbst hin und schlief sofort ein, und zwar so fest, dass sie, als später Flugzeuge über die Stadt flogen, von dem Lärm nicht erwachte.
Gegen sieben Uhr wurde sie vom Geheul der Sirenen munter. Sie stand auf, kleidete sich rasch an, eilte zum Haus des Vorstehers der Bezirksvereinigung Nakamoto und fragte ihn, was sie tun solle. Er sagte ihr, sie solle zu Hause bleiben, bis eine dringende Luftwarnung käme – eine Reihe intermittierender Sirenentöne. Sie kehrte in ihre Wohnung zurück, machte im Küchenherd Feuer an, setzte Reis zum Kochen auf und begann im Chigoku, einem Morgenblatt aus Hiroshima, zu lesen. Um acht Uhr ertönte zu ihrer Erleichterung das Entwarnungssignal. Da sie die Kinder sich rühren hörte, ging sie zu ihnen, gab jedem eine Handvoll Erdnüsse und sagte, sie sollten in den Kissen bleiben, da sie ja noch müde sein mussten von der nächtlichen Wanderung. Sie hatte gehofft, die Kinder würden wieder einschlafen, aber der Mann im südlichen Nachbarhaus fing an, mit Hämmern, Hacken, Spleißen und Reißen ein wahnsinniges Getöse zu machen. Die Regierungsbehörde, wie jeder in Hiroshima davon überzeugt, dass die Stadt bald angegriffen werden würde, hatte damit begonnen, durch Drohungen und Warnungen die Freilegung breiter Brandstraßen zu erzwingen, die, wie man hoffte, in Verbindung mit den Flussarmen dazu dienen könnten, durch Brandbomben entstandene Feuersbrünste lokal zu begrenzen. So opferte der Nachbar, wenn auch widerwillig, sein Haus für die Sicherheit der Stadt. Erst tags zuvor hatten die Behörden angeordnet, dass alle Mädchen aus den Bürgerschulen, die sich körperlich dazu eigneten, einige Tage damit zubringen sollten, diese Straßen zu reinigen, und sie begannen mit der Arbeit kurz nach dem Entwarnungssignal.
Frau Nakamura ging in die Küche zurück, schaute nach dem Reis und beobachtete den Nachbarn. Erst ärgerte sie sich über ihn, weil er solchen Lärm machte, aber dann rührte sie das Mitleid beinahe zu Tränen. Ihre Gemütsbewegung richtete sich vor allem auf den Nachbarn, der Brett für Brett sein Haus niederriss, zu einer Zeit, in der es so viel unausweichliche Zerstörung gab, aber zweifellos empfand sie auch ein allgemeines, auf die Gemeinschaft gerichtetes Mitleid, von Selbstmitleid nicht zu reden. Sie hatte es nicht leicht gehabt. Ihr Mann Isawa war gleich nach Myekos Geburt eingerückt, und lange Zeit hatte sie nichts von ihm gehört, bis sie endlich am 5. März 1942 ein Telegramm von sieben Worten erhielt: »Isawa starb eines ehrenvollen Todes in Singapur.« Später erfuhr sie, dass er am 15. Februar, dem Tag der Eroberung Singapurs, gefallen war, und dass er es bis zum Korporal gebracht hatte. Isawa war kein besonders erfolgreicher Schneider gewesen, sein ganzes Kapital bestand in einer Sankoku-Nähmaschine. Als nach seinem Tod keine Zuteilungen mehr kamen, holte Frau Nakamura die Nähmaschine hervor und begann selbst Akkordarbeit anzunehmen. Seither ernährte sie sich und die Kinder kümmerlich durch Nähen.
Während Frau Nakamura dastand und ihrem Nachbarn zusah, war plötzlich alles von einem grellweißen Blitz erleuchtet, so weiß, wie sie es noch nie gesehen hatte. Was dem Mann im Nebenhaus geschah, sah sie nicht; der Mutterreflex ließ sie sofort zu ihren Kindern eilen. Sie hatte einen einzigen Schritt getan (das Haus war 1350 Yards, das sind drei Viertelmeilen, vom Zentrum der Explosion entfernt), als sie von irgendetwas emporgehoben wurde und über das erhöhte Schlafpodest ins nächste Zimmer zu fliegen glaubte, verfolgt von Teilen ihres Hauses.
Holzstücke fielen rings um sie herab, während sie auf dem Fußboden landete, und ein Regen von Dachziegeln trommelte auf sie nieder. Der Schutt begrub sie nicht. Sie erhob sich und machte sich frei. Sie hörte ein Kind rufen: »Mutter, hilf mir!«, und erblickte ihr Jüngstes, die fünfjährige Myeko, bis zur Brust verschüttet und unfähig, sich zu rühren. Während Frau Nakamura sich wie wahnsinnig mit den bloßen Händen den Weg zu ihrem Kind zu graben begann, sah und hörte sie nichts von den beiden anderen Kindern.
An den Tagen, die der Bombe unmittelbar vorausgingen, hatte Dr. Masakazu Fujii, wohlhabend, genießerisch und gerade nicht allzu sehr beschäftigt, sich den Luxus gegönnt, bis neun oder halb zehn zu schlafen. An dem Tag, an dem die Bombe fiel, musste er glücklicherweise zeitig aufstehen, um einen Gast seines Hauses zur Bahn zu begleiten. Er stand um sechs auf, und eine halbe Stunde später wanderte er mit seinem Freund über zwei Flussarme zum Bahnhof, der nicht weit entfernt war. Um sieben, eben als die Sirene ihr Dauersignal ertönen ließ, war er wieder zu Hause. Er frühstückte und zog sich dann, da der Morgen schon recht warm war, bis auf die Unterwäsche aus; so ging er in die Vorhalle hinaus, um die Zeitung zu lesen.
Die Vorhalle – ja, das ganze Gebäude – war merkwürdig konstruiert. Dr. Fujii war Eigentümer einer spezifisch japanischen Einrichtung: eines Privatspitals mit nur einem Arzt. Dieses Gebäude, neben und über dem Wasser des Kyo hockend und in der Nähe der Brücke gleichen Namens gelegen, hatte 30 Zimmer für 30 Patienten und ihre Angehörigen. Nach japanischer Sitte wird jeder, der erkrankt und ein Spital aufsucht, von einem oder mehreren Mitgliedern seiner Familie begleitet. Sie wohnen bei ihm, kochen für ihn, baden ihn, massieren ihn, lesen ihm vor und beweisen ihm unablässig die Anteilnahme der Familie, ohne die der Japaner tatsächlich höchst unglücklich wäre. Dr. Fujii hatte für seine Patienten keine Betten – nur Strohmatten. Im Übrigen besaß er alle möglichen modernen Einrichtungen: einen Röntgenapparat, einen Diathermieapparat und ein schön gekacheltes Laboratorium. Das Gebäude ruhte zu zwei Dritteln auf dem festen Land, während ein Drittel auf Pfeilern über die Wasserfläche des Kyo hinausragte. Dieser überhängende Teil des Gebäudes, der Teil, in dem sich die Wohnung Dr. Fujiis befand, sah wunderlich aus, aber er war im Sommer kühl, und der Blick von der Vorhalle, deren Front vom Stadtzentrum abgewandt war, auf den Fluss mit seinen aufwärts und abwärts gleitenden Ausflugsbooten hatte immer etwas Erfrischendes. Gelegentlich war es Dr. Fujii etwas ängstlich zumute, wenn die Mündungsarme des Ota mit der Flut stiegen; aber die Stützpfeiler waren offenbar stark genug, und bisher hatte das Haus immer gehalten.
Seit etwa einem Monat hatte Dr. Fujii relativ wenig zu tun. Im Juli, als die Zahl der noch nicht angegriffenen japanischen Städte abnahm und Hiroshima immer unausweichlicher ein Ziel zu werden drohte, hatte er begonnen, seine Patienten nach und nach fortzuschicken, weil er im Fall eines Angriffs mit Brandbomben nicht imstande gewesen wäre, sie zu evakuieren. Zurzeit hatte er nur noch zwei Patienten: eine Frau aus Yano, die an der Schulter verletzt war, und einen jungen Mann von 25 Jahren, der sich von Verbrennungen erholte, die er bei einem Bombardement der Stahlwerke bei Hiroshima erlitten hatte. Dr. Fujii hatte sechs Krankenschwestern. Seine Frau und seine Kinder befanden sich in Sicherheit. Die Frau wohnte mit einem Jungen in der Umgebung von Osaka, während ein zweiter Sohn und zwei Töchter auf der Insel Kyushu auf dem Land waren. Bei Dr. Fujii lebten eine Nichte, eine Magd und ein Diener. Dr. Fujii hatte wenig zu tun, was ihn aber nicht bekümmerte, da er etwas Geld angespart hatte. Mit seinen 50 Jahren war er gesund, gelassen und heiter; die Abende verbrachte er gerne mit Freunden bei einer Flasche Whisky, stets offen und zum Gespräch geneigt. Vor dem Krieg bevorzugte er importierte Marken aus Schottland und Amerika; jetzt war er mit der besten japanischen Marke, Suntory, durchaus zufrieden.
Dr. Fujii setzte sich in Unterwäsche mit untergeschlagenen Beinen auf die fleckenlose Matte der Vorhalle, setzte die Brille auf und begann, die Asahi, eine Zeitung aus Osaka, zu lesen. Er las die Nachrichten aus Osaka gern, weil seine Frau dort lebte. Er sah den Lichtblitz. Da er mit dem Gesicht vom Stadtzentrum abgewandt saß und in seine Zeitung schaute, erschien es ihm wie leuchtendes Gelb. Erschrocken begann er, auf die Füße zu kommen. In diesem Augenblick (er befand sich 1550 Yards vom Mittelpunkt der Stadt entfernt) neigte sich das Spital hinter ihm und stürzte mit einem furchtbaren Lärm kopfüber in den Fluss. Der Arzt, der noch im Begriff war aufzustehen, wurde vorwärts geworfen, um seine eigene Achse gedreht und kopfüber fortgeschleudert. Er prallte auf und wurde gepackt; er verlor jede Orientierung, da alles so rasend schnell ging; er spürte das Wasser.
Dr. Fujii hatte kaum Zeit, daran zu denken, dass er starb, als er bemerkte, dass er lebte, eingeklemmt zwischen zwei langen Balken, die in der Form eines V um seine Brust lagen, etwa wie ein Bissen, der von zwei riesigen Essstäbchen festgehalten wird. Es hielt ihn aufrecht, so dass er sich nicht rühren konnte, wobei er den Kopf wunderbarerweise über dem Wasser, Körper und Beine aber im Wasser hatte. Rings um ihn trieben die Reste seines Spitals in einem tollen Wirbel von zersplittertem Holz und Material, das sonst zur Linderung von Schmerzen diente. Seine rechte Schulter tat ihm furchtbar weh. Seine Brille war fort.
Pater Wilhelm Kleinsorge, S. J., war am Morgen der Explosion in ziemlich elendem Zustand. Die japanische Kriegskost bekam ihm nicht, und der Gedanke, in dem fremdenfeindlicher werdenden Japan als Ausländer zu leben, bedrückte ihn; selbst ein Deutscher war seit der Niederlage des Heimatlandes nicht mehr beliebt. Pater Kleinsorge hatte mit 38 Jahren das Aussehen eines aufgeschossenen Jungen – mageres Gesicht, mit einem vorspringenden Adamsapfel, eine eingefallene Brust, baumelnde Arme und große Füße. Er ging schwerfällig, ein wenig vorgebeugt. Immer war er müde. Was die Sache noch schlimmer machte: Er hatte, gemeinsam mit Pater Cieslik, seinem Kollegen, an einem schmerzhaften, hartnäckigen Durchfall gelitten, was sie den Bohnen und dem schwarzen Rationierungsbrot zuschrieben, das sie zu essen gezwungen waren. Zwei andere Priester, die damals im Missionsgebäude im Bezirk Nobori-cho wohnten – Pater Superior LaSalle und Pater Schiffer –, waren der Erkrankung zum Glück entgangen.
Am Tag der Bombe erwachte Pater Kleinsorge gegen sechs Uhr morgens, und eine halbe Stunde später – er war wegen seiner Erkrankung etwas langsam – begann er, in der Missionskapelle die Messe zu lesen. Die Kapelle war ein kleines Holzgebäude in japanischem Stil und hatte keine Betstühle, da die Andächtigen auf dem wie in Japan üblich mit Matten bedeckten Fußboden knieten, vor Augen einen mit prächtigen Seidengeweben, Messing- und Silbergeräten und schweren Stickereien geschmückten Altar. An diesem Morgen, einem Montag, waren nur wenige Andächtige da: der Theologiestudent Takemoto, der im Missionshaus lebte, Fukai, der Sekretär der Diözese, Frau Murata, die fromme christliche Haushälterin der Mission, und Kleinsorges Kollegen. Als Pater Kleinsorge nach der Messe das Dankgebet sprach, ertönte die Sirene. Er unterbrach den Gottesdienst, und die Mitglieder der Mission zogen sich in das größere Gebäude zurück. Dort legte Pater Kleinsorge eine militärische Uniform an, die er auf Grund seiner Lehrtätigkeit an der Rokko-Mittelschule zu tragen berechtigt war und die er während eines Luftalarms immer trug.
Nach einem Alarm ging Pater Kleinsorge immer ins Freie, um den Himmel abzusuchen, und diesmal stellte er, als er hinaustrat, mit Vergnügen fest, dass nur das eine Wetterflugzeug zu sehen war, das täglich um diese Zeit Hiroshima überflog. Beruhigt darüber, dass nichts geschehen würde, ging er ins Haus und frühstückte mit den anderen Patres, Ersatzkaffee und das rationierte Brot, das ihm unter den Umständen besonders widerlich war. Die Patres saßen beisammen und unterhielten sich eine Weile, bis sie um acht Uhr das Entwarnungssignal hörten. Sie begaben sich nach den verschiedenen Teilen des Gebäudes. Pater Schiffer ging auf sein Zimmer, um zu schreiben. Pater Cieslik ließ sich in seinem Zimmer auf einem Stuhl nieder, zur Linderung seiner Schmerzen ein Kissen auf dem Magen, und las. Der Pater Superior La Salle stand nachdenklich am Fenster seines Zimmers. Pater Kleinsorge ging in sein Zimmer im dritten Stock hinauf, zog sich bis auf die Unterwäsche aus, streckte sich, auf der rechten Seite liegend, auf einem Feldbett aus und begann, seine Stimme der Zeit zu lesen.
Nach dem furchtbaren Blitz – der ihn, wie Pater Kleinsorge sich später bewusst wurde, an etwas erinnerte, was er als Knabe über den Zusammenstoß eines Kometen mit der Erde gelesen hatte – blieb ihm noch Zeit (da er 1400 Yards vom Zentrum entfernt war) für einen Gedanken: Eine Bombe ist direkt auf uns gefallen! Dann verlor er für einige Sekunden oder Minuten das Bewusstsein.
Pater Kleinsorge hat niemals erfahren, wie er aus dem Haus gekommen war. Das Nächste, an das er sich bewusst erinnerte, war, dass er in Unterwäsche im Gemüsegarten der Mission umherwanderte, aus kleinen Schnittwunden an seiner linken Seite ein wenig blutend; dass alle Gebäude ringsum eingestürzt waren, mit Ausnahme des Missionshauses der Jesuiten, das schon vor langem von einem Priester namens Gropper, der eine heillose Angst vor Erdbeben hatte, gestützt und wieder gestützt worden war; dass der Tag sich verfinstert hatte; und dass Murata-san, die Haushälterin, in der Nähe war und immer und immer wieder schrie: »Shu Jesusu, awaremi tamai! O Herr Jesus, erbarme Dich unser!«
In einem Abteil des Eisenbahnzugs, der vom flachen Land auf Hiroshima zurollte, saß Dr. Terufumi Sasaki, der Chirurg des Rot-Kreuz-Spitals, und dachte über einen bösen Traum nach, der ihn nachts zuvor heimgesucht hatte. Er wohnte mit seiner Mutter in Mukaihara, 30 Meilen von der Stadt entfernt, und es kostete ihn zwei Stunden, um mit Bahn und Straßenbahn das Spital zu erreichen. Er hatte die ganze Nacht schlecht geschlafen, war um eine Stunde früher als gewöhnlich aufgewacht und hatte, matt und leicht fiebernd, überlegt, ob er überhaupt ins Spital fahren solle. Sein Pflichtbewusstsein zwang ihn schließlich dazu, und er fuhr mit einem früheren Zug als sonst. Der Traum hatte ihn besonders erschreckt, weil er, wenigstens äußerlich, mit einer beunruhigenden Wirklichkeit in engem Zusammenhang stand. Dr. Terufumi war erst 25 Jahre alt und hatte eben seine Ausbildung an der Östlichen Medizinischen Universität in Tsingtao, China, beendet. Er war sowas wie ein Idealist, und die Unzulänglichkeit der sanitären Einrichtungen in der Provinzstadt, in der seine Mutter lebte, bereitete ihm große Sorgen. Ganz auf eigene Faust und ohne Erlaubnis hatte er dort abends einige Krankenbesuche gemacht, nach acht Stunden im Spital und vier Stunden Fahrt.
Vor kurzem hatte er erfahren, dass die Strafen darauf, ohne Erlaubnis zu praktizieren, streng waren, und ein Kollege, an den er sich in dieser Sache gewandt hatte, hatte ihn ernstlich ausgescholten. Trotzdem hatte er die Praxis fortgesetzt. Im Traum hatte er am Bett eines Patienten vom Land gesessen, als die Polizei und der Arzt, mit dem er sich beraten hatte, ins Zimmer stürzten, ihn ergriffen, hinausschleppten und fürchterlich verprügelten. Im Eisenbahnzug war er eben zu dem Entschluss gekommen, die Arbeit in Mukaihara aufzugeben, weil er es für unmöglich hielt, eine Erlaubnis zu bekommen, denn die Behörden würden der Auffassung sein, dass die Privatpraxis mit seinem Dienst im Rot-Kreuz-Spital kollidiere.
Am Hauptbahnhof erwischte er sofort einen Straßenbahnwagen. (Später rechnete er sich aus, dass er, wenn er morgens mit seinem gewöhnlichen Zug gefahren wäre und, wie das oft passierte, ein paar Minuten auf die Straßenbahn hätte warten müssen, zum Zeitpunkt der Explosion im Stadtzentrum gewesen und bestimmt umgekommen wäre.) Er erreichte das Spital um 7 Uhr 40 und meldete sich beim Chefarzt. Wenige Minuten später ging er in ein Zimmer im ersten Stock, um vom Arm eines Patienten zum Zweck der Wassermann-Probe etwas Blut zu entnehmen. Das Labor, das die Inkubatoren für die Probe enthielt, befand sich im dritten Stock. Mit der Blutprobe in der linken Hand, ging er, zerstreut wie schon den ganzen Morgen, wahrscheinlich infolge des Traums und der unruhigen Nacht, auf dem Weg zum Stiegenhaus den Hauptkorridor entlang. Er befand sich einen Schritt hinter einem offenen Fenster, als die Wände des Korridors den Schein der Bombe wie ein riesiges fotografisches Blitzlicht reflektierten. Er beugte das Knie und sagte zu sich selbst, wie es nur ein Japaner tun würde: »Sasaki, gambare! Sei tapfer!« Im selben Augenblick (das Gebäude war 1650 Yards vom Zentrum entfernt) zerriss die Lufterschütterung das Spital. Die Brille, die er trug, flog ihm davon, das Fläschchen mit dem Blut zerbarst an der Wand, seine japanischen Pantoffeln glitten ihm unter den Füßen davon – sonst aber war er, dank seines Standorts, unverletzt.
Dr. Sasaki rief den Namen des Chefarztes, stürzte in sein Büro und fand ihn dort, von Glasscherben furchtbar zerschnitten. Das Spital war grauenvoll verwüstet: Schwere Wände und Decken waren auf die Patienten gestürzt, Betten waren umgeworfen, Fensterscheiben waren ins Innere geflogen und hatten den Menschen Schnittwunden beigebracht, Blut war auf dem Fußboden und auf den Wänden verspritzt, überall lagen Instrumente, viele Patienten liefen schreiend herum, noch mehr lagen tot auf dem Boden. (Ein Kollege Dr. Sasakis, der in dem Labor beschäftigt war, das er eben aufsuchen wollte, war tot. Der Patient, den er gerade verlassen hatte und der noch vor wenigen Augenblicken schreckliche Angst vor der Syphilis hatte, war auch tot.) Dr. Sasaki stellte fest, dass er der einzige Arzt im Spital war, der unverletzt war.





























