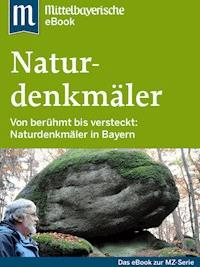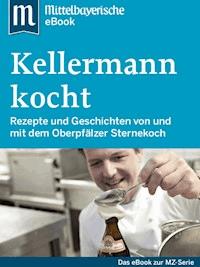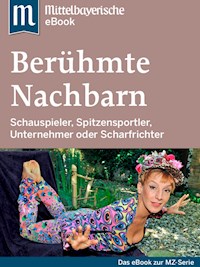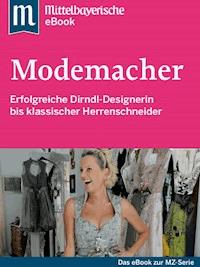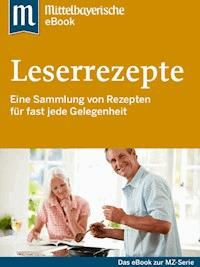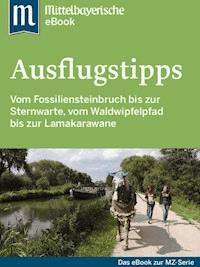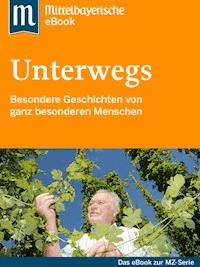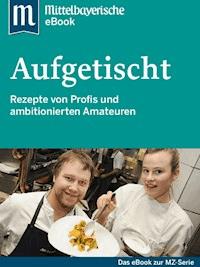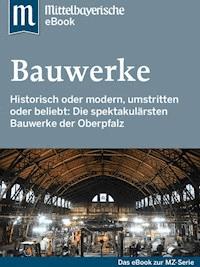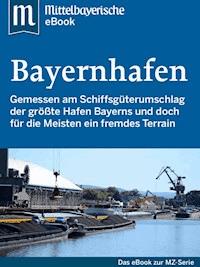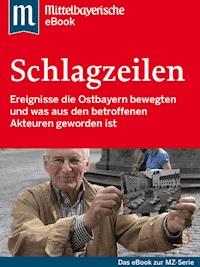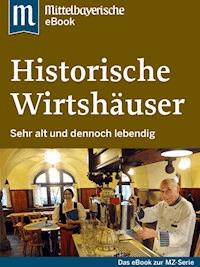
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Schon sehr alt und dennoch sehr lebendig – Geschichte und Geschichten aus historischen Wirtshäusern in ganz Ostbayern.
Das E-Book Historische Wirtshäuser wird angeboten von epubli und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Reportage,Geschichte,Bischofshof,Wirtshaus,Papst,Menschen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Frischer Wind im Oberpfälzer Jura
Biergarten mit Welterbe-Panorama
Der Treffpunkt mitten im Stadtpark
Täglich geöffnet – 365 Tage im Jahr
Geheimnisse aus der Klosterruine
Das Motto: „Gut. Reichlich. Frisch“
Am Samstag wird „zsammgruckt“
Hier war Papst Benedikt Stammgast
Schmuckstück mit Spitzenküche
Im Hofbräuhaus zählt die Tradition
Willkommen bei der Familie Jakob
Geheimtipp, der keiner mehr ist
Gesamtkunstwerk mit Spitzenküche
Der stattliche Bräu vom Adlersberg
„Beim Lindner“ ist es urgemütlich
Bier vom Kommunikations-Brauer
Eine edle Brotzeit im Edelmannshof
Zwei Gasthäuser, doppelter Genuss
Gibt’s Elfen an der Klosterwirtschaft?
Entschleunigen im Weißen Roß
Das Geniale ist immer einfach
Gastlichkeit in sechster Generation
Der goldene Hirsch in Hirschbach
Einen Bier-Aperitif vor dem Essen
Sorgenfrei schmausen und feiern
Bratwürstl gab’s schon im Mittelalter
Gastlichkeit seit Kolumbus’ Zeiten
Zurück ins Mittelalter beim Stirzer
Der Sperber braut zwölf Sorten Bier
Bierseligkeit braucht keine Worte
Eichhofen – ohne Bier undenkbar
Für die Möbel gab’s 1910 einen Preis
Ein Wirtshaus, das seit 1285 geöffnet hat
Das Mutterhaus des Weißbiers
Gast im ältesten Wirtshaus der Welt
Vom Gutshof zum Vier-Sterne-Hotel
Beim Brandl-Bräu ist der Bär los
Weltliche Genüsse im Kloster
Eine zünftige Zeitreise im Auerbräu
Das Hennerloch als Wohlfühl-Oase
Impressum
Frischer Wind im Oberpfälzer Jura
Das Gasthaus „Zur Linde“ verbindet die Juralandschaft bei Etzelwang mit gutem Essen und gemütlicher Aura zu einem kleinen Gesamtkunstwerk.
Hier fühlen sich Familien ebenso gut aufgehoben wie Wanderer durch den schönen Oberpfälzer Jura. Die Wirtefamilie Schwemmer (vorne links) sorgt für gute Küche und eine gemütliche Atmosphäre. Fotos: Gabi Schönberger
Von Reinhold Willfurth, MZ
Gerhardsberg. Es ist einer der letzten sonnigen Herbstsonntage im Oberpfälzer Jura. Ein kühler Wind schüttelt die letzten Blätter von dem Baum, der dem „Gasthaus Zur Linde“ seinen Namen gab. Trotzdem haben es sich ein paar Gäste auf den Sitzbänken im Biergarten gemütlich gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass es in der Wirtsstube allmählich eng wird. Ein grüner Kachelofen wärmt den gemütlichen Raum mit seiner geschmackvollen Einrichtung, an den vollbesetzten Tischen genießen junge Familien und Wanderer-Paare einfache, aber fein gemachte Oberpfälzer Küche.
Aus dem Stimmengewirr dringen hie und da fränkische Sprachbrocken. Schließlich ist die Gegend um Etzelwang (Kreis Amberg-Sulzbach) die letzte Oberpfälzer Bastion vor dem Nürnberger Land, und viele Gäste aus der nahen Großstadt verbinden eine Wanderung durch die zauberhafte Juralandschaft mit einer Einkehr im „Gasthaus Zur Linde“. Der Abschied von dort fällt nicht leicht: Kaum sind die leeren Teller des Mittagessens abgetragen, wird ein Buffet mit verlockenden hausgemachten Kuchen und Torten aufgetragen. Pech für den Hollywoodstar Nicolas Cage, der sich beinahe das benachbarte Schloss Neidstein gekauft hätte und dann einen Rückzieher machte: Er wäre von der „Linde“ gewiss genauso begeistert gewesen wie die meisten Gäste.
An einem Freitagvormittag ein paar Wochen später. Das letzte Lindenblatt im Biergarten ist gefallen, der erste Schnee überzuckert die Landschaft um das Dorf Gerhardsberg mit seinen 67 Einwohnern. Die Wirte Tanja und Roland Schwemmer rasten kurz bei einer Tasse Kaffee. Für einen Geburtstag und eine Weihnachtsfeier am Abend müssen Speis’ und Trank vorbereitet werden. Obwohl die „Linde“ nur am Wochenende geöffnet hat, geht den Wirten die Arbeit nicht aus, und reich wird man mit einem Wirtshaus auch nicht über Nacht. Roland Schwemmer geht an drei Tagen in der Woche als Forstwirt arbeiten. Aber immerhin, für einen Porsche hat es schon gereicht. Der Sportwagenhersteller hat einst auch Traktoren gebaut, der knallrote „Diesel Standard“ aus dem Jahr 1960 im Hof der Schwemmers ist ein Erbstück vom Opa.
Im Sommer verlockt ein Biergarten zum Draußensitzen.
Ein Bild von einem Wirtshaus
Vor sechs Jahren hat das Paar das Wirtshaus aus dem Jahr 1894 von Tanja Schwemmers Großvater übernommen. „Ich habe als Schülerin schon davon geträumt, ein Wirtshaus zu machen“, sagt die junge Gastronomin. „Obwohl mir mein Vater abgeraten hat“. Nach einer Lehre als Fotographin und einer Tätigkeit in einem Amberger Bioladen war es 2007 dann soweit. Mit viel Fleiß und Geschmack bauten Tanja und Roland Schwemmer Opas Wirtshaus so um, dass es heute den Charme alter Zeiten wieder aufleben lässt. Breite Dielen aus einem alten Stadel machen schon aus dem Boden eine begehbare Antiquität. Das neue, massive Mobiliar und die Holzvertäfelung sind dunkel gebeizt, bis auf die milchkaffeefarbenen Tischplatten aus Eiche. Inspirieren lassen habe man sich von den Stuben im Oberpfälzer Bauernhofmuseum in Neusath-Perschen, sagt Roland Schwemmer.
Beim Essen achtet die Küchenchefin auf zwei Dinge: Das Fleisch stammt aus Biobetrieben, und es kommt aus der Gegend. „Wir schauen darauf, dass wir von den geschlachteten Tieren möglichst alles verwerten“, sagt Tanja Schwemmer. So kommen in der „Linde“ auch Gerichte zu Ehren, die anderswo von der Speisekarte verschwunden sind. Wo gibt es noch Köstlichkeiten wie Schweinerippchen mit dunkler Soße? Welches Wirtshaus bietet den italienischen Klassiker Ossobucco von der Rinderbeinscheibe an? Und aus dem Fleisch, das nicht zu Braten, Schinken oder Sulz verarbeitet wird, werden Bratwürste gemacht, die selbst den kritischsten fränkischen Gaumen glücklich machen. Aber auch Vegetarier brauchen hier nicht zu verzweifeln. Abseits der üblichen Alibi-Gemüseplatte bietet die „Linde“ zum Beispiel „herbstliche Pasta mit Kürbispesto“.
Kleine Speisekarte, großer Genuss
Im Übrigen ist die Speisekarte angenehm klein, und es gibt auch nicht immer alles: Die Gäste nehmen dies als Beweis für Qualität und sind auch meistens ohne Murren bereit, etwas mehr für den Braten zu bezahlen als für den aus der Standard-Küche.
Alte Fotos und ein Wirtshausschild zieren das Nebenzimmer.
Im liebevoll hergerichteten Nebenzimmer weisen sepiafarbene Fotos und ein großes altes Holzschild darauf hin, dass hier ein Familienbetrieb in der achten Generation arbeitet. „Gastwirtschaft und Kolonialwaren Paul Hauenstein“ steht in großen Lettern auf dem Wirtshausschild. „Das war mein Urgroßvater“, sagt Tanja Schwemmer. Die Tradition des Dorfwirtshauses wollen die beiden jungen Wirte fortführen, aber auf etwas andere Art. Die beiden Dorfstammtische tagen dort wie eh und je. Es kehren hier aber auch Menschen ein, die schöne Landschaft, gutes Essen und gemütliches Ambiente als kleines Gesamtkunstwerk genießen.
Mit viel Liebe fürs Detail haben die Wirte das Gasthaus umgebaut.
Biergarten mit Welterbe-Panorama
Die Alte Linde am Oberen Wöhrd in Regensburg ist wahrscheinlich das schönste Lokal weit und breit. Sogar Thailands Kronprinz ist Stammgast.
Das Wirtspaar mit Gästen und dem Stammhaus Kneitinger an der Wand Gabi Schönberger Foto:
Von Thomas Dietz, MZ
Regensburg. Im Wettstreit um den schönsten Biergarten liegen, so lange man denken kann, der Spitalgarten und die Alte Linde an der Spitze. Der Spitalgarten ist älter und größer, aber die Alte Linde am Oberen Wöhrd liegt näher an dem wunderschönen Regensburg-Panorama mit Welterbe-Status.
„Und jetzt in diesen Tagen“, sagt Bernhard Wiesbeck, Pächter der Alten Linde, „gibt es bei klarem Himmel ab halb fünf ein Lichtphänomen. Immer Ende November, Anfang Dezember steht die Sonne in einem Winkel, so dass sie nur die Domtürme anleuchtet und den Rest in den Schatten stellt.“
Vor 14 Jahren, am 1. 12. 1999, haben Wiesbeck und seine Frau Gabi Horn die Alte Linde an der Steinernen Brücke gepachtet. Die hochinteressante Baustelle in Sichtweite wird es noch einige Jahre geben, aber der neue Quersteg zur Lieblstraße soll schon am 17. Dezember eingeweiht werden, was den Zugang zur Alten Linde dann wieder erheblich erleichtert. Auch wird die alte Dame so schön zurechtgemacht, wie sie es in ihrer bald 900-jährigen Geschichte wohl noch nie war.
Der Biergarten, in dem zur Sommerzeit 550 Gäste Platz finden, ist schon abgeräumt, der Holzkohlengrill winterfest abgedeckt. Im Inneren des Jugendstilhauses von 1901 mit Turm und Glockenhaube ist es jetzt umso gemütlicher. Am Eingang steht, etwas zugeräumt, ein altes Orchestrion, und dann schaut man sogleich auf die Panoramafenster zur Donau mit der grandiosen Stadtsilhouette im Abendlicht.
Schmankerlküche ohne Fritteuse
Im Untergeschoss hat’s Hochwasserpaneele zum Hochfahren, „die in diesem Jahr zum ersten Mal nichts genutzt haben, weil das Wasser von der anderen Seite kam“, berichtet Gabi Horn. Also ist die Alte Linde heuer richtig abgesoffen. Da jedoch alles alt und solide ist, kamen Bohlen und Tische in die Trockenkammer und nach drei Tagen ging’s weiter. Versicherung? „Sobald Sie Wasser sehen, gibt’s keine Versicherung“, sagt Bernhard Wiesbeck. Aber die Stadt half.
Die „Alte Linde“ in ihrem schönen Jugendstilhaus, von der Steinernen Brücke aus gesehen. Am 17. 12. soll der Quersteg zur Lieblstraße wieder eingeweiht werden – das erleichtert den Zugang beträchtlich. Gabi Schönberger Foto:
Die Küche, für die Gabi Horn zuständig ist, hat einen gewissen Ruf und ist berühmt für ihre Schmankerl. „Wir haben z. B. keine Fritteuse. Das wollen wir nicht. Wenn die Kinder unsere Knödel mit Soße gegessen haben, fragen sie nicht mehr nach Pommes“, sagt Bernhard Wiesbeck und lächelt.
Serviert werden Pfannenrösti mit Räucherlachs und Kräuterschmand, Fetakäse aus dem Rohr mit Honigpesto und Mandelblättern, Schnitzel im Sesammantel, Schnitzel „Regensburger Art“ (mit Händlmaier-Soße und Fingernudeln) oder Schnitzel „Hamburger Art“ (paniert, mit Zwiebeln, Spiegelei und Bratkartoffeln). „Auch unser Cordon bleu machen wir a bisserl anders“, schwärmt Gabi Horn, „gefüllt mit Schwarzgeräuchertem und Bergkäse.“ Der selbst gemachte Kartoffelsalat und der Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster, Butter, Zucker und Zimt haben ihre Fans. Ausgeschenkt wird seit 1952 das gute Kneitinger.
Die Alte Linde könnte eine Endlosliste prominenter Gäste erstellen – begünstigt auch durch die Nähe des Sorat-Hotels. Hans-Dietrich Genscher (86, tatsächlich stets im gelben Pullunder) und Helge Schneider sind ebenso Stammgäste wie Gloria Fürstin von Thurn und Taxis, die ganz unkompliziert mit ihrer roten Vespa und Stars-and-Stripes-Helm vorbeikommt – ihre Gäste aus dem Vatikan pflegt sie stets hier zu bewirten (die freuen sich schon lange im Voraus, denn Pastagerichte haben sie Zuhause ja selber). Dann fragt die Fürstin immer: „Ist auch Péter, mein ungarischer Kellner, wieder da?“, der sogleich freudestrahlend herbeigeeilt kommt und mit ihr ungarisch zu parlieren pflegt.
Klobrillen mit rosa Samt bezogen
Ein besonderer Stammgast ist der thailändische Kronprinz Maha Vajiralongkorn, der an der Alten Linde ganz offenbar einen Narren gefressen hat. Sein vollständiger Name lautet Somdet Phra Boromma-orasathirat Chao Fa Maha Vajiralongkorn Sayammakutratchakuman. Begleitet wird er meist von seiner dritten Frau, der bezaubernden, blütenblattgleichen Prinzessin Mom Srirasmi Mahidol na Ayuthaya.
Bevor der Kronprinz seinen Fuß über die Schwelle der Alten Linde setzt, schwirren dutzende von Höflingen aus und suchen das Gebäude nach versteckten Bomben ab. Auf den Toiletten werden Rosen gestreut, Düfte versprüht und die Brillen mit rosa Samt bezogen. Es gibt einen eigenen Hundeträger für den Pudel „Fufu“, der Offiziersrang bekleiden und zuweilen an Staatsbanketten teilnehmen soll. Dass vor der Tür zehn schwarze Wagen mit laufendem Motor warten, finden die Anwohner der Müllerstraße/Lieblstraße zwar lästig, aber das Kronprinzenpaar selbst tritt so bescheiden und liebenswürdig auf, dass noch nie eine böse Bemerkung fiel.
Bernhard Wiesbeck hat, bevor er mit seiner Frau Gabi Horn die Alte Linde übernahm, Maschinenbau studiert: „Das ist mir heute bei Reparaturen im Hause ganz schön nützlich“, sagt er und schaut, auch nach 14 Jahren noch immer fasziniert, auf das Stadtpanorama in der untergehenden Sonne ...
Der Treffpunkt mitten im Stadtpark
Das „Café unter den Linden“ ist Café und Biergarten – und eines der ältesten Wirtshäuser in Regensburg. Es hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet.
Reinhold Wellisch, seit zwölf Jahren Pächter des „Cafés unter den Linden“: „Die e.on-Leute, die früher in der direkten Nachbarschaft arbeiteten und hier zu Mittag aßen, kommen immer noch.“ Foto: Gabi Schönberger
Von Thomas Dietz, MZ
Regensburg. Früher oder später findet sich jeder Regensburger im Biergarten „Café unter den Linden“ wieder – rein rechnerisch gesehen ist jedermann dort schon 1,26-mal eingekehrt. Das haben fröhliche Stammgäste zu fortgeschrittener Stunde mit Hilfe einer kühn erdachten Formel ermittelt.
Es muss an der Lage liegen, dass an diesem Häuserl im Stadtpark keiner vorbeigehen mag oder kann, ohne Platz zu nehmen. Fußläufig liegen die Ostdeutsche Galerie und das Figurentheater, die russisch-orthodoxe Kirche, der Chinesenturm – und das schicke „Parkside Office Building“ (früher e.on) mit einer Art schwebendem Ufo im Lichthof. Links und rechts der Prüfeninger Straße herrscht interessante Bautätigkeit; eine vielversprechende Gegend! Eltern schieben ihre Kinderwagen unter alten Stadtpark-Bäumen hindurch, im Sommer wird gegrillt und geboult, auf den Wiesen Federball oder Frisbee gespielt und schön in der Sonne gelegen. Sitzen die Eltern munter im Biergarten unter den Linden oder drinnen, können die Kinder draußen auf 8,5 Hektar herumtoben.
Das „Café unter den Linden“ ist nicht nur Café, sondern eines der ältesten Wirtshäuser Regensburgs. Schon Anfang des 16. Jahrhunderts wurden neben dem Steinbruch vor dem Jakobstor ein Lindenhain und ein Schießplatz angelegt. Und wo sich Schützen treffen, pflegt auch ein Gasthaus aufzumachen. Es hieß erst „Zum Roten Ross in grüner Au“, dann „Zum Roten Ross in grüner Allee“, ab Mitte des 19. Jahrhunderts „Zum Roten Ross unter den Linden“ und ab 1900 „Altkoferanwesen unter den Linden“.
„Man lebt hier sehr zwanglos“
Der Dichter Ernst Moritz Arndt (1769-1860) war hier zu Gast und schrieb in seinen „Bruchstücken aus einer Reise von Baireuth bis Wien im Sommer 1798“ über „... schöne Promenaden von allerley Bäumen, die auch des Abends von Menschen wimmeln. Da findet man alle Nachmittage, von 4 bis 8 Uhr, Leute jedes Standes, Alters und Geschlechtes, und an gewissen Tagen auch Tanzparthieen. Man lebt hier sehr zwanglos und findet sogleich Menschen, mit denen man frey und freundlich ein Wörtchen plaudern kann. Die Bursche erfreuten mich durch ihren Muthwillen und Witz.“
Blick in die Küche: Lehrling Franziska bei der Salat-Zubereitung Foto: Gabi Schönberger
Das dürfte heutzutage kaum anders sein. 1898 und 1909 wurden die dortigen Friedhöfe aufgelöst und an den Galgenberg verlegt (einige Grabsteine sind erhalten und beim Spaziergang zu entdecken). 1910 fand auf dem Gelände unter den Linden die „Große Oberpfälzische Kreisausstellung“ statt. Industrie, Handwerk und Gewerbe aus Regensburg und der Region stellten sich unter dem Motto „Tradition und Aufbruch“ vor. Dafür pflanzte man Hunderte von Laubbäumen, tausende von Sträuchern und baute etliche Pavillons. Die schöne Jugendstil-Stadthalle, entworfen vom damaligen Stararchitekten Josef Koch, wurde leider durch Fliegerbomben zerstört.
Seit zwölf Jahren haben Reinhold Wellisch (47) und Sabine Horn das „Café unter den Linden“ gepachtet. Wellisch, geborener Münchner und gelernter Barkeeper, arbeitete zehn Jahre lang in der Schwabinger Cocktailbar „Peaches“. Ach, mixt er denn manchmal auch hier noch ... „Nein, nein. Ich habe die Zutaten dafür gar nicht da“, sagt er. „Außerdem: kein Barkeeper auf der Welt trinkt seine bunten Cocktails. Nur Bier oder Wein – allerdings erst nach Feierabend.“
Wellisch legt Wert darauf, dass bei ihm alles frisch und regional auf den Tisch kommt: die Speisekarte enthält all die klassisch-soliden Schmankerl, die man in einem Traditionslokal erwartet: z.B. ofenfrischen Schweinsbraten an Dunkelbiersoße mit Sauerkraut und Knödeln, Oberpfälzer Knödelstrudel (Brezenknödel, gefüllt mit Bratwürstl) oder Hirtennudeln in Hackfleischragout mit Erbsen, Speck und frisch geriebenem Parmesan.
Es gibt mindestens sechs vegetarische Gerichte – auch alles selbst gemacht, also ohne diese industriell gefertigten Blumenkohltaler und die offenbar bundesweit verbreiteten, mit Frischkäse gefüllten Kartoffeltaschen.
Täglich geöffnet – 365 Tage im Jahr
„Wir haben immer geöffnet, jeden Tag von 10 bis 1 – 365 Tage im Jahr“, sagt Reinhold Wellisch, „nur Weihnachten und Neujahr machen wir schon um 17 Uhr zu.“ Dann werden auch die schönen alten Gaslampen, die längst elektrisch brennen, gelöscht.
Die schönen, alte Gaslampen sind ein beliebtes Fotomotiv bei Gästen Foto: Gabi Schönberger
Dramatische Stunden hatte das „Café unter den Linden“ erlebt, als im März 2008 das Sturmtief „Emma“ über Regensburg und den Landkreis fegte und zahllose Bäume entwurzelte – auch im Stadtpark. Romantischer war der große Stromausfall vom 3. August 2009, als sich um 20 Uhr gerade die Hochzeitsgäste von Manuela und Rolf Strempel an die Tafel setzten: „Wir hatten 100 Schweinefilets und Zander im Ofen“, erinnert sich Reinhold Wellisch. Er warf schnell den Holzofengrill an, das Personal entzündete dutzende von Kerzen und Rebekka Bösl von „24indigo“ sang unplugged ohne Mikro. „Das war romantisch und unvergesslich“, sagt Wellisch, „und wie gesagt: bei uns war jeder schon mal.“
Gemütlichkeit in der dunklen Jahreszeit: Blick durchs Fenster Foto: Gabi Schönberger
Geheimnisse aus der Klosterruine
Im Gasthof zum Kloster in Berg-Gnadenberg wird zum guten Essen noch manche alte Geschichte erzählt. Und es verbergen sich manche Überraschungen.
Gasthaus zum Kloster gr. Foto
Von Thomas Dietz, MZ
Berg-Gnadenberg. Kolossal! Wann hat man je an einem solchen Ort gestanden? Die Klosterkirche in Gnadenberg ist von überwältigender Schönheit – auch noch 378 Jahre nach ihrer Zerstörung. „Gerade jetzt in der Herbstsonne“, sagt Marianne Haas, die Wirtin vom nahen Gasthof zum Kloster, „wenn die Steine der Ruine von ocker bis auberginefarben leuchten.“
Kein Zweifel, dass dies eine hochspirituelle Stätte ist: „Es kommen Gäste aus den Benelux-Staaten, aus England, der Schweiz und selbstverständlich aus Schweden“, berichtet die Wirtin. Denn das Kloster auf halber Bergeshöhe über dem Schwarzachtal war 1426 eine Gründung des Birgittenordens – nach Birgitta Birgersdotter (Birgitta von Schweden; 1303-1373). In Deutschland gibt es heute nur noch ein Birgittenkloster: im oberbayerischen Altomünster bei Dachau.
Wenn Gnadenberg-Besucher lange genug zu den grandiosen gotischen Fenstern hinaufgeblickt haben (die Grundfläche der Kirche beträgt 70 mal 37 Meter!) kehren sie natürlich in der Klosterschänke ein, die seit 1625 öffentliche Gaststätte ist, um sich bei knisterndem Holzofenfeuer vorzüglich bewirten zu lassen. Marianne Haas ist nie um eine Antwort verlegen: Nein, die Ruine bis zum Mauerabstand von 30 cm links und rechts gehört seit 1889 dem Freistaat, der Garten ist privat. Keller und Gewölbe sind weitgehend erhalten, aber nicht zugänglich.
Archäologische Grabungen gibt es keine, das würde auch große Unruhe in den kleinen Ort bringen. Denn einmal hat man vor dem teilerhaltenen Schwesternheim ein wenig im Boden gekratzt und sofort ein mittelalterliches Kochgeschirr ausgegraben.
Die Magie von Kirchenruinen
Die magisch-surreale Wirkung zerstörter Kirchen inspiriert auch seit langem den Keramikbildhauer Karl Dieter Horn aus Bitzen im Westerwald, der teils tischgroße Ruinenmodelle fertigt, die einmal sogar als Hintergrund-Deko im „Tatort“ vorkamen.
Und ausgerechnet die Schweden haben das Kloster am 23. April 1635 zerstört. Ihr General Horn hatte zwar Schonung versprochen, als jedoch „ein Pfälzer“ vom Klosterdach herunter feuerte und das Pferd eines Trompeters traf, ließ der Heerführer auf der Stelle Kloster und Kirche zerstören: „Anno 1635 an dem heyligen Carfreitage ist das gantze Closter Gnadenberg sambt der schenen Kirchen in Prandt gesteckt“ worden, heißt es in einer Chronik – und zwar mit Mann und Maus, mit beiden Konventsgebäuden, Getreidespeicher, Hirtenhaus und Klostermühle, Malz- und Bräuhaus.
Im Keller: ein Bassin, gefüllt mit Wasser aus hauseigenen Quellen
Das klösterliche Gasthaus, erbaut Ende des 16. Jahrhunderts, wurde verschont. Eine erhaltene urkundliche Erwähnung stammt allerdings erst aus dem Jahr 1629, als „vulminante Raufhändel“ aktenkundig wurden.
Alles ist hier erfreulich alt: über dem Türsturz des Eingangs steht die Jahreszahl 1818, Balkendecke, Dielenboden (mit handgeschmiedeten Nägeln) und die Wandvertäfelung sind weitgehend erhalten. Die Qualitätsmaßstäbe von Marianne Haas und ihrem Mann Michael sind ebenso konservativ: seit 80 Jahren wird Tucher-Bier ausgeschenkt, die Speisen sind frisch, deftig und von heimischen Lieferanten: es gibt knusprige Schweineschäuferl vom Holzofen, Schnitzel aller Art („Klosterschnitzel“ mit Meerrettich-Senf-Panade) oder Bratengröstl mit Spiegelei. Dazu gesellt sich eine vorzügliche Fischkarte: meist mit Karpfen, Bachsaibling und Forelle.