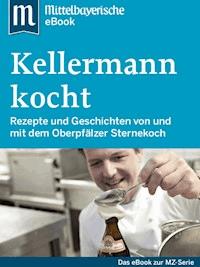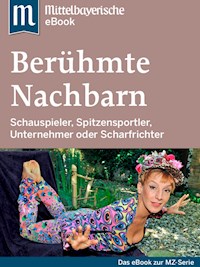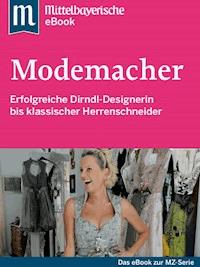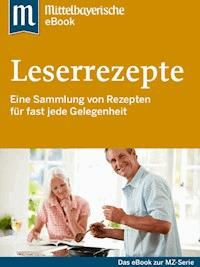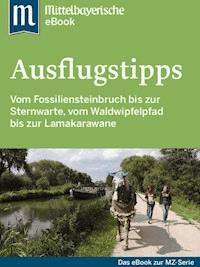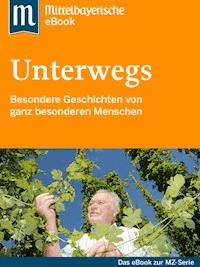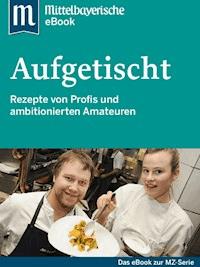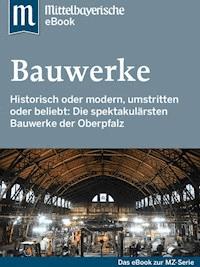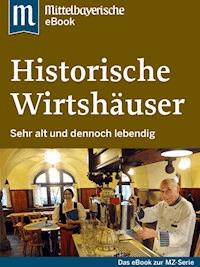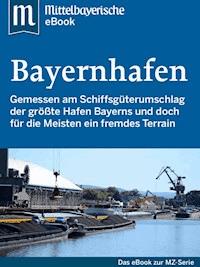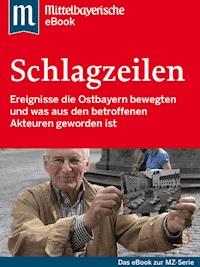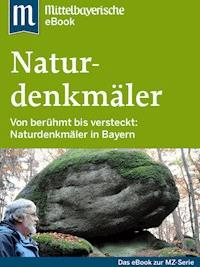
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Von berühmt bis versteckt: Spannende Geschichten über Naturdenkmäler in Bayern von der Karstquelle über den Herzogspark bis zum Beschützer von Weidlwang….
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 63
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Der Bilderbuch-Baum baut ab
Ein gärtnerisches Kleinod
Sprudelnder Quell der Erleuchtung
Der Bistumspatron und seine Eiche
Der Beschützer von Weidlwang
Mythisches Ungetüm in Baumgestalt
Eine löwenstarke Leistung
Die Lindenwirtin und die alte Dame
Mondlandung tief unter der Erde
Das Zuhause der Steinzeit-Familie
Das Stonehenge der Oberpfalz
Eiserner Wächter des Eisernen Huts
Die vielen Sommer der Tanzeiche
Der Kalte Baum und das kalte Herz
Impressum
Der Bilderbuch-Baum baut ab
Die Bavaria-Buche in Pondorf bei Altmannstein machte als Titelcover Karriere. Zöglinge des Jahrtausendbaums wachsen sogar vor Schloss Bellevue.
Johann Bauch hat eine ganz besondere Beziehung zur Bavaria-Buche entwickelt. Foto: Gabi Schönberger
Von Tanja Rexhepaj, MZ
Pondorf. Fast waagrecht wirbeln die Schneeflocken über die Felder. Wie ein Raunen hört sich der Sturm an, wenn er die kahlen Zweige der Buche zur Seite biegt. Es hat den Anschein, als möchte sie sich in die Mulde unterhalb des Dorfes Pondorf in der Gemeinde Altmannstein hinein ducken, um Schutz zu suchen. Denn schon einmal – im August 2006 war das – wurde ihr der Wind zum Verhängnis: Damals brach der rechte Teil des Stammes und mit ihm annähernd die halbe Krone der Bavaria-Buche, einem der bekanntesten Bäume Deutschlands, ab. Dahin war das Bild von der halbkugelförmigen Rotbuche, das millionenfach auf Kalendern, in Schulbüchern und auf Sammeltellern abgedruckt wurde und das unzählige Male über die Fernsehbildschirme flimmerte. Dahin war die stolze Krone, die zuvor eine Fläche von 750 Quadratmetern überdeckt hatte. Dahin war der Bilderbuch-Baum.
Doch sein Mythos lebt weiter: Dank des Projekts „Kinder der Bavaria-Buche“, das Umweltpädagoge Johann Bauch vom Informationszentrum Naturpark Altmühltal betreut hat, wachsen inzwischen an die 700Zöglinge des Baumpatriarchen heran. Vor dem Schloss Bellevue und der Bayerischen Staatskanzlei genauso wie vor der Grundschule Sandersdorf. „Die Bäumchen stehen in ganz Deutschland und sogar in Österreich, Skandinavien oder Spanien“, berichtet Johann Bauch. Gegen eine Spende wurden die aus den Bucheckern der Bavaria-Buche gezogenen Jungbäume an Vereine, Schulen, aber auch an Privatleute vergeben. Das gespendete Geld investiert der Landkreis Eichstätt in Umwelt- und Naturschutzprojekte. Nicht etwa in den Erhalt oder die Sanierung der Bavaria-Buche: Schon vor Jahren wurde entschieden, dass der Baum in Würde sterben soll.
Naturparadies aus Totholz
„Man sollte so einen Baum durch Stahlseile und Metallgestänge nicht zu einer Karikatur seiner selbst degradieren“, sagt Johann Bauch. „Das wäre dann vielleicht Kunst am Baum, aber eben nicht ökologisch.“ Die 800 Jahre, die die Bavaria-Buche vermutlich auf dem Buckel hat, seien vergleichbar mit einem Menschenalter von 102 oder 103 Jahren, sagt der Umweltpädagoge. „Und wie der menschliche Tod wird auch der Tod unseres Baumes tabuisiert.“
Viele wollen es nämlich immer noch nicht wahrhaben, dass auch bei der Bavaria-Buche, diesem Nationalmythos von einem Baum, die Natur ihren Lauf nimmt. Schon seit Jahrzehnten frisst sich der Brandkrustenpilz durch das mittlerweile morsche Holz. Ganze Horden von Touristen hatten den Baum regelmäßig belagert, waren mit ihren Autos sogar bis an den Stamm herangefahren, haben sich in Schnitzereien in seiner Rinde verewigt und so dem Eindringen des Pilzes Vorschub geleistet. Auch der Beton, mit dem man zunächst einige Hohlräume aufgefüllt hatte, hat den Pilzbefall begünstigt. So ist aus dem Baumgiganten ein „Naturparadies aus Totholz“ geworden, wie Johann Bauch es nennt. Vögel haben Berberitzen und Weißdorn um den Baumstamm angesät, „das alles ist Lebensraum für hunderte von Käferarten, für Asseln und Springschwänze“, sagt er.
Auf ihrem „Privatgrundstück“ hat die Bavaria-Buche eine exponierte Stellung. Ohnehin steht sie allein auf weiter Flur – ganz untypisch für Buchen, die sich eigentlich in Wäldern ansiedeln. Johann Bauch nimmt an, dass auch die Bavaria-Buche einmal Teil eines Buchen-Wäldchens gewesen sein muss, bevor sich der Mensch durch Rodung Ackerland geschaffen hat. „Dieser Baum blieb eben übrig, man nutzte ihn wahrscheinlich als Schattenspender für Tiere auf der Weide oder auch für die Menschen, die auf dem Feld arbeiteten.“ Für die ortsansässige Bevölkerung hat der Riesen-Baum also immer schon eine Bedeutung gehabt. Dass er deutschlandweit bekannt wurde, hat er einem bereits verstorbenen Pondorfer zu verdanken: Franz Fersch hatte es sich zu seinen Lebzeiten zur Aufgabe gemacht, die Geschichten seiner Heimat für die Nachwelt festzuhalten.
Traumbaum aller Deutschen
Auch die Geschichte der Bavaria-Buche wollte er irgendwie festhalten. So kam er auf die Idee mit dem Fernsehen. Der BR brachte 1980 einen TV-Bericht über die Bavaria-Buche – und damit kam der Stein ins Rollen: Der Baum wurde zum Titelcover von „Geo“ und zierte die LP „Die Deutsche Super-Hitparade“. Denn schnell wurde die Buche zum Traumbaum aller Deutschen, das Deutsche Baumarchiv in Gießen nahm sie auf in die Liste der „national bedeutsamen Bäume“. „Die ebenmäßige, auffallend runde Krone steht geradezu ikonografisch für den ,Baum‘ schlechthin“, heißt es in einem der vielen Gutachten zur Bavaria-Buche. Der Pondorfer Schattenbaum war zur Baum-Ikone geworden.
Heute ist der einstige Gigant nur noch ein Schatten seiner selbst. Zwar kann man sich noch vorstellen, wie sie einmal ausgesehen haben muss in ihrer ganzen Pracht, diese Buche der Bayern, von der niemand mehr weiß, wie sie eigentlich zu dem Namen „Bavaria-Buche“ gekommen ist.
Naturdenkmal seit dem Jahr 1980
Gattung: Rotbuche (wissenschaftlicher Name: Fagus sylvatica)
Alter: ca. 800 Jahre alt
Höhe: ca. 22 Meter
Stammumfang: 9 Meter (gemessen in 1 Meter Höhe)
Durchmesser der Krone: einst 30 Meter, jetzt ungefähr die Hälfte
Baum der Superlative: Alle Blätter der Bavaria-Buche zusammen ergäben eine über 8500 Quadratmeter große Fläche.
An Sommertagen verdunstet ein Baum dieser Größe bis zu 500 Liter Wasser und nimmt sechs Kilogramm Kohlendioxid auf.
Ein gärtnerisches Kleinod
Der Herzogspark ist eine wahre Raritätensammlung: Winfried Schoppelrey kennt die Anlage mit einer schier unüberschaubaren Artenvielfalt aus dem Effeff.
Im Naturdenkmal Herzogspark wachsen viele besondere Bäume. Fotos: Lex
Von Tanja Rexhepaj, MZ
Regensburg. Bleistifte der ehemaligen Bleistiftfabrik Rehbach in Regensburg dürften heute eine Rarität sein – existierte doch die Fabrik am Ägidienplatz nur bis 1934. Winfried Schoppelrey hat sie aber noch, die Rehbach-Bleistifte: Seine Mutter stand einst bei Rehbach in Lohn und Brot. Deshalb ist die im Herzogspark stehende Statue „Julchen“, eine Bronzeskulptur der bereits im Alter von 18 Jahren verstorbenen Tochter des Bleistiftfabrikanten, für den ehemaligen Mitarbeiter des Stadtgartenamts etwas Besonderes.
Ohnehin hat der 62-Jährige einen Hang zum Besonderen, zu Raritäten sowieso, umso mehr, wenn es sich um botanische Raritäten, vor allem um außergewöhnliche Baumexemplare, handelt. Von beidem hat der Herzogspark eine ganze Menge zu bieten. „Der Herzogspark ist sozusagen eine Raritätensammlung“, sagt Winfried Schoppelrey über die Grünanlage, die er in seiner fast 40-jährigen Dienstzeit für das Stadtgartenamt hunderte Male durchstreift hat.
Hier wohnte die Fürstenschwester
Ein Naturdenkmal im Naturdenkmal Herzogspark hat es Winfried Schoppelrey angetan: An der Nordostseite des Parks zur Donau hin steht eine mächtige Platane. „Wenn es nicht so kalt wäre, könnte man eine Viertelstunde hier stehen und schauen“, sagt Winfried Schoppelrey. „Der Baum ist ein Gedicht, da geht einem doch richtig das Herz auf.“ Seit mehr als 200 Jahren wächst der Baum schon hier und hat bei einem Stammumfang von etwa sechs Metern eine stattliche Höhe von 33 Metern erreicht. Genauso alt wie die Platane sind auch die Ursprünge des Herzogsparks: Im Jahr 1804 nämlich kaufte der Thurn- und Taxissche Geheimrat Friedrich von Müller (nach ihm wurde auch das Von-Müller-Gymnasium benannt) das Gelände und schuf sich hier sein eigenes Gartenparadies. Da er keine Kinder hatte, ging sein Privat-Park samt klassizistischem Palais in den Besitz des Hauses Thurn und Taxis über. In dem Palais, in dem heute das Naturkundemuseum untergebracht ist, residierte fortan die Schwester des damaligen Fürsten, Marie Sophie Herzogin von Württemberg – so kam der Park zu seinem heutigen Namen. Die Stadt erwarb die Anlage 1935 und machte in den 1950-er Jahren den Park für die Öffentlichkeit zugänglich.