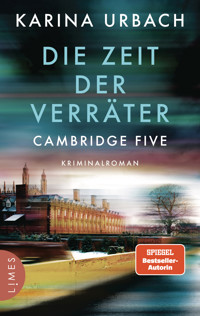15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: wbg Paperback
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: wbg Paperback
- Sprache: Deutsch
Das Dritte Reich und Hitlers Aufstieg zur Macht: Die unrühmliche Rolle deutscher Aristokraten Die Hohenzollern-Debatte hat das Bewusstsein der Öffentlichkeit geschärft: Wie stark war der deutsche Adel tatsächlich in das nationalsozialistische Regime verstrickt? Wer begrüßte die politischen Ziele des Führers nicht nur, sondern unterstützte sie sogar aktiv? Und wo stärkten die eigenen internationalen Beziehungen Hitlers Außenpolitik den Rücken? Vom Haus Windsor bis ins spanische Marbella reichte der lange Arm des deutschen Hochadels. Die renommierte Geschichtswissenschaftlerin Karina Urbach beleuchtet wichtige Triebfedern wie die verbindende Angst der Aristokrat:innen vor dem Bolschewismus. Mit klarem Blick deckt sie bislang unbeachtete Aktivitäten deutscher Adliger im Dienste Hitlers auf, von der Weimarer Republik bis zum Kriegsende. - Der deutsche Hochadel: Diplomatische Geheim-Missionen im Ersten und Zweiten Weltkrieg - Von Carl Eduard von Sachsen bis Stephanie von Hohenlohe: Wie Hitlers Helfer die NS-Außenpolitik prägten - Brillante Analysen: Ein historisches Sachbuch auf dem aktuellen Stand der Forschung - Hitler und der Adel: Wo neue Quellen brisante Verbindungen aufdecken - Spannend wie ein Spionage-Roman: Von der Historikerin und preisgekrönten Autorin Karina Urbach Adelsforschung in den Untiefen der Geheimdiplomatie: Eine Neubewertung historischer Fakten Welchen Einfluss nahm ein Carl Eduard von Sachsen Coburg und Gotha tatsächlich auf die britische Appeasement-Politik? Und an welchen diplomatischen Stellschrauben drehten Adelige aus der zweiten Reihe wie Prinz Max von Baden oder Wilhelm von Hohenzollern? Karina Urbach gewinnt neue Erkenntnisse aus bislang unveröffentlichten Quellen und zeigt auf, wie intensiv die Aristokratie den Aufstieg rechtsextremer Kräfte förderte. Ein Sachbuch, das von der ersten bis zur letzten Seite überrascht und fesselt: "Hitlers heimliche Helfer" skizziert den lange unterschätzten Einfluss des deutschen Adels auf die NS-Außenpolitik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 769
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die englischsprachige Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel „Go-Betweens for Hitler“bei Oxford University Press© Karina Urbach 2015
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar. Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
wbg Paperback ist ein Imprint der wbg.
© der deutschen Ausgabe 2023 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt
3. aktualisierte und um ein neues Vorwort erweiterte Auflage (1. Aufl. 2016)
Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht.
Übersetzung: Cornelius Hartz
Fachliche Bearbeitung: Priv.-Doz. Dr. Karina Urbach
Korrektorat: Dr. Tamara Al Oudat
Satz: Melanie Jungels, TYPOREICH – Layout- und Satzwerkstatt, Nierstein
Einbandgestaltung: Andreas Heilmann, Hamburg
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-534-27535-9
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:
eBook (PDF): 978-3-534-74740-5
eBook (epub): 978-3-534-74741-2
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen über die Autorin
Impressum
Inhalt
Vorwort
Einführung
TEIL I HEIMLICHE HELFER IN DER ÄRA VOR HITLER
KAPITEL 1Go-Betweens oder was sind heimliche Helfer?
KAPITEL 2 Geheimdiplomatie im Ersten Weltkrieg
KAPITEL 3 Bolschewismus: die Angst, die verbindet
TEIL II HITLERS HEIMLICHE HELFER
KAPITEL 4 Charmeoffensive für England: der Herzog von Coburg
KAPITEL 5 Im Auftrag von Horthy, Hitler und Lord Rothermere: Prinzessin Stephanie Hohenlohe
KAPITEL 6 Von München nach Marbella: Prinz Max Egon zu Hohenlohe-Langenburg
Das Nachleben der heimlichen Helfer
Dank
ANHANG
Abkürzungen
Anmerkungen
Archive und Bibliographie
Register
Abbildungsnachweis
Vorwort
Der britische Abgeordnete Sir Henry ‚Chips‘ Channon (1897–1958) war kein bedeutender Politiker. Niemand würde sich heute noch an ihn erinnern, wenn 2021 nicht eine unzensierte Fassung seiner Tagebücher erschienen wäre. Sie geben einen ungefilterten Blick auf die britische und europäische Aristokratie der Zwischenkriegszeit.1 Es ist der Blick in einen Abgrund.
Channons engste Freunde waren britische Beschwichtigungspolitiker und europäische Adelige, die unter Bolschewismusängsten litten und sich für die Hofierung Mussolinis und Hitlers entschieden.2 Einige von ihnen beschlossen darüber hinaus – hinter den Kulissen –, für Hitler zu arbeiten.
Als Channon 1936 zu den Olympischen Spielen reiste, lernte er Göring kennen („ein liebenswerter Mann“)3 und erfuhr, dass ausgerechnet „der dröge Philipp von Hessen … den unsichtbaren Mittler zwischen Mussolini und Hitler spielt … die faschistische Kette, die uns vor dem Bolschewismus bewahrt“.4 Channon traf auch die Kaisertochter Victoria Luise, verheiratete Prinzessin von Hannover, die für Ribbentrop in Großbritannien Beziehungen knüpfte,5 und den dort ebenfalls aktiven „inbrünstigen Nazi“ Carl Eduard, Herzog von Coburg.6
Nach der Bekanntschaft mit diesen illustren ‚Regime-Helfern‘ konnte auch Channon einen der einflussreichsten Männer der konservativen Partei für NS-Deutschland interessieren – Lord Halifax: 1937 besuchte Halifax Göring und den „Führer“. Nach dem Krieg kolportierte Halifax, er habe Hitler damals für den Hausdiener gehalten, aber Channon notierte, was Halifax ihm tatsächlich erzählte:
„Er sagte, er mochte alle ranghohen Nazis, sogar Goebbels!, den sonst niemand mag. Er war sehr beeindruckt, interessiert und amüsiert von dem Besuch. Er findet das Regime fantastisch, vielleicht zu fantastisch, um es ernst zu nehmen. Aber er ist sehr froh, hingefahren zu sein, und glaubt, dass daraus Gutes entstehen wird.“7
Kurz darauf machte Premierminister Chamberlain Halifax zu seinem neuen Außenminister. Ein großer Sieg für Beschwichtigungspolitiker wie Channon und seinen deutschen Freundeskreis.
Als das vorliegende Buch 2016 erstmals in deutscher Übersetzung erschien, galt Adelsforschung noch als Nischenthema. Zwar hatte Stephan Malinowski bereits eine preisgekrönte Studie über den deutschen Adel vorgelegt,8 aber außerhalb der Fachkreise wurde das Thema kaum wahrgenommen. Auch die internationalen Kontakte des Hochadels, die im Mittelpunkt dieses Buches stehen, galten damals als völlig irrelevant. Erst mit der Hohenzollerndebatte veränderte sich über Nacht alles. Die Frage, welche Rolle einzelne Adelshäuser beim Aufstieg Hitlers – auf nationaler und internationaler Ebene – tatsächlich gespielt hatten, wurde plötzlich relevant, denn es ging um sehr viel Geld. 2019 wurden die jahrelangen Geheimverhandlungen der Hohenzollern mit der öffentlichen Hand durch einen SPIEGEL-Artikel bekannt.9 Bis dahin hatten nur wenige von dem Ausgleichsleistungsgesetz gehört, das nach der Wiedervereinigung verabschiedet worden war und Entschädigungsleistungen in Fällen ausschloss, in denen der Berechtigte oder seine Erben „dem nationalsozialistischen Regime erheblichen Vorschub geleistet“ hatten. Der Hohenzollernerbe Georg Friedrich Prinz von Preußen war überzeugt, dass sein Urgroßvater Kronprinz Wilhelm diesen Vorschub nicht geleistet hatte und stellte Forderungen in Millionenhöhe. Darüber hinaus engagierte er Gutachter und finanzierte dem Historiker Lothar Machtan eine Buchveröffentlichung, um seinen Standpunkt zu belegen.10
Am Ende erwies sich jedoch die Beweislast gegen den Kronprinzen Wilhelm als zu groß.11 Im März 2023 zog der Prinz von Preußen seine Forderungen zurück. Sein jahrelanger Kampf gegen Historiker und Journalisten hatte zumindest einen positiven Effekt: Die Adelsforschung blühte auf, neue Quellen wurden gefunden, und die Öffentlichkeit erfuhr en passant, dass seit der Wiedervereinigung mehrere Adelshäuser – unter anderem Hannover, Coburg, Bismarck – erfolgreich Ausgleichszahlungen erhalten hatten. Aber hatten sie wirklich keinen Vorschub geleistet? Dieses Buch kommt zu einer anderen Bewertung.
Einführung
Es ist ein schönes Sommermotiv: Zwei kleine Mädchen spielen im Garten, ihre Mutter und ihr Onkel betrachten sie wohlwollend. Der Vater filmt die Idylle. Nach einer Weile reckt die Mutter den Arm zum Hitlergruß und der Onkel animiert die Kinder, das Gleiche zu tun. Kurz darauf reißt auch er den Arm in die Höhe.
Die Filmsequenz, aufgenommen im Jahr 1933 oder ‘34, dauert nur wenige Sekunden, doch sie sorgte weltweit für Aufregung. Der Grund dafür war, dass es sich hier nicht um deutsche Nazis in der Sommerfrische handelte, sondern um die prominenteste Familie Großbritanniens: Der gutaussehende Onkel war der damalige Prince of Wales, später König Eduard VIII. und nach seiner Abdankung Herzog von Windsor. Die patent-fröhliche Mutter wurde 1937 an der Seite des Kameramannes, Georg VI., zur Queen Elizabeth gekrönt. Die spielenden Kinder waren ihre Töchter – Prinzessin Margaret und die spätere Queen Elizabeth II.
Bis heute wissen Historiker wenig Konkretes über die politische Einstellung der Royal Family in den 1930er Jahren. Stattdessen kursieren unzählige Gerüchte und Verschwörungstheorien, die vor allem den Herzog von Windsor betreffen. Wie nah hatte er den Nationalsozialisten gestanden? Hatte er tatsächlich Geheimnisverrat begangen und darauf gehofft, Hitler würde ihn wieder als König einsetzen? Und wie verhielt es sich mit seinem Nachfolger, dem schüchternen Georg VI., und seiner energischen Frau, Queen Elizabeth? Bis heute genießt dieses Paar hohes Ansehen in Großbritannien. Bilder, in denen es 1941 Londoner Trümmerberge besichtigt, werden in Fernsehdokumentationen genauso häufig wiederholt wie die Aufnahmen der jungen Elizabeth als Automechanikerin im Frauenhilfskorps. Diese patriotischen Kriegsdienste sind gut dokumentiert, doch die Frage bleibt – welche politische Rolle spielte die Royal Family vor Ausbruch des Krieges?
Diese Frage zu beantworten, ist vor allem deshalb für Historiker so schwierig, da die Royal Archives, das private Hausarchiv der Windsors, die Nachlässe des Herzogs von Windsor, Georgs VI., und seiner Frau Elizabeth nur selektiv freigeben. Die vollständigen Papiere sind nur den offiziellen Biographen zugänglich. Bei diesen Biographen handelt es sich jedoch nicht um Wissenschaftler, und ihre Bücher sind durchgehend unkritisch. Da niemand anderer das Archivmaterial einsehen darf, sind ihre Belege (und möglichen Auslassungen) nicht nachprüfbar.
Als die britische Boulevardzeitung THE SUN im Juli 2015 zu mir kam, um die Hitlergruß-Filmsequenz in einen historischen Kontext zu setzen, konnte ich anfangs nicht glauben, dass der Film auf legalem Weg den streng bewachten Archivturm von Windsor Castle verlassen hatte. Doch Archivare machen Fehler und von diesen Fehlern leben Historiker. Gelegentlich werden Dokumente aus Versehen freigegeben, ohne vorher noch einmal „gesäubert“ worden zu sein. Genau das war in diesem Fall geschehen. Man hatte Filmmaterial für eine Dokumentation über die Kindheit Elizabeths II. freigegeben und vergessen, es genau durchzusehen. Da es sich dabei um endlos lange Filmrollen handelte, ist das menschlich äußerst verständlich. Nur ein sehr aufmerksamer Cutter muss im Schneideraum genauer hingesehen haben. Er (oder sie) sorgte dafür, dass die Filmsequenz an die Presse gelangte.
Der Hof wurde zwei Tage vor der Veröffentlichung informiert. Doch anstatt die Zeit zu nutzen, um den Inhalt des Films zu kommentieren, ließ man verlauten, wie „enttäuscht“ man von dem Verhalten der Presse sei. In den darauffolgenden Tagen verteidigte eine Phalanx von hofnahen Journalisten die Aufnahmen. Ihre Argumente variierten. Einige vertraten die Ansicht, es handele sich hier nur um ein freundliches Winken, andere meinten, es wäre einfach eine Witzgeste gewesen, genau wie in Charlie Chaplins Der große Diktator (ein Film, der erst 1940 in die Kinos kam).
Tatsächlich kannten jedoch Eduard VIII., Georg VI. und seine Frau den faschistischen Gruß bereits von ihren Reisen in Mussolinis Italien. Es war ihnen daher durchaus bewusst, dass es sich dabei um eine politische Geste handelte.
Ein anderes Argument der Verteidigung lautete, dass die königliche Familie damals noch nicht über deutsche Politik informiert gewesen sei. Die Times berichtete jedoch schon im Juli 1933 von Ausschreitungen gegen Juden, und das britische Auswärtige Amt (das Foreign Office) informierte die Mitglieder der königlichen Familie regelmäßig über die Vorgänge in Deutschland. Eine noch wichtigere Informationsquelle waren jedoch die persönlichen Kontakte der Royals zu ihren deutschen Verwandten. Viele von ihnen hatten sich schon früh den Nationalsozialisten angeschlossen. Wie stark dieser Einfluss war und zu welchen Auswüchsen er besonders im Fall des Herzogs von Windsor führte, wird in Kapitel 4 behandelt werden.
Im Mittelpunkt dieses Buches stehen jedoch nicht die britischen Royals, sondern vor allem Hochadelige aus der zweiten Reihe. Es wird gezeigt werden, wie sie mit Hilfe ihrer internationalen Freundschafts- und Verwandtschaftsnetzwerke dem NS-Regime dienten.
Wie brisant diese Dienste eingeschätzt wurden, kann an einem bizarren Zwischenfall illustriert werden, der sich am deutsch-italienischen Grenzübergang Brenner abspielte: Im Juli 1940 wurde der 83-jährigen Herzogin in Bayern eine Wiedereinreise in das Deutsche Reich verweigert. Die alte Dame musste in Italien ausharren und versuchte über Monate hinweg vergebens, in ihre Heimat Bayern zu gelangen. Neben adeligen Freunden und Verwandten war ihre wichtigste Anlaufstelle die Deutsche Botschaft in Rom. Botschafter Hans Georg von Mackensen erklärte am 27. Juli 1940 dem Auswärtigen Amt in Berlin die Hintergründe des Falles. Die Herzogin sei nur aus dem Grund nach Italien gereist, um ihrer Enkelin, der italienischen Kronprinzessin, bei der Entbindung beizustehen.1 Die Mutter der Kronprinzessin habe nicht anwesend sein können, da sie als belgische Königinwitwe „aus begreiflichen Gründen auf die Reise […] verzichtet (habe).“2 Diese familienfreundliche Erklärung schien in Berlin wenig zu bewirken. Der Besuch der alten Dame drohte zu einem italienisch-deutschen Politikum zu werden. Erst als der ‚verdiente‘ Nationalsozialist Prinz Philipp von Hessen in die Verhandlungen eingriff, gerieten die Dinge langsam in Bewegung. Hessen, der mit der Tochter des italienischen Königs verheiratet war, argumentierte pragmatisch. Solange die Herzogin in Italien „festsitze“, müsse das italienische Königshaus für ihren kostspieligen Aufenthalt aufkommen. Eine solche finanzielle Belastung würde jedoch mittlerweile als Zumutung empfunden, man solle die Herzogin also schnellstens „heimholen“. Diese pekuniäre Argumentation wurde verstanden – im Oktober 1940 durfte die Herzogin nach Bayern zurückkehren.
Doch die Grenzschikanen gingen weiter und die deutsche Botschaft in Rom musste nun immer häufiger Leumunde ausstellen: Die Frau des Fürsten von der Leyen – so der deutsche Botschafter in Rom – sei zum Beispiel absolut zuverlässig. Sie käme aus der besonders deutschfreundlichen und angesehenen italienischen Familie Ruffo und würde mit dem Fürsten von der Leyen in Rom leben. Ihr gemeinsamer Sohn besuche eine Schule in Bayern. Leider sei ihm nach den Osterferien 1942 plötzlich die Einreise in das Reichsgebiet verweigert worden. Eine Wiedereinreise wäre jedoch dringend wünschenswert.3
Warum also durften eine alte Dame und ein harmloser Schuljunge nicht mehr in das Deutsche Reich einreisen? Wovor hatten die Nationalsozialisten Angst?
Dieses Buch wird zeigen, dass die NS-Führung Hochadelige und ihre Auslandskontakte fürchtete, weil sie diese Kontakte selbst jahrelang erfolgreich benutzt hatte. Hochadelige hatten als heimliche Helfer für die Nationalsozialisten gearbeitet und ihnen nützliche Beziehungen zu Führungseliten anderer Länder verschafft. Seit 1940 fürchtete die NS-Führung, diese Kontakte könnten nun gegen sie verwendet werden.
Bisher hat die Forschung sich vor allem auf adelige Unterstützung der Nationalsozialisten innerhalb Deutschlands beschränkt. Was jedoch vernachlässigt wurde, ist, dass es auch eine internationale Dimension gab. Für diese internationale Aufgabe war der Hochadel ideal. Seine Eheverbindungen und Freundschaften reichten über Ländergrenzen hinweg. Diese internationalen Verbindungen wurden im Ersten Weltkrieg auf eine harte Probe gestellt, als man Königshäuser und Hochadelige als „Hybride“ kritisierte und sie gezwungen waren, ihre nationale Zugehörigkeit zu demonstrieren. Doch hinter den Kulissen unterhielten viele Hochadelige auch weiterhin ihre internationalen Netzwerke aufrecht. Als heimliche Helfer unternahmen sie, wie in Kapitel 2 gezeigt werden wird, für Herrscherhäuser und Regierungen mehrere „Friedensfühler“. Im Jahr 1918 fand diese Betätigung ein abruptes Ende – jedoch nicht für lange, denn in der Zwischenkriegszeit war ein neuer Feind auf den Plan getreten: der Bolschewismus. Die Furcht vor den Bolschewisten verstärkte das Zusammengehörigkeitsgefühl noch einmal: Die Briten hatten Angst vor einer Unterwanderung ihres Empire, die Ungarn wollten verhindern, dass sich eine kommunistische Schreckensherrschaft wie die von Béla Kun (1918) wiederholte, und die Deutschen fürchteten das Anwachsen der kommunistischen Partei.
Ermutigt vom Vorbild Italien, wo Mussolini die Monarchie 1922 erfolgreich in sein Regime integrierte, wandte der Hochadel sich einer deutschen Version des Duce zu: Hitler. Der ‚Führer‘ wusste diese Chance zu nutzen. Im Jahr 1933 verfügte Hitler nur über wenige internationale Kontakte und hatte kein Vertrauen in das Auswärtige Amt. Daher schickte er Mitglieder der deutschen Adelshäuser auf geheime Missionen nach Großbritannien, Italien, Ungarn und Schweden. Einer seiner berüchtigtsten Gesandten war Carl Eduard Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha, ein Enkel von Queen Victoria. Der in England geborene und in Deutschland aufgewachsene Carl Eduard ist ein Musterbeispiel für eine verheerende Umerziehung – weg von der konstitutionellen Monarchie, in der er aufgewachsen war, und hin zur Diktatur. Dieser Vorgang wäre kaum mehr als eine Fußnote der Geschichte geblieben, hätte Carl Eduard sich nicht mit großer Entschlossenheit – zunächst heimlich, später öffentlich – für die nationalsozialistische Bewegung eingesetzt. Die Auswirkungen seiner Bemühungen hat man (wie auch die Arbeit anderer heimlicher Helfer) bislang nicht erkannt. Wie wir in Kapitel 4 sehen werden, wurde Coburg der wichtigste Verbindungsmann Hitlers zu Eduard VIII. und Georg VI.
Der britische Geheimdienst ahnte schon zu Kriegsende, wie wichtig Coburg für Hitler war. Im April 1945 entschlüsselte man in Bletchley Park, der britischen Code- und Chiffrenschule, einen streng geheimen Funkspruch: „Der Führer legt großen Wert darauf, dass der Präsident des Roten Kreuzes [Coburg] auf keinen Fall in die Hände des Feinds fallen darf.“4
Hitler saß damals bereits im Bunker fest. Da er nicht gerade für seine Fürsorglichkeit bekannt war, verwundert es, dass er sich die Mühe machte, Anweisungen bezüglich eines obskuren Herzogs zu geben. Seine Botschaft konnte daher zweierlei bedeuten: Entweder wollte Hitler, dass man den Herzog von Coburg in Sicherheit brachte, oder die Anordnung gehörte zu Hitlers „Nerobefehlen“, d. h., sie bedeutete die Anweisung, den Herzog zu ermorden. Die Geheimnisse, die Hitler und der Herzog miteinander teilten, waren offensichtlich so brisant, dass sie auf keinen Fall an die Öffentlichkeit gelangen durften.
Ziel dieses Buch ist es jedoch nicht nur, Coburgs geheime Verhandlungen im Auftrag Hitlers zu beleuchten, sondern mehrere Missionen von heimlichen Helfer zu untersuchen, sowie den Hintergrund, die Bedeutung und die Folgen dieser Missionen zu erklären. Der Untersuchungsrahmen reicht dabei vom Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg. Im Mittelpunkt stehen neben dem Herzog von Coburg u. a. die heimlichen Helfer Fürst Max Egon II. zu Fürstenberg, Lady Barton, General Paget, Lady Paget, Prinz Max von Baden, Fürst Wilhelm von Hohenzollern-Sigmaringen, Prinzessin Stephanie zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst und Prinz Max zu Hohenlohe-Langenburg.
Ihre Geschichten, die hier zum ersten Mal erzählt werden, erweitern unseren Blick auf die Methoden, mit denen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Geheimdiplomatie betrieben wurde. Und sie zeigen eine Dimension der Außenpolitik Hitlers auf, die bisher nicht erkannt worden ist.
TEIL I
HEIMLICHE HELFERIN DER ÄRA VORHITLER
KAPITEL 1
Go-Betweens oder was sind heimliche Helfer?
In L. P. Hartleys Roman Der Go-Between benutzt ein Liebespaar einen 12-jährigen Jungen als geheimen Briefboten. Die Affäre wird aufgedeckt und endet für alle Beteiligten tragisch.
Im Laufe unseres Lebens sind wir alle auf die eine oder andere Weise einmal Go-Betweens gewesen. Vielleicht haben wir nach einem Streit oder Missverständnis Nachrichten für unsere Eltern oder Freunde überbracht. Doch Go-Betweens existieren nicht nur im privaten Bereich, sie werden – gut versteckt vor der Öffentlichkeit – auch in der Politik eingesetzt. Sie arbeiten an Orten, an denen offizielle Kanäle versagt haben.
Der Begriff „Go-Between“ ist erklärungsbedürftig. Außerhalb der Belletristik spielt er bisher nur in der sozialwissenschaftlichen Netzwerkanalyse eine Rolle: „Wer es schafft, sich innerhalb einer Organisation mit seinen Netzverbindungen als Mittler zwischen ansonsten nicht vernetzten Individuen und Gruppen zu betätigen, kann davon durchaus profitieren.“1 Genau diese Vorteile sind es natürlich, die die Go-Betweens motivieren.
Historiker und Politikwissenschaftler wissen sehr viel über die offizielle Seite der Diplomatie, mit der inoffiziellen Seite beschäftigen sie sich dagegen weniger. Das ist ein Versäumnis, denn es gibt viele Dinge, die Politiker nicht schriftlich niederlegen wollen. Entsprechend lückenhaft ist das Gesamtbild für Historiker. Fernab von den Augen der Öffentlichkeit wollen Politiker häufig Botschaften an ihre Verhandlungspartner schicken, die geheim bleiben sollen und die sich von ihren öffentlichen Äußerungen unterscheiden; im Extremfall sogar das genaue Gegenteil darstellen. Es ist ein Balanceakt, und genau für diesen benötigen Politiker Go-Betweens, die heimlichen Helfer. Doch bis heute gibt es für diese Methode der inoffiziellen Kanäle keine einheitliche Terminologie. In Deutschland nennt man es „Substitutionsdiplomatie“, „persönliche Diplomatie“ oder „Geheimdiplomatie“. Die Briten bezeichnen diese Arbeit als „backroom diplomacy“ oder „unofficial contacts“ und die Amerikaner nennen es „track II“ oder „back channels“.2
Im Folgenden wird für diese Arbeit sowohl der englische Begriff „Go-Between“ als auch die deutsche Übersetzung „heimliche Helfer“ benutzt werden.
Da diese heimlichen Helfer weder eine genau definierte Berufsbezeichnung noch einen offiziellen Status innehaben, könnte man sie leicht als irrelevant abtun. Es ist verständlich, dass sie bislang übersehen wurden. Bei Gipfelgesprächen und wichtigen Vertragsabschlüssen sind Politiker und Diplomaten auf dem Abschlussfoto zu sehen und sie sind es auch, die später die meiste Aufmerksamkeit der Historiker erhalten. Doch wenn man die Blende erweitert, finden sich abseits des Rampenlichts andere Gestalten. Es sind diese Gestalten, die kamerascheuen Männer und Frauen, die im Mittelpunkt dieses Buches stehen werden.
Heimliche Helfer arbeiten in den Vorzimmern der Macht. Sie sind nicht Teil der Regierung oder des Parlaments, d. h. sie haben kein offizielles Amt inne, unterstehen keiner Hierarchie und sind demzufolge keiner Kontrolle ausgesetzt. Sie arbeiten „schwarz“ und alles, was sie sagen, ist „off the record“, d. h. nicht zitierbar und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Rechenschaft müssen sie nur ihrem Auftraggeber ablegen. In der Regel handelt es sich bei diesem Auftraggeber um das Regierungsoberhaupt, das unter Umgehung anderer Mitglieder der Regierung handelt.
Auch wenn es einige Gemeinsamkeiten gibt, sind die heimlichen Helfer keine Lobbyisten oder Mediatoren. Mediatoren müssen unparteiisch sein, heimliche Helfer hingegen werden von einer Person eingesetzt und vertreten daher allein die Interessen dieser Person. Sie sind auch keine Lobbyisten. Lobbyisten arbeiten für eine Gruppe von Leuten und versuchen eine zweckgerichtete Beziehung zu ihrer „Zielperson“ aufzubauen, um ihr Anliegen voranzubringen. Die heimlichen Helfer hingegen kennen ihre „Zielperson“ bereits aus einem ganz anderen Kontext. Beide verbindet eine gemeinsame Geschichte. Ein aktueller Go-Between erklärte dies folgendermaßen: „Ich kannte XY bereits gut. Als ich ihn ansprach, zeigte er sich sofort aufgeschlossen, denn wir kannten einander aus einem anderen Zusammenhang.“
In gewisser Weise sind adelige Go-Betweens ein Rückgriff auf die Ad-hoc-Diplomatie, die erst 1626 mit der Institutionalisierung des diplomatischen Dienstes durch Kardinal Richelieu beendet wurde. Bis dahin waren Botschafter oft Blutsverwandte der Herrscher gewesen (oder diese Verbindung wurde künstlich geschaffen, was zu dem Ausdruck ambassador de sang führte). Mit Richelieu setzte eine Professionalisierung ein und das neue Konzept brachte es mit sich, dass man nicht nur Diplomaten zu besonderen Anlässen aussandte, sondern in anderen Ländern ständige Vertreter unterhielt, die für eine Kontinuität in den diplomatischen Beziehungen sorgten.3
Sind Go-Betweens also nur eine überflüssige Retro-Erscheinung, ein atavistisches Abbild der Zustände vor Richelieu? So wollen es uns zumindest einige glauben machen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz des Jahres 2007 vertrat Vladimir Putin die Ansicht, dass „das System der Internationalen Beziehungen der Mathematik gleicht. Es gibt keine persönlichen Dimensionen.“4
Tatsächlich unterscheiden sich Internationale Beziehungen stark von persönlichen Beziehungen, wie jeder Politiker, der sich über diesem Punkt im Unklaren ist, auf eigene Gefahr herausfinden wird. Nationale oder ideologische Interessen wiegen nach wie vor schwerer als die treueste Partnerschaft. Aber das bedeutet mitnichten, dass persönliche Elemente keine Rolle spielen. Go-Betweens stehen für eben diese persönlichen Elemente und machen sie sich zunutze. Die internationalen Beziehungen sind für sie ganz buchstäblich ihre eigenen persönlichen Beziehungen.
Ihre Arbeit basiert auf der Annahme, dass der Mensch nur in einer idealen Welt ständig rational handelt. Kultureller und sozialer Hintergrund, Gruppenzwang und Emotionen – all das beeinflusst politische Entscheidungsprozesse. Und es sind genau diese Faktoren, die die heimlichen Helfer ansprechen können.
Ausgewählt wurden für solche Missionen bis 1939 europäisch vernetzte Hochadelige (später kamen internationale Geschäftsleute und Journalisten hinzu). Hochadelige waren für diese Aufgabe vor allem deshalb ideal, weil sie mit anderen europäischen Eliten verwandt oder befreundet waren.
Lange Zeit wurde angenommen, dass mit dem Aufstieg des Bürgertums im 19. Jahrhundert die Handlungsspieläume des Adels sukzessive verschwanden. Was man heute als Schicksal für die Globalisierungsverlierer voraussieht, diagnostizierten Literaten im 19. Jahrhundert für den Adel. Er galt als der große Modernisierungsverlierer, und sein Zustand wurde mit zahlreichen Verfallsmotiven umschrieben. Doch eine vormals so mächtige Gruppe hört nicht über Nacht auf, zu existieren. Sie sucht sich neue Nischen – und eine dieser Nischen war die Geheimdiplomatie. Ihr internationales Netzwerk war dafür die ideale Voraussetzung. Es war organisch über mehrere Generationen gewachsen und hatte ihr immer viele Vorteile eingebracht. In der Frühen Neuzeit war es nicht unüblich gewesen, dass Adlige in verschiedenen Lebensstadien unterschiedliche Heimaten hatten. Prinz Karl Heinrich von Nassau-Siegen beispielsweise war als Sohn einer deutsch-niederländischen Familie in Frankreich geboren worden, wurde ein Grande von Spanien, heiratete eine polnische Gräfin und war bis 1794 als Admiral in russischen Diensten.5
Adlige Familien verhielten sich seit Jahrhunderten wie Fondsmanager, die ihre Investitionen gut streuten: Sie verheirateten ihre Kinder in andere Länder oder schickten sie dorthin in den Militärdienst, um dadurch der Familie neue (internationale) Zweige hinzuzufügen. Folglich wurden viele Adelige zu Experten für Länder, die damals eher als „obskur“ galten. Der Bruder des deutschen Fürsten Wilhelm von Hohenzollern-Sigmaringen (1864–1927) beispielsweise war König von Rumänien und Fürst Wilhelm kannte sich dadurch in der rumänischen Gesellschaft bestens aus. Wie wir sehen werden, wurde er aus diesem Grund im Ersten Weltkrieg als heimlicher Helfer eingesetzt. Gleiches galt für den Go-Between Prinz Max zu Hohenlohe zwanzig Jahre später. Hohenlohe arbeitete für die Nazis als Geheimkanal in der Tschechoslowakei. Er sah seine Familie als durch und durch international, schließlich waren aus ihr hervorgegangen: „ein deutscher Kanzler, ein französischer Hofmarschall, ein römischkatholischer Kardinal, diverse österreichisch-ungarische Feldmarschälle, mehrere Generäle von Preußen und Baden sowie Marschälle von Württemberg und ein Generaladjutant des russischen Zaren“.6
Eine derartige Internationalität existierte im Hochadel weitaus häufiger als in jeder anderen gesellschaftlichen Schicht. Während im 18. Jahrhundert die meisten Menschen niemals die Stadt oder das Dorf, in denen sie zur Welt gekommen waren, verließen, hatten die Adligen damals die höchste Mobilitätsrate in ganz Europa. Bevor man den Begriff „Weltbürger“ erfand, gab es bereits den „Weltadeligen“. Vor allem Thomas Mann bewunderte diesen Typus Mensch. Er beschrieb Richard Coudenhove-Kalergi, einen der berühmtesten „Weltadeligen“ der 1920er Jahre, als einen Mann, „gemischt aus dem internationalen Adelsgeblüt Europas […] einen Typus vornehmer Weltmenschlichkeit, der außerordentlich fesselt und vor welcher der Durchschnittsdeutsche sich recht provinzlerisch fühlt. [Ein Mann], der [es] von Natur gewohnt [ist], in Erdteilen zu denken“.7 Viscount Lymington formulierte in seinen Memoiren von 1956 eine ganz ähnliche Beobachtung: „Besonders interessant war und ist, dass es eine Art „freimaurerische Gemeinschaft“ internationaler Adelsfamilien gibt, die Europa selbst heute noch durchdringt.“8
Folglich war es für Adlige einfacher als für alle anderen gesellschaftlichen Gruppen, sich in anderen Ländern zu integrieren.
Adelige verbanden ein „soziales Vertrauen“9 und Traditionen, die das aufstrebende Bürgertum nicht ansatzweise kopieren konnte: ein gemeinsamer gesellschaftlicher Code, der auf einem idealisierten mittelalterlichen Ehrenkodex, auf höfischen Regeln und einer geradezu kultischen Verehrung der Vorfahren basierte. Außerdem verband sie alle die Erinnerung an eine gemeinsame europäische Geschichte. Eckpfeiler dieser Erinnerung waren die großen Bedrohungsszenarien: 1789, 1848, und 1917. Zwar unterschieden sich die Details des adligen Lebensstils von Land zu Land, aber überall in Europa galt die Maxime: Adlige haben Zugang zu anderen Adligen.10 Damit war die ideale Vorraussetzung für Go-Between-Missionen geschaffen.
Ein weiterer Grund, warum sie so mühelos Zugang nicht nur zu anderen Adeligen erhielten, sondern sogar, wie wir sehen werden, zu demokratisch gewählten Politikern, waren ihre Namen:
Die Macht alter Adelsnamen hat Marcel Proust in seinem Romanzyklus Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (À la recherche du temps perdu) am Eindrucksvollsten beschrieben. Er sah den großen gesellschaftlichen Einfluss des Adels nicht so sehr in seinem Reichtum oder seinen Positionen begründet, sondern in der Autorität, die alten Namen zugeschrieben wurde. Mit den Adelsnamen verband man vermeintlich historische Größe, sie erweckten Erinnerungen an versunkenen Glanz. Altehrwürdige adlige Namen hatten ihre eigene Aura und übten auf viele Menschen einen geradezu unwiderstehlichen Charme aus – das galt selbst für Leute wie Hitler. Jemand mit einem Namen wie Hohenzollern oder Coburg, einem Namen, der historische Grandezza evozierte, hatte es bis weit in die 1930er Jahre hinein leichter, sich in den Salons der Mächtigen zu bewegen als jemand ohne einen solch berühmten Familiennamen.
Natürlich stellt sich an diesem Punkt die Frage: Warum überließ man Geheimmissionen nicht den offiziellen Diplomaten? Schließlich entstammten sie ja bis weit in die 1930er Jahre hinein ebenfalls Adelsfamilien. Und tatsächlich sahen manche Diplomaten und Beamte die heimlichen Helfer durchaus als unliebsame Rivalen. Der Staatssekretär im britischen Außenministerium, Lord Hardinge of Penshurst, schrieb 1917 über die heimlichen Helfer:
„Wir besitzen bezüglich [Friedensmissionen] weitreichende Erfahrungen mit inoffiziellen Aktionen, und sie beinhalten meistens ein Element der Gefahr, wie lauter das Motiv auch sein mag.“11
Diplomaten warnten also davor, Missionen zu starten die nicht von Diplomaten durchgeführt wurden. Natürlich fürchteten sie, es könnten hinter ihrem Rücken Zusagen gemacht werden, die niemand einhalten konnte (oder, noch schlimmer, die eingehalten werden mussten).
Aber die Verwendung von Diplomaten hatte ihre Nachteile. Durch sie erhielt jede Mission einen offiziellen Charakter; alle Gespräche wurden aufgezeichnet und am Ende sogar öffentlich gemacht, in Großbritannien in den sogenannten Blaubüchern, in Deutschland in den „Weißbüchern“ der jeweiligen Auswärtigen Ämter. Darüber hinaus mussten bei Gesprächen Formalitäten eingehalten werden, denn zu viel Offenheit konnte als Schwäche ausgelegt werden. Es war auch sehr viel wahrscheinlicher, dass es nach Gesprächen zu Indiskretionen kam, die an die Öffentlichkeit gelangten, denn es waren zu viele Personen an dem Prozess beteiligt. Der österreichische Außenminister von Czernin kam sogar zu dem Schluss, dass jedes politische Geheimnis „Hunderten von Personen bekannt [sei], den Hofräten im Ministerium des Äußern, den Chiffrierern, bei den Botschaftern und Gesandten dem Personal.“12
Ganz anders verhielt es sich dagegen mit den Go-Betweens: Sie führten Vier-Augen-Gespräche und vermieden es tunlichst, irgendwelche Aufzeichnungen oder Protokolle zu hinterlassen. Sie konnten auch kreativer in der Gesprächsführung sein, wenn es darum ging, Probleme zu lösen und Ideen auszutauschen. Außerdem waren sie in der Lage, sich „unsichtbar“ zu machen: Anders als die Diplomaten, deren Kommen und Gehen genau verzeichnet wurde, registrierte die Presse die Ankunft adliger Go-Betweens in einem anderen Land nicht. Und wenn doch, nahm man an, dass ein Adliger lediglich seine Verwandten und Freunde besuchte.
Da die heimlichen Helfer nicht dem Parlament unterstanden, gab es natürlich auch keine Kommission, die für eine Überprüfung ihrer Tätigkeiten zuständig gewesen wäre. Wollte man also, dass ein Gespräch unterhalb des Radars stattfand, wandte man sich an einen heimlichen Helfer.
Ein weiterer Grund, warum ein Regierungschef lieber solche „Außenseiter“ statt der eigenen Mitarbeiter verwendet, konnte natürlich auch sein, dass er seinen eigenen Diplomaten mißtraute. Dies war bei Hitler der Fall, der bis 1938 argwöhnte, dass das Auswärtige Amt noch nicht komplett „nazifiziert“ sei.13 Traditionelle Diplomatie verachtete er. Deshalb bevorzugte er für die Überbringung wichtiger persönlicher Botschaften gut ausgewählte adelige Nazis. Drei von ihnen werden in diesem Buch näher untersucht: der Herzog von Coburg, Prinzessin Stephanie zu Hohenlohe und Prinz Max zu Hohenlohe. Sie sind jedoch lediglich die Spitze eines sehr viel größeren Eisbergs.
Dass jemand Go-Betweens benutzt, weil er seinen eigenen Beamten nicht traut, kam auch in demokratisch regierten Ländern vor. In der Zwischenkriegszeit war die Außenpolitik in vielen Demokratien ein umkämpftes Feld, und Politiker begannen ihre eigenen Geheimkanäle einzurichten, unter Umgehung der Außenministerien. Regierungschefs hielten sich selbst für außenpolitische Experten und nutzten deshalb mehrfach Go-Betweens: Präsident F. D. Roosevelt verwendete Go-Betweens, um Cordell Hull im State Department (dem amerikanischen Auswärtigen Amt) zu umgehen. Nach dem Krieg tat John F. Kennedy während der Kubakrise das Gleiche. Geheimkanäle wurden auch von US-Sicherheitsberater Henry Kissinger und Bundeskanzler Willy Brandt benutzt, die beide ihren eigenen diplomatischen Vertretern nicht genügend Vertrauen entgegenbrachten, aber trotzdem den Schein wahren wollten.14 Und auch die Briten bedienten sich gerne dieser Taktik. Wie wir sehen werden, entschied sich Chamberlain für heimliche Helfer, um seine Appeasement-Politik voranzutreiben. In den britischen Geschichtsbüchern fand er dafür viele Vorbilder. Der Stuart-König Karl II. zum Beispiel hatte im Exil gelernt, wie man die „Hintertreppe“ verwendet, d. h. heimliche Helfer einsetzte, denen er in schwierigen Zeiten vertrauen konnte.15
Natürlich war nicht jeder, der über gute internationale Verbindungen verfügte, auch automatisch ein guter Go-Between. Um seine Missionen erfolgreich ausführen zu können, musste ein heimlicher Helfer einen stabilen Charakter haben und er durfte auch unter starkem Druck nicht die Nerven verlieren (dies war vor allem in Kriegszeiten wichtig). Die Tätigkeit als heimlicher Helfer konnte extrem frustrierend sein – Momente großer Anspannung wechselten sich mit völligem Stillstand ab.
Aus diesem Grund benötigten die heimlichen Helfer eine Menge Geduld und Ausdauer. In einer Studie über Unterhändler bei Friedensgesprächen im 21. Jahrhundert heißt es: „Lediglich Pastoren müssen im Rahmen ihrer Tätigkeit mehr Tee trinken als Friedensvermittler. Beziehungsweise Tee, Kaffee oder Coca-Cola.“16 Bei den heimlichen Helfern in der ersten Jahrhunderthälfte war das – mit Ausnahme von Coca-Cola – nicht sehr viel anders.
Darüber hinaus benötigten sie ein sehr gutes Gedächtnis. Da bei ihren Gesprächen niemand ein Interesse daran hatte, etwas schriftlich niederzulegen, mussten die Go-Betweens versuchen, sich die Argumente aller Beteiligten wortwörtlich einzuprägen. Das hieß natürlich nicht unbedingt, dass sie die Gespräche am Ende auch korrekt wiedergaben. Wie bei allen Unterhaltungen konnten sie den Subtext fehlinterpretieren oder den Tonfall (bedrohlich, konziliant) falsch deuten. Und sie liefen auch Gefahr, Dinge heraushören zu wollen, die gar nicht gesagt wurden. Um ihren Auftraggeber zufriedenzustellen, konnten sie falsche Hoffnungen schüren, die nicht angebracht waren. Eine weitere Gefahr bestand darin, dass sie sich aufgrund der Wichtigkeit ihrer Mission selbst überschätzten und beiden Seiten mehr versprachen, als sie halten konnten. Je besser und länger sie ihr Gegenüber kannten, desto höher war jedoch die Chance, dass sie die Botschaft korrekt verstanden. Ein deutscher Go-Between nannte als Voraussetzung für seinen Job einmal gute „Menschenbeobachtung“. Heute gilt dieser Begriff in der Konfliktlösung als eine der wichtigsten Voraussetzungen: „der historische und kulturelle Hintergrund, der Charakter der beteiligten Menschen.“17
All das sagt einem natürlich bereits der gesunde Menschenverstand. Und genau der ist eine weitere Voraussetzung für einen erfolgreichen Go-Between: Er muss Gefühle einschätzen können und wissen, welche Rolle sie in der Politik spielen, aber gleichzeitig darf er niemals seinen eigenen Gefühlen freien Lauf lassen. Da die „Affektkontrolle“ bei den Adligen eine wichtige Maxime darstellte, waren sie auch für diesen Teil der Aufgabe gut vorbereitet. Außerdem mussten sie eine gewisse Begabung dafür haben, Gelegenheiten rechtzeitig zu erkennen und zu nutzen. Hin und wieder mussten sie kontroverse Themen meiden und zur richtigen Zeit neue Ideen auf den Tisch legen. Viele erfolgreiche Go-Betweens waren gute Schachspieler und in der Lage, strategisch zu denken. Hin und wieder verwendeten sie sogar Begriffe aus der Welt des Schachs – ein Go-Between, argumentierte zum Beispiel, man solle ein Friedensangebot als partie remise verkaufen (d. h. die Partie wäre unentschieden).
Warum jedoch boten sich die Adligen überhaupt freiwillig als heimliche Helfer an? Zuerst einmal sollte man das menschliche Ego niemals unterschätzen. Auch wenn es sich um geheime Missionen handelte, konnten sie doch großes Prestige einbringen. Der Initiator entlohnte seinen heimlichen Helfer, wobei der Lohn nicht finanzieller, sondern in der Regel ideeller Art war. Eine große Ausnahme in diesem Buch ist der Fall der heimlichen Helferin Stephanie Hohenlohe, die dafür sorgte, dass man ihr als Dankeschön stets besonders kostspielige Geschenke zukommen ließ.
Ein weiterer Grund dafür, sich als Go-Between zu betätigen, war die Überzeugung vieler Adliger, sie hätten ein Anrecht darauf, eine Rolle in der Politik zu spielen. Allein die Tatsache dass sie gefragt wurden, gab ihnen ein Stück weit ihre frühere politische Relevanz zurück.
In welchen Situationen kamen nun diese heimlichen Helfer tatsächlich zum Einsatz?
Wie die folgenden Kapitel zeigen werden, gab es einen großen Unterschied zwischen ihrer Tätigkeit in Friedenszeiten und ihrer Tätigkeit im Krieg. In Friedenszeiten wurden Verbindungsleute vor allem dazu eingesetzt, Missverständnisse zwischen Staatsoberhäuptern und Regierungen zu klären. Darüber hinaus etablierten sie geheime Kanäle für künftige Krisensituationen.
In Kriegszeiten konnten die Go-Betweens eine andere Rolle spielen. Wenn mit Kriegsausbruch Konsulate und Botschaften geschlossen wurden und jedes Treffen zwischen Diplomaten von der Presse als mögliche Verhandlungsofferte interpretiert wurde, konnten die Go-Betweens unerkannt ihre „Friedensfühler“ ausstrecken.
Es ist umso erstaunlicher, dass trotz dieser wichtigen Rolle bislang noch keine wissenschaftliche Aufarbeitung dieses Phänomens stattgefunden hat. Ein Grund dafür mag sein, dass Historiker in der Regel aus dem Bürgertum kommen und daher die Adelsverbindungen nicht erkennen. Sie wissen zwar um die internationalen Netzwerke der Aristokratie, aber sie hinterfragen nicht, wozu sie verwendet wurden. Da es im Bürgertum kein entsprechendes Phänomen gibt, hat man kurzerhand auch nicht in anderen Schichten danach gesucht. Stattdessen galt der Adel als eine anämische Gruppe, die weder politisch noch wirtschaftlich irgendwelche Relevanz besaß. Sir David Cannadine zum Beispiel beschreibt, wie der britische Adel nach 1918 mehr oder weniger in die historische Bedeutungslosigkeit entschwand. Er interessierte sich nicht für internationale Beziehungen und ignorierte die beeindruckenden Überlebenstechniken britischer Adliger, die bis heute wirtschaftlich und gesellschaftlich erfolgreich sind. Arno Mayer hingegen erkannte, dass die Adligen weiterhin einen gewissen Einfluss besaßen, und wies darauf hin, dass sie zumindest in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht untersucht werden sollten.18
Ein weiterer Grund, warum es schwer ist, die Rolle adeliger Go-Betweens zu entschlüsseln, liegt am Hochadel selbst. Er macht Archivrecherchen alles andere als einfach. In der Regel zeigt diese Gruppe ein stark stilisiertes Bild von sich, das frei von jeglichem politischen Beigeschmack ist. Bis heute kann man in den Privatarchiven vieler Adelsfamilien kein Material aus dem 20. Jahrhundert einsehen. Die bereits erwähnten Royal Archives in Windsor sind nur ein Beispiel von vielen.
Ein weiteres Problem ist natürlich auch, dass adlige Go-Betweens kaum Spuren hinterließen. Sie schrieben ihre Anweisungen nicht nieder und sie legten auch nicht in Autobiographien „Geständnisse“ ab. Sie blieben diskret und loyal. Da ihre Tätigkeit in offiziellen Dokumenten nicht auftaucht, hat sich für viele Diplomatiehistoriker ein schiefes Bild ergeben. Der Staatssekretär des britischen Außenministeriums, Sir Robert Vansittart, war sich dieses Problem durchaus bewusst: „Für puristische Historiker ist es ziemlich schwierig, über Zeitgeschichte zu schreiben. Sie sollten sich nicht nur auf Dokumente stützen – vor allem nicht auf diplomatische Dokumente. Ich weiß zu viel von dem, was dahintersteckt, zu viel von dem, was dort nicht auftaucht.“19
Er meinte damit den Charakter der beteiligten Personen und die „unwritten assumptions“, die unausgesprochenen Annahmen. Aber er meinte auch die Geheimkanäle. Tatsächlich verwendete Vansittart selbst heimliche Helfer, wie wir in Kapitel 6 sehen werden.
Wie kann man also etwas über solche Geheimkanäle herausfinden, wenn es kaum Quellen gibt?
Es ist alles andere als einfach und die meisten geheimen Missionen werden sicherlich nie bekannt werden. Aber es gibt durchaus Mittel, einige von ihnen auf verschlungenen Umwegen zu rekonstruieren. Wenn Spuren vorhanden sind, dann vor allem in privaten Unterlagen. Hin und wieder werden Missionen auch öffentlich, wenn neue Dokumente freigegeben werden, z. B. Akten der Nachrichtendienste. Auch eine gescheiterte Mission kann für Historiker von unschätzbarem Wert sein. Ein Beispiel hierfür ist die verheerende Sixtusmission, die in Kapitel 2 eine Rolle spielen wird. Als sie 1918 ans Licht kam, beteuerten mehrere Beteiligte öffentlich ihre Unschuld. Gleiches gilt für die heimlichen Helfer, deren Hitler sich bediente: Einige von ihnen wollten ihr Leben nach 1945 umschreiben und gaben auf diesem Weg ihre Arbeit hinter den Kulissen preis.
Obwohl es schwierig ist, diesen Missionen auf den Grund zu gehen, bedeutet dies jedoch nicht, dass man sie ignorieren sollte. Wer sich nur auf offizielle Dokumente stützt, läuft Gefahr, eine wichtige Dimension auszublenden. E. H. Carr hat diese Haltung als „Dokumente-Fetischismus“ bezeichnet. Ein Historiker, der kein Gefühl dafür entwickelt, dass seine Quellen lückenhaft sind, übersieht unter Umständen wichtige Verbindungen. Und am Ende steht er dann da wie der Pulitzer-Preisträger A. Scott Berg, der eine Biographie über Charles Lindbergh verfasste und völlig übersah, dass Lindbergh ein Doppelleben in Deutschland führte, mitsamt einer Zweitfamilie.
Wenn es um politische Doppelleben geht, können uns die heimlichen Helfer eine Welt eröffnen, die uns bislang verschlossen war.
Eine gemeinsame Sprache?
Im Mittelpunkt dieses Buches steht die Frage, über was adelige Go-Betweens redeten. Wir sollten jedoch auch einen kurzen Blick darauf werfen, wie sie redeten. Wie benutzten sie Sprache, um ihren Zielpersonen näher zu kommen? Und in welcher Fremdsprache verständigten sie sich überhaupt? Auf Englisch, Französisch oder Deutsch?
Für Wittgenstein sind „die Grenzen meiner Sprache die Grenzen meiner Welt.“ Eine sprachgeschichtliche Untersuchung des Adels kann uns daher nicht nur seine Kommunikationsfähigkeit erklären, sondern auch einen Einblick in seine Mentalität geben.
Der Adel gilt als ein in Aspik festgehaltenes Gebilde mit einer exklusiven Sprache, die fern von allen Außeneinflüssen existierte. Die „Verhöflichung des Kriegers“ hatte seit dem Mittelalter dazu geführt, dass die galante Rede zum Inbegriff adeliger Identität wurde.20 Im 19. Jahrhundert wurde die (angeblich) gekünstelte Sprechweise der Aristokratie immer mehr zur Zielscheibe der Kritik. Vor allem in Deutschland und Frankreich machte man sich über die „unnatürliche“ Sprache der Adligen und über ihre „weibischen“ Gesten lustig; beides galt als „unaufrichtig“. Noch Mitte der 1950er Jahre kritisierte man in Österreich das „schlechte Deutsch“ des Adels, das „mit ausländischen Wörtern durchsät“ sei.21 Dies war beileibe kein rein österreichisches Phänomen: In Großbritannien demonstrieren die Briefe der Geschwister Mitford eindrücklich die Besonderheiten adliger Sprache im 20. Jahrhundert. Bis heute gelten die Mitford-Schwestern als stark exzentrisch. Die hübscheren von ihnen, Diana und Unity, himmelten Hitler an, während die weniger attraktive Schwester Jessica Stalin verehrte. Es überrascht daher nicht, dass eine weitere Schwester, die politisch gemäßigte Nancy Mitford, ihre Familiengeschichte in mehreren Romanen verarbeitete. Doch abgesehen von ihren radikalen politischen Affinitäten sind die Mitfords bekannt dafür, dass sie untereinander in einer ganz speziellen Sprache kommunizierten. Heute finden Leser ihre Briefe entweder besonders charmant oder schier unerträglich. Aber was auch immer man von ihnen hält: Diese Briefe geben uns einen Einblick in die adelige Sprache.
Wie die Mitfords wuchsen die meisten adligen Mädchen in einem Kokon auf. Sie wurden in der Regel zu Hause unterrichtet, während ihre Brüder fortgingen – erst aufs Internat, später zur Armee oder auf die Universität. Durch diese Form der isolierten Erziehung wurden adlige Frauen automatisch zu Hüterinnen einer exklusiven Sprache.
Der entscheidende Aufsatz über die Sprache der englischen Oberschicht in der Zwischenkriegszeit – der bis heute kein deutsches Äquivalent hat – stammt von Nancy Mitford. Inspiriert wurde sie durch einen Artikel des Sprachwissenschaftlers Alan S. C. Ross über U-Sprache (u stand für upper-class, d. h. Oberschichtssprache) und Non-U-Sprache (non-upper-class). Beispielsweise bezeichnete die Oberschicht eine Toilette als „loo“ und einen Spiegel als „lookingglass“ (während die Mittelschicht dazu „toilet“ und „mirror“ sagte). 1956 veröffentlichten Ross und Mitford gemeinsam mit weiteren prominenten Autoren das Buch Noblesse Oblige. Böse Gedanken einer englischen Lady. Es machte so sehr Furore, dass zahlreiche Angehörige der verunsicherten Mittelschicht quasi über Nacht ihren Wortschatz änderten.
Obwohl Mitford bei ihrer Analyse einen durchaus ironischen Ton anschlägt, kam es nicht von ungefähr, dass eine Frau ihrer Herkunft Ross bei seinen Arbeiten half. Frauen der Oberschicht hielten am längsten an einer überhöhten Sprache fest, doch diese Strategie gefährdete vor allem in Großbritannien seit dem Ersten Weltkrieg immer stärker die gesellschaftliche Harmonie. Gerade der Oberschichtsakzent einer Nancy Mitford, die sich u. a. in einer freiwilligen Feuerwehrbrigade engagierte, wurde von anderen Feuerwehrhelferinnen als beleidigend empfunden – sie drohten sie aus der Feuerwehr zu feuern.22 Tatsächlich jedoch wollte Mitford niemanden verspotten, der Akzent war bei ihr, wie bei vielen Frauen der Oberschicht, so tief verwurzelt, dass selbst Nancys rebellische Schwester Jessica Mitford ihn nie ablegen konnte. Noch als engagierte Kommunistin klang sie wie eine Herzogin.
Die Männer des Adels und der Oberschicht waren von dieser gekünstelten Sprechweise weniger betroffen. Tonaufnahmen ihrer Stimmen aus den 1930er Jahren klingen relativ normal. In Deutschland war es sogar üblich, dass männliche Adlige einen lokalen Dialekt pflegten. Reichskanzler Otto von Bismarck beispielsweise identifizierte sich mit der „einfachen Landbevölkerung“ und unterhielt sich mit ihr gerne in der örtlichen Mundart. Auch von Kaiser Wilhelm II. wissen wir aus zahlreichen Anekdoten, dass er häufig „berlinerte“, was einer der Gründe für seine (überraschende) Beliebtheit war.23 Mit seiner „Volksnähe“ wollte er auch soziale Spannungen abbauen; Sprache diente ihm dazu, den Menschen das Gefühl zu vermitteln, man verfüge über einen gemeinsamen Horizont. So wurde Wilhelm geradezu zum Meister des geflügelten Wortes. Viele seiner Äußerungen waren ebenso unvergesslich wie unverzeihlich – so prägte er den Ausdruck „gelbe Gefahr“ für die Chinesen, riet den Frauen bei „Kinder, Küche, Kirche“ zu bleiben und nannte die Sozialisten „vaterlandslose Gesellen“. Die Tatsache, dass der Kaiser diese markigen Sprüche im Berliner Dialekt von sich gab, gefiel dem Durchschnittsdeutschen (mit Ausnahme vielleicht der Bayern) umso mehr.
Obwohl Hochadelige eine in sich geschlossene Gruppe bildeten, wäre es daher falsch, sie als gesamtgesellschaftliche Autisten zu sehen. Tatsächlich hatten die Männer eine größere Vielfalt an Kommunikationspartnern, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Ihre – gesellschaftlichen und folglich sprachlichen – Verkehrskreise umfassten Angehörige regierender Häuser, Standesgenossen im In- und Ausland, bürgerliche und ländliche Eliten, Dienerschaft und Pächter. Je mehr Außenbeziehungen vorhanden waren, umso mehr sprachlichen Einflüssen war der Adel theoretisch ausgesetzt. Er reagierte daher mit sehr unterschiedlichen „Sprachen“ auf unterschiedliche Gruppen: Mit Regenten korrespondierte der Hochadel aus formeller Distanz heraus. Besonders devot war der Umgang mit Kaiser Wilhelm II., der, trotz aller Volksnähe, von seiner höfischen Umgebung einen außergewöhnlich byzantinischen Stil erwartete. Die Kaiserfreunde Eulenburg und Fürstenberg erreichten hierin Perfektion, aber auch Verwandte des Kaisers mussten sich diesen Anforderungen beugen. Reichskanzler Chlodwig von Hohenlohe-Schillingsfürst wurde vom Kaiser mit „Du“ und „Lieber Oheim“ angeredet. Er wiederum antwortete in Briefen mit der Schlussformel „Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät alleruntertänigster treugehorsamster“. Diese Servilität erklärte er mit den Worten: „Mit Souveränen ist man nicht verwandt.“24
Zwischen den einzelnen Monarchen jedoch existierte Ebenbürtigkeit, selbst wenn der eine Gesprächspartner lediglich über ein kleines Land herrschte und der andere der britische König war. Der Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen zum Beispiel duzte König Georg V. Georg, der in Hessen Deutsch gelernt hatte, revanchierte sich und vertraute Hohenzollern-Sigmaringen Dinge an, die er keinem Dritten gegenüber angesprochen hätte. Beispielsweise teilte er ihm am 24. Mai 1914 mit: „Du wirst sehen: Grey reißt uns geradewegs in eine Katastrophe.“25 Die Tatsache, dass der König Grey, seinem eigenen Außenminister, nicht über den Weg traute, war für Hohenzollern-Sigmaringen eine äußerst nützliche Information, die er sofort an das deutsche Auswärtige Amt weitergab. Derartige Vertraulichkeiten blieben kein Einzelfall.
Vertrautheit existierte auch in der Gruppe, die unmittelbar unterhalb der regierenden Häuser rangierte, dem Hochadel. Im Umgang mit Standesgenossen wurde eine verwandtschaftsähnliche Beziehung voraus- und sprachlich umgesetzt, selbst wenn keine Blutsbande vorhanden waren. Für Frankreich hat die Soziologin Monique de Saint Martin gezeigt, dass es im aristokratisch geprägten Jockey Club bis heute Tradition ist, dass „zwei beim Essen nebeneinander sitzende Mitglieder, die sich nicht kennen, sich nicht einander vorstellen: da sie zur gleichen Welt gehören, sind sie gehalten, so zu tun, als ob sie sich schon immer kennen würden.“26 Eine ähnliche Tradition existiert im bayerischen und im österreichischen Adel, dessen Angehörige einander mit Vornamen anreden, selbst wenn sie nicht miteinander verwandt oder befreundet sind.
Es war gerade diese „sprachliche Nähe“, die sich die heimlichen Helfer für ihre Missionen zunutze machten. Dass sie viele der Personen, mit denen sie Kontakt aufnehmen mussten, von vornherein duzten oder mit Vornamen anredeten, trug auf ganz natürliche Weise dazu bei, dass Unterhaltungen entspannter verliefen und die Gesprächspartner sich öffneten.
Angehörige des Bürgertums wurden natürlich von all dem ausgeschlossen. Um sich Neureiche und gesellschaftliche Aufsteiger vom Hals zu halten, verwendeten die Adligen diverse Insider-Witze und hatten zahllose Spitznamen füreinander.
Bis heute kann es in privaten Adelsarchiven schwer sein, Briefe einzelnen Personen zuzuordnen, da Spitznamen immer seltener entschlüsselt werden können. Kaum jemand weiß noch, wer mit dem lieben „Bobo“ oder der lieben „Dodi“ gemeint war. Viele dieser kindlichen Kosenamen wurden bis an das Lebensende beibehalten. Die jüngste Tochter von Herzog Alfred von Sachsen-Coburg und Gotha blieb in der Familienkorrespondenz zeitlebens das „Baby“. An ihre Schwester, die Königin von Rumänien, schrieb sie als betagte Dame: „Love from your old baby“.
Die zahllosen Kosenamen deuten auf eine größere Intimität innerhalb adeliger Familien hin als bisher angenommen. Doch die scheinbare „Infantilisierung“ von Familienangehörigen hatte noch andere Gründe. Die Inflation an Spitznamen hing auch damit zusammen, dass sich Vornamen in Adelsfamilien als Leitnamen häuften. Die interne Benutzung von Spitznamen diente also dazu, alle Wilhelms (z.B. der Bentinck-Familie) oder alle Ernsts (z.B. bei den Hohenlohes) voneinander zu unterscheiden.
Neben diesem ganz praktischen Ansatz gab es aber noch einen weiteren wichtigen Grund für die Kosenamen: Sie dienten zur Ausgrenzung Außenstehender, wie der Drehbuchautor Julian Fellowes gezeigt hat. Fellowes hat zahlreiche Drehbücher wie Gosford Park und Downton Abbey verfasst, die in der Welt des Adels spielen. Auch wenn er sich dabei einige Freiheiten erlaubt, hat er doch ganz richtig erkannt, warum Spitznamen für die Aristokratie so wichtig waren:
„Jeder wird ‚Toffee‘ oder ‚Bobo‘ oder ‚Snook‘ genannt. Sie selbst glauben, diese Namen hätten vor allem etwas Verspieltes und stünden für eine ewige Kindheit. Die Namen erinnern sie an ihr Kindermädchen und daran, wie sie im Pyjama vorm Kamin im Spielzimmer saßen. Dabei dienen sie in Wirklichkeit dazu, sich von Außenstehenden abzugrenzen. Sie beschwören die Erinnerung an eine gemeinsame Geschichte herauf, die alle Neuankömmlinge ausschließt; sie sind nur ein weiteres Mittel, die Vertrautheit mit Ihresgleichen öffentlich zur Schau zu stellen. Und die Spitznamen bilden tatsächlich eine wirksame Grenze. Ein Neuling kann in die Bredouille geraten, weil er eine Person zu gut kennt, um sie weiterhin mit ‚Lady so-und-so‘ anzureden, aber bei Weitem nicht gut genug, um sie ‚sausage‘ zu nennen. Spricht man sie jedoch mit ihrem tatsächlichen Vornamen an, so ist das für alle Eingeweihten ein sicheres Zeichen dafür, dass man sie eigentlich überhaupt nicht kennt. Damit wird jedem Neuankömmling von vorneherein verwehrt, dass sich eine gewisse freundschaftliche Vertrautheit entwickelt, wie sie in anderen Schichten üblich ist.“27
Spitznamen waren folglich eine Strategie, um unliebsame Vertraulichkeiten von Emporkömmlingen zu vermeiden. Erzwungene Intimität von Bürgerlichen wurde laut Nancy Mitford als Tortur empfunden: „Schweigend muss man […] erdulden, dass man von vergleichsweise fremden Menschen beim Vornamen angeredet oder mit bloßen Vor- und Nachnamen vorgestellt wird.“28
So offensichtlich die Abneigung gegen das aufstrebende Bürgertum auch war, die Haltung des Adels gegenüber der „Unterschicht“ stand oftmals auf einem ganz anderen Blatt. Mitfords Essay über die U- und Non-Sprache weist bereits darauf hin: In England ähnelte die Sprache der Oberschicht derjenigen der „einfachen Bevölkerung“, beide verwendeten einen ähnlich alten, traditionellen Wortschatz. Darüber hinaus hatte die Arbeiterklasse ihren Cockney-Slang, und die Angehörigen der Oberschicht hatten ganz ähnliche Präferenzen, wie Ross betont: „Zweifellos waren vor allem junge U-Sprecher [Oberschichtssprecher] in den neunziger Jahren und mindestens noch bis 1914 fast süchtig nach Slang.“29 Ein Beispiel hierfür ist die Erzählung Blandings Castle von P. G. Wodehouse, in der der Sohn des Lords ständig Slang-Wörter verwendet und seinen erzürnten Vater mit „guv’nor“ (Chef) anredet.30
Diese relative Nähe zwischen der Ober- und der Unterschicht war kein rein englisches Phänomen wie das Beispiel Bismarcks schon gezeigt hat. Adelige hatten in der Regel ihren ersten Lebensmittelpunkt auf dem Land und lernten als Kinder von den Dienstboten Dialekte (nicht selten zum Entsetzen ihrer bürgerlichen Kindermädchen). Sie fühlten sich häufig auch noch als Erwachsene in der ländlichen Lebens- und Sprachwelt heimischer als in Diskussionen mit den anspruchsvollen Bildungsbürgern. Graf Castell-Castell beschrieb dies während des Ersten Weltkrieges in einem Brief an seine Frau:
„Unter meinen Offizieren hatte ich heute Streit. Es ist nicht ganz homogen unser Kasino. Ich mache auch wieder hier die Erfahrung, dass unsereins sich besser mit halbgebildeten, aber etwas tiefer stehenden Leuten verträgt wie den Honoratioren.“31
Naturgemäß neigten die Honoratioren zu mehr Widerspruch. Darüber hinaus verstanden sie als „Städter“ kaum Castells Sorge über Jagd- und Ernteergebnisse. Wenn er Ernteprognosen diskutieren wollte, dann unterhielt Castell-Castell sich darüber lieber mit einem Soldaten, der im zivilen Leben Landarbeiter war, als mit einem Offizier, der in Friedenszeiten als Zahnarzt gearbeitet hatte. Den Zahnarzt interessierten andere Themen, und er besaß einen anderen Wortschatz. Wolfgang Frühwald behauptete sogar, die deutsche Mittelschicht habe ihren ganz eigenen „gebildeten Dialekt“ entwickelt, der sie vom Adel und vom „gemeinen Volk“ klar abgrenzte.32
Auch für Großbritannien gibt es unzählige Beispiele für die „Sprachlosigkeit“, die häufig zwischen dem Adel und der Mittelschicht existierte. Unter anderem persiflierte Aldous Huxley die scheinbar erratische Konversation des Hochadels: Während einer Abendgesellschaft, die sich zur Katastrophe auswächst, wechselt Lord Badgery ständig das Thema – eine solch assoziative Gesprächsführung galt unter Adligen als besonders geistreich. Badgerys bürgerliche Gäste können mit seinem Tempo kaum schritthalten und sind verwirrt.33 Badgery hingegen empfindet schwerfällige „Belehrungsmonologe“ durch Bildungsbürger als Zumutung. Das adelige Ideal war der Dilettant, wobei das Wort „Dilettant“ hier eine positive Bedeutung hatte und vom lateinischen delectare, „erfreuen“ abgeleitet wurde. Dem Bürgertum ging es jedoch selten nur darum, andere mit Konversation zu „erfreuen“, sie wollten ihr Spezialwissen demonstrieren. Beim Adel kam so etwas selten gut an. Der – alles andere als fiktionale – Herzog von Devonshire sah es noch Ende des 20. Jahrhunderts als eine enorme Auszeichnung von Tapferkeit an, dass seine Frau „Debo“ jährlich einen Tag für Gespräche mit lokalen Honoratioren opferte. In seinen Augen waren diese Herrschaften alles andere als stimulierend. Da die Herzogin eine geborene Mitford war, konnten darüber hinaus nur wenige ihrem Sprachwitz folgen. „Debo“ blieb jedoch vorsichtig im Umgang mit ihrer bürgerlichen Umgebung und versuchte auf die berüchtigt scharfen Mitfordkommentare zu verzichten. Sie tat ihr Bestes, die (wie Lord Cecil of Chelwood es einmal nannte) „Mittelschicht-Monster“34 nicht vor den Kopf zu stoßen.
Diese Vorsicht im Austausch mit dem Bürgertum war typisch für viele Hochadelige. In hochadeligen Korrespondenzen mit bürgerlichen Adressaten – ob in Deutschland oder Großbritannien – herrschte allgemein ein politisch korrekt anmutender Ton vor. Diese Vorsicht zeigte sich auch in adeligen Reden, die vor einem „gemischten“ Publikum gehalten wurden. Graf Castell-Castell umschrieb in einer Konfirmationsrede die in der Kirche anwesende Landbevölkerung zum Beispiel als „Nebenmenschen“.
Neben der höfischen Sprache, dem binnenadeligen Code und der politisch korrekten Sprache für das Bürgertum musste man in Hochadelsfamilien natürlich auch Fremdsprachen beherrschen.
Wie intensiv an Sprach- und Landeskenntnissen im Adel gearbeitet wurde, zeigt schon ein Blick auf Zeitungsabonnements. Der Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen las Zeitungen und Zeitschriften in drei Sprachen, u. a. die Illustrated London News, Independence Romaine und das Bukarester Tageblatt. Hansel Pless musste seinem Vater schon als Kind über Artikel in der Times und dem Figaro Bericht erstatten.35
Ähnlich streng ging es in Russland zu. Seit Katharina der Großen hatten französische Gouvernanten die Kinder des russischen Hoch- und Landadels aufgezogen. Ein Junge der russischen Oberschicht glaubte daher noch als Zehnjähriger, Französisch sei die Landessprache Rußlands. Fälle wie diese sind typisch für die russische Oberschicht, die wenig mit dem Rest der Gesellschaft verband. Französischkenntnisse blieben wichtig, aber Ende des 19. Jahrhunderts lief die englische Sprache der französischen in puncto Beliebtheit eindeutig den Rang ab. Ganze Heerscharen britischer Kindermädchen fielen über den Kontinent her und hinterließen ihre Spuren, deutsche Kinder zählten von nun an ihren Zehen ab, wie viele kleine „piggies“ (Schweinchen) auf den Markt gingen, und sangen Lieder über die „three blind mice“.36 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt es geradezu als gesellschaftlicher Makel, die „drei blinden Mäuse“ nicht zu kennen. Die niederländische Adlige Victoria Bentinck beklagte sich zum Beispiel, ihre Nichte Mechthild habe sich durch ihre Heirat „sprachlich verschlechtert“: „Sie ging eine Zweckehe mit einem deutschen Grafen ein. Da er keine andere Sprache als seine Muttersprache beherrschte, musste er sich in unserer Familie in Middachten wie ein Fisch auf dem Trockenen fühlen: Dort sprach man vier verschiedene Sprachen und mitunter alle in einem einzigen Atemzug. Sie hätte einen Diplomaten heiraten sollen, keinen Edelmann vom Lande. Im diplomatischen Dienst wäre sie ganz in ihrem Element gewesen.“37
Tatsächlich war Mechthild alles andere als glücklich über ihren trägen deutschen Ehemann. Einen ähnlichen Fehler wie dieser beging Fürstin Daisy Pless. Die gebürtige Britin heiratete 1891 in eine der reichsten deutschen Adelsfamilien ein. Obwohl sie vierzig Jahre in Deutschland lebte, gelang es ihr kaum, ihrem begrenzten deutschen Wortschatz zu erweitern.38 Einer der Gründe dafür war, dass alle ihre deutschen Freunde, Kaiser Wilhelm II. eingeschlossen, darauf bestanden, mit ihr Englisch zu sprechen. In dieser Hinsicht „profitierte“ sie davon, dass sich Englisch als neue Sprache des Adels durchgesetzt hatte. Sie hätte jedoch besser auf ihren Bekannten, König Eduard VII., hören sollen, der ihr geraten hatte, zunächst einmal „ordentlich“ Deutsch zu lernen. In den Kreisen der britischen Königsfamilie galten Deutschkenntnisse bis 1914 als wichtig. Eduard VII. sorgte dafür, dass seine älteren Söhne die Sprache lernten, und als sein Sohn Georg (der spätere König Georg V.) Prince of Wales wurde, schickte er ihn zu einem Auffrischungskurs nach Hessen.
Gute Fremdsprachenkentnisse dienten natürlich in erster Linie dazu, das internationale Freundschafts- und Verwandtschaftsnetzwerk aufrechtzuerhalten. Fremdsprachen waren im Hochadel aber auch eine Demonstration von multipler Ubiquität. Sie wurden gezielt als politisches Mittel eingesetzt, um Sprachbarrieren innerhalb der Herrschaftsgebiete zu überwinden. Regierende Häuser galten hier wie so oft als ein Vorbild: Kaiser Franz Joseph sprach neben Deutsch, Französisch und Italienisch auch etwas Tschechisch und Ungarisch, um mit all seinen Untertanen kommunizieren zu können.
Auf der Mikroebene hochadeliger Familien lag Grundbesitz häufig in verschiedenen Sprachräumen. Polnisch oder Tschechisch zu sprechen, war demnach ein wichtiges Mittel, seine „Verortung“ und damit seine Zugehörigkeit zu einer Region zu verdeutlichen. Fürst Pless zum Beispiel versuchte durch Erlernen des Polnischen sowohl Herrschaftsansprüche zu festigen als auch schwelende gesellschaftliche Konflikte zu entschärfen. Wie wir noch sehen werden, waren die schlesischen Güter der Familie Pless immer wieder Zielscheibe politischer Auseinandersetzungen. Die Pless-Männer wollten daher in keinem Teil Schlesiens als Fremdkörper angesehen werden.
Max Egon Fürstenberg wurde ebenfalls bilingual erzogen, da seine Familie neben dem Stammsitz Böhmen auch mit dem deutschen Fürstenbergzweig in Baden verbunden war. Als Mitglied des österreichischen Herrenhauses und des Böhmischen Landtages halfen ihm seine Tschechisch-Kenntnisse, Disharmonien unter Abgeordneten zu überwinden und politische Kompromisse auszuhandeln.
Eine Vernachlässigung von Fremdsprachen konnte für Hochadelige negative Konsequenzen haben. Über den Fürsten Oettingen-Wallerstein bemerkte ein Diener:
„Der Herr Fürst hatte einen ganz jungtschechisch gesinnten
Lehrer für die böhmische Sprache. Aber mit den böhmischen
Manieren will er durchaus nichts zu tun haben.“39
Oettingen-Wallerstein vernachlässigte zum Leidwesen seiner Familie die böhmischen Familienbesitzungen.
Doch auch wenn Fremdsprachen für den international vernetzten Hochadel von größter Wichtigkeit waren, so wurde diese Form der Kosmopolität vom Bürgertum immer kritischer beäugt. Wie wir in Kapitel 2 sehen werden, war mit dem Aufstieg des Nationalismus der internationale Hochadel zunehmend suspekt geworden. Eine neue ‚nationale Sprache‘ wurde vom Bürgertum postuliert. Im Deutschen Reich wurde ihre sprachliche „Entartung“ seit der Jahrhundertwende als ernsthaftes Problem gesehen. Hierbei waren sich Bürgertum und niederer Adel einig. Hans von Tresckow befürchtete 1907 einen Mangel an nationalem Gefühl beim Hochadel. Ein entscheidendes Symptom hierfür schien ihm die Fremdsprachenmanie zu sein:
„Mittags hatte mich Graf Maltzahn eingeladen, mit ihm im Hotel ‚Kaiserhof‘ zu frühstücken. Ich traf ihn dort mit dem Prinzen Brion, dem Prinzen Schönaich-Karolath und einem polnischen Grafen Skorczewski, alles Mitglieder des preußischen Herrenhauses, in dem gerade das Enteignungsgesetz gegen die Polen beraten wurde. [Ich] setzte mich mit Maltzahn an einen anderen Tisch, denn diese Stützen des preußischen Thrones unterhielten sich mit Rücksicht auf ihren polnischen Kollegen, der übrigens gut deutsch sprach, in französischer Sprache. Das ist wirklich der Gipfel von Snobismus. Die Regierung treibt Germanisierungspolitik und die erlauchten Mitglieder des Herrenhauses sprechen in der deutschen Reichshauptstadt mit einem preußischen Staatsangehörigen polnischer Abstammung französisch. Maltzahn war empört darüber. Er ist wirklich noch ein guter Deutscher, der von der Internationalität der großen Familien noch nicht angekränkelt ist.“40
Die „großen Familien“ hatten allen Grund, ihre Sprachfertigkeiten nicht aufzugeben. Sie halfen ihnen, Besitz und internationale Freundschafts- und Bekanntschaftsbeziehungen aufrechtzuerhalten. Und es war diese Kommunikationsfähigkeit, die sie zu idealen Go-Betweens machte.
Netzwerke vor 1914: das protestantische Netzwerk
In Adels- und Monarchiekreisen existierten zwei dominante Netzwerke: ein protestantisches und ein katholisches. Beide Netzwerke waren auf dem Prinzip Frömmigkeit und Familie aufgebaut und beide bemühten sich, vorteilhafte internationale Verbindungen zu knüpfen. Zu Überschneidungen der beiden Netzwerke kam es nur selten, wie Prinz Philip, Duke of Edinburgh, 2009 erklärte:
„Die Fürstenfamilien Europas kannten sich untereinander. Mit dem römisch-katholischen Frankreich gab es nur wenige Eheverbindungen. Es existierten einige mit Belgien, aber sie waren entfernter. Natürlich gab es noch Skandinavien. Aber das nächstgelegene protestantische Land, das uns mit Ehefrauen und Ehemännern versorgte, war Deutschland, weil es dorthin weitaus mehr familiäre Kontakte gab.“41
Während das katholische Netzwerk von den Habsburgern dominiert wurde, stand im Zentrum des protestantischen Netzwerks die britische Royal Family. Dafür gab es mehrere Gründe: Für protestantische Adelige, die auf dem Kontinent lebten, galt Großbritannien seit dem 19. Jahrhundert als Vorbild, Wunschbild und gelegentlich auch Neidbild.42 Großbritannien bot seit 1815 zuerst einmal die Gegenfolie zu Frankreich. Nach den Napoleonischen Kriegen brauchte man einen neuen, politisch korrekten Orientierungspunkt, und die deutsch-britischen Beziehungen waren nicht mit ähnlich emotionsbeladenden Assoziationen belastet wie die deutsch-französischen. Ein weiterer Anziehungspunkt war der wirtschaftliche und gesellschaftliche Erfolg des englischen Adels. Er schien sich problemlos an die Herausforderungen der industriellen Revolution angepasst zu haben, ja sogar von ihr zu profitieren. Außerdem stand ihm ein großes Empire zur Verfügung, das Investitionsmöglichkeiten bot und nachgeborene Söhne versorgte. Darüber hinaus hatte der englische Adel die unteren Stände durch Reformen „unter Kontrolle“ gebracht und war daher seltener Ziel von politischen Angriffen und Presseattacken.
In den Augen des deutschen Hochadels hatten die englischen Standesgenossen also Überlebensstrategien entwickelt, die man kopieren wollte. Neben dieser Bewunderung gab es auch eine Reihe von pragmatischen Gründen, Kontakt mit dem englischen Adel zu suchen. Für deutsche Hochadelige bedeuteten die Beziehungen zu einer starken Adelsgesellschaft wie der englischen eine Steigerung des eigenen Sozialprestiges und gelegentlich auch politische und ökonomische Vorteile.
Der schnellste Weg nach Großbritannien führte über die britische Königsfamilie. Bereits die deutschen Ehefrauen von Georg III. und Georg IV. hatten ihre deutschen Verwandten importiert, und dasselbe versuchten Queen Victoria und Prinz Albert. Sie waren mit diversen kleineren Fürstenhäusern verwandt (die wichtigsten davon waren die Häuser Coburg, Leiningen und Hohenlohe). Die Mitglieder dieser Familien sahen sich selbst als „Anglo-German“ und bewegten sich mühelos zwischen den beiden Ländern. Genau dieser Umstand sollte sie für Go-Between-Missionen im 20. Jahrhundert interessant machen.
Vor allem das Coburg-Netzwerk erwies sich als besonders erfolgreich. Bereits in den 1840er Jahren beschrieb Prinz Alberts Bruder Herzog Ernst II. von Coburg (1818–1893) in einem geheimen Memorandum, mit welchen Methoden man die Familienmitglieder zusammenhalten solle: „Bitterkeit, Ironie, Spott, muß uns gegeneinander ebenso fremd sein, wie Neid und Eifersucht. Gegen Fremde stehe der eine für den Andern, und Alle für einen.“ Ernst II. appellierte hier, in Anlehnung an Dumas’ gerade erschienenen Roman „Die drei Musketiere“, an den Gemeinschaftsgeist. Die über mehrere Nationen verstreuten Familienmitglieder sollten immer als Einheit agieren:
„Im Gegentheil und im Gegensatz zu andern Häusern muß es den Gliedern unseres Hauses leichter werden, ein mächtiges Ganzes nach Außen hin zu bilden […] wenn wir das Bewusstsein in uns wach erhalten, daß wir isoliert wenig, in der Verbindung aller Glieder unendliches anstreben und erreichen können.“43
Für die Familienmitglieder gab es mehrere Gründe, dieser Aufforderung zu folgen. Von einem rationalen Standpunkt aus bot das Familiennetz, ganz nach Pierre Bourdieus berühmten Theorien, soziales, symbolisches und ökonomisches Kapital. Ohne die Familie war man von finanziellen Ressourcen abgeschnitten und gesellschaftlich heimatlos, d. h. ein Bruch mit der Familie konnte dem sozialen Selbstmord gleichkommen.44
Ganz abgesehen von diesen rationalen Argumenten gab es allerdings auch eine irrationale Komponente, die diese Netzwerke zusammenhielt: die Macht der Emotionen. Bis heute wird diskutiert, ob Adlige überhaupt in der Lage waren, „echte Gefühle“ zu empfinden. Bei dieser Debatte vertreten Medienpersönlichkeiten wie Julian Fellowes (