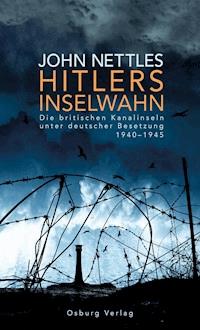
Hitlers Inselwahn. Die britischen Kanalinseln unter deutscher Besetzung 1940-1945 E-Book
John Nettles
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Osburg Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die verlorene Luftschlacht gegen England bedeutete das Ende von Hitlers Wahn, englischen Boden zu erobern. Nicht ganz! Es gab ja bereits ein britisches Territorium, das von der Wehrmacht okkupiert wurde. Am 28. Juni 1940 griffen die Deutschen von Frankreich aus die Kanalinseln an. Bomben trafen die Häfen von St. Helier auf Jersey und St. Peter Port auf Guernsey. Damit fiel britischer Boden den Deutschen in die Hände und verblieb dort bis zu seiner Befreiung im Mai 1945. John Nettles legt in seinem Buch eine detaillierte Schilderung der deutschen Besatzungszeit vor. Er lässt Zeitzeugen zu Wort kommen und von ihren Erfahrungen berichten. Der Autor spart dabei auch die heiklen Aspekte der Okkupation nicht aus, etwa die angespannte Beziehung zwischen den Kanalinseln und der englischen Regierung. Denn auf den Inseln verlief die Linie zwischen Kooperation und Kollaboration, zwischen Widerstand und Kriegsverbrechen viel dramatischer als bisher angenommen. Der komplexe Fall der Kollaboration wird ebenso beleuchtet wie das Schicksal der Juden und Zwangsarbeiter auf den Inseln. Nettles lebte während der Dreharbeiten für die Serie Bergerac auf Jersey, seither verbindet ihn eine enge Beziehung zu den Kanalinseln. 2011 unterbrach er seine Karriere als Schauspieler, um sich seiner Arbeit als Dokumentarfilmer und Sachbuchautor zu widmen. Ein Jahr später erschien sein aufsehenerregendes Buch. "Nelles hat all die kleinen Geschichten gesammelt, aus denen sich Historie sich zusammensetzt. Viele sind voller Absurdität." FAZ
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
John Nettles
Hitlers Inselwahn
Die britischen Kanalinseln unter
deutscher Besetzung 1940–1945
Aus dem Englischen von
Kaltërina Latifi und Jakob Brüssermann
Osburg Verlag
Titel der englischen Originalausgabe: Jewels and Jackboots. Hitler’s British Channel Islands © Seeker Publishing & EWM Design & Advertising, Jersey, Channel Islands, 2013
Erste Auflage 2015© Osburg Verlag Hamburg 2015www.osburgverlag.deAlle Rechte vorbehalten, insbesondere das desöffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunkund Fernsehen, auch einzelner Teile.Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie,Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigungdes Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischerSysteme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.Lektorat & Bearbeitung: Bernd Henninger, HeidelbergUmschlaggestaltung: Judith Hilgenstöhler, HamburgSatz: Kaltërina Latifi, HeidelbergMitarbeit: Mike Rottmann, Alexander KnopfDruck und Bindung: CPI books GmbH, LeckPrinted in GermanyISBN 978-3-95510-099-5
Inhalt
Vorwort zur deutschen Ausgabe · 7
Prolog · 9
I. Verrat und Possenspiel · 17
II. Bomben fallen · 31
III. Den Deutschen die Hände schütteln · 39
IV. Die Übriggebliebenen · 59
V. Wer sind diese Leute und warum sind sie hier? · 139
VI. Das Empire schlägt zurück · 179
VII. Herzlich wenig Widerstand? · 209
VIII. Die Juden auf den Kanalinseln · 253
IX. Die Festung Alderney · 281
X. Befreiung · 305
Epilog · 327
Anmerkungen · 335
Anhang Vorposten der Festung Europa (1943) · 355
Abbildungen · 359
Chronologie 1940–45 · 375
Literatur · 387
Bildnachweise · 389
Personenverzeichnis · 391
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Die vorliegende deutsche Fassung meines Buches über die Besetzung der Kanalinseln wäre nicht zustande gekommen ohne den Einsatz von Kaltërina Latifi. Es war ihre Idee, mein Buch zu übersetzen, und sie war es, die in ausdauernder Bemühung mein kunst- und anspruchsloses Englisch in ein äußerst geschliffenes Deutsch verwandelt hat. Ich kann ihr und ihrem Co-Übersetzer Jakob Brüssermann (beide Universität Heidelberg) nicht genug danken. Dank gebührt ebenfalls Wolf-Rüdiger Osburg, dem Verleger der deutschen Fassung und Bernd Henninger, der sie lektoriert hat. Ein besseres Team hätte ich mir zur Erstellung dieses Buches nicht wünschen können. Mehr als dankbar bin ich ebenfalls Judith Hilgenstöhler, die ein Cover gestaltet hat, das so schön wie ausdrucksstark ist.
Das englische Original wiederum war nur möglich aufgrund unermüdlicher Helfer unter den Bewohnern der Kanalinseln, deren Zahl zu groß ist, um sie alle hier namentlich zu erwähnen. Auch ihnen ist mein Dank dafür, dass sie ihr Wissen von den Besatzungsjahren und die Klugheit, die sie aus dieser Erfahrung gewonnen haben, mit mir teilten, gewiss: Leute wie Bob Le Sueur und Michael Ginns auf Jersey, Henry Winterflood auf Guernsey und Werner Rang auf Sark, mit denen ich manche Stunde verbrachte, in der ich ihren Erzählungen der Jahre 1940–45 lauschte.
Unschätzbar war ebenfalls die Hilfe zweier Historiker, die zu den wichtigsten Kennern jener Jahre auf den Kanalinseln gehören: Paul SandersundHazelR.KnowlesSmith,diesichdieZeitgenommenhaben, um mir die Frage, wie die Insulaner mit der Erfahrung besetzt zu sein, umgingen, in all ihrer Komplexität – und komplex ist diese Frage –zuerläutern.DasKapitelüberdiejüdischenEinwohnerderKanalinseln wurde geschrieben mit der Hilfe von Freddie Cohen, dessen Buch über die Juden auf den Kanalinseln ein Musterbild historischer Forschung darstellt. Für seine freudige Bereitschaft, sein Wissen zu teilen, bin ich auch ihm zu Dank verpflichtet. Ebenso danke ich Richard Heaume, der auf Jersey wohnt und dort das beste Museum zur Besatzungszeitführt,dasebenfallseineunschätzbareQuellevonInformationundvonDokumenten,Aufzeichnungen,Proklamationenimdeutschen Original war.
Besonderer Dank ebenfalls an meinen Forschungsleiter, Howard Butlin Baker, der in Zusammenarbeit mit Anna Baghiani von der Société Jersiaise und den Angestellten der Archive auf Jersey außergewöhnliche Geschichten der Besatzungszeit zutage gefördert hat, die eine ganze Bibliothek füllen würden.
Die Arbeit an diesem Buch hat mich reich belohnt; und das nicht zuletzt dadurch, dass sie mich mit so vielen Inselbewohnern zusammengebracht hat – viele von ihnen Zeitzeugen der Besetzung –, die so großzügig ihre Erfahrungen und Geschichten mit mir geteilt haben. Ihnen bin ich zu tiefem Dank verpflichtet, denn es war eine faszinierende, lehrreiche und nachdenklich stimmende Zeit. Um keinen Preis möchte ich sie missen.
Juni 2015,
John Nettles
Prolog
Das zwanzigste Jahrhundert war eines der blutigsten in der Geschichte der Neuzeit: Zwei Weltkriege und eine Unzahl an kleineren Konflikten, in deren Verlauf Millionen von Menschen gefangen genommen, versklavt, gefoltert und getötet wurden. Kein Ort auf Erden blieb von diesen Kämpfen verschont, niemand auf der Welt blieb unberührt von diesem mörderischen Wahnsinn. Es bestand die Hoffnung, dass der Erste Weltkrieg von 1914–1918 der letzte aller Kriege sein würde. Dem war aber nicht so. Die siegreichen Alliierten erlegten Deutschland einen Frieden auf, der eigentlich kein Frieden, sondern vielmehr ein Racheakt war, wie Hitler selbst es verbittert hervorhob. Dieser Frieden war eine Bürde und führte das Land in eine zermalmende Armut, es folgten ökonomischer Ruin, Hungersnöte und großes Leid. Es ging das Gerücht um, dass Mütter in Hamburg ihre Neugeborenen töten würden, weil sie keine Möglichkeit hatten, sie zu ernähren. Das waren die Jahre der Weimarer Republik – Jahre, die geprägt waren von wirtschaftlichem Niedergang, massiver Inflation und all den damit einhergehenden Übeln.
Natürlich gediehen unter diesen Umständen Unzufriedenheit und revolutionäres Denken; und in der Tat fand jede Form radikalen Denkens einen – oft auch gewaltsamen – Ausdruck, besonders sichtbar in den Straßen der großen Städte wie München und Berlin. Kurz gesagt: Zwei politische Gruppen dominiertenden Machtkampf, rechts die Nazis, links die Kommunisten. Am Ende war es Adolf Hitlers Nationalsozialistische Partei, die 1933 an die Macht kam. Der neue »Führer« trat freudig dem erlesenen Club der Diktatoren bei – dem bereits Stalin, Mussolini und Franco angehörten, die während dieser turbulenten Zeit die Welt in Schrecken versetzten. Hitlers Ambitionen waren expansionistisch und offen rassistisch. Deutschland sollte wieder in der Größe der Vorkriegszeit erstrahlen und seine Führungsrolle in Europa zurückerlangen. Hitler wollte das Territorium Deutschlands in den Osten ausdehnen, um der nach seiner Ideologie höherwertigen arischen Rasse den von ihr so »dringend benötigten Lebensraum« zur Verfügung zu stellen. Diese weiten Gebiete, in denen Polen und Russen lebten, sollten annektiert und Teil des Dritten Reichs werden. Die überlegenen Arier nahmen–ihrerMeinungnachmitvollemRecht–ihrenunseligenNachbarn alles weg. Diese galten als niedere Rasse, als »Untermenschen«; als solche konnten sie ausgerottet oder versklavt werden, je nachdem, was Hitler für angebracht hielt – mitsamt den Juden, die als die »niedrigsten Wesen« angesehen wurden.
Aus Sicht der Nationalsozialisten hatten die Juden durch eine internationale Verschwörung den desaströsen Krieg von 1914–1918 herbeigeführt, der wiederum das Erscheinen der verhassten Bolschewisten erst möglich gemacht hatte und zugleich deren Bestehen sicherte. Die Bolschewisten drohten, ganz Europa einzunehmen. Aus der Sicht der Nationalsozialisten waren die Juden ein Krebsgeschwür, das es herauszuschneiden galt. Genau das äußerte Hitler in seiner Rede vom 30. Januar 1939: »Und eines möchte ich an diesem vielleicht nicht nur für uns Deutsche denkwürdigen Tage nun aussprechen: Ich bin in meinem Leben sehr oft Prophet gewesen und wurde meistens ausgelacht. In der Zeit meines Kampfes um die Macht war es in erster Linie das jüdische Volk, das nur mit Gelächter meine Prophezeiungen hinnahm, ich würde einmal in Deutschland die Führung des Staates und damit des ganzen Volkes übernehmen und dann unter vielen anderen auch das jüdische Problem zur Lösung bringen. Ich glaube, daß dieses damalige schallende Gelächter dem Judentum in Deutschland unterdes wohl schon in der Kehle erstickt ist. Ich will heute wieder ein Prophet sein: Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.«1
Der »Führer« war dabei, das judenfreie Arierparadies im eigenen Land wie auch im Ausland mittels Waffengewalt oder auch nur durch die bloße Androhung von Gewalt zu verwirklichen. Die Innen- und Außenpolitik nach der Machtübernahme Hitlers im Jahr 1933 zeichnete sich nicht durch diplomatische Feinfühligkeit aus. Fast täglich verkündeten die Schlagzeilen neue Verstöße gegen den Versailler Friedensvertrag: die Remilitarisierung des Rheinlandes, die Besetzung des Sudetenlandes, eine massive Wiederaufrüstung. Täglich fanden neue Angriffe auf politische Gegner des Regimes statt, täglich wurden neue Gräueltaten oder Morde begangen. Konzentrationslager und institutionalisierte Gewalt waren die Losungen jener Tage, ganz zu schweigen von der Zersetzung des kompletten Rechtssystems, das schließlich vom tyrannischen NS-Regime vollends instrumentalisiert wurde. Das Gesetz wurde zu einem Ausdruck von Hitlers Willen.
Ein Kapitel nach dem anderen schrieb das große NS-Geschichtsbuch, das der Welt gefährliche Zeiten bescherte. Eine Welt freilich, die weit entfernt war von der französischen Halbinsel Cotentin und den Menschen, die auf den küstennahen Kanalinseln lebten. Während der 1930er Jahre, als Hitler seine politischen Gegner ermorden oder in Konzentrationslager einsperren ließ, während er sich dem staatlichen Terror hingab und um sich herum Angst und Schrecken verbreitete, gingen die Bewohner der Kanalinseln Jersey, Guernsey, Alderney und Sark in einer friedvollen Isolation ruhig und gelassen auf gewohnte Weise ihren täglichen Geschäften nach, so wie sie es schon seit Urzeiten getan hatten.
Die Kanalinseln werden zwar zu den britischen Inseln (British Isles) gezählt, und doch sind sie ein ganz ungewöhnlicher Teil Großbritanniens. Daher ist es unangebracht, von den auf den Kanalinseln gemachten Kriegserfahrungen generell darauf zu schließen, wie sich die britische Gesellschaft verhalten hätte, wäre das britische Festland von den Deutschen besetzt worden. Da die Inseln eine Besonderheit darstellen, können sie auch nicht für die gesamte britische Gesellschaft als Paradebeispiel herhalten.
Jersey ist mit einer Größe von 117 Quadratkilometern die größte der Kanalinseln. 1940 lebten ungefähr 35 000 Menschen auf Jersey, das zu jener Zeit bereits berühmt war für seine Rinder: hohlrückig, großäugig und von einer schönen hellbraunen Farbe. Bekannt war die Insel außerdemfürdieKartoffelsorteJerseyRoyal,die–bedecktmitgroßen,an denSträndenentlangderKüsteaufgelaufenenSeetangschichten–imnahrhaftenBodenderAbhängewächst.Dergroßartige,ausJerseystammende Künstler Edmund Blampied, der die Briefmarken und Banknoten während der Besatzungszeit gestaltete, hat auf vielen herrlichen Gemälden und Kupferstichen die Seetangernte festgehalten; sie zeigenprächtigePferdeunterflammenderSonnevorderaufgewühltenSee.
Das wirkt idyllisch – und idyllisch war es auch. Trotzdem darf nicht unerwähnt bleiben, dass eine nicht geringe Armut herrschte auf den Inseln, insbesondere unter den kleinbäuerlichen Pächtern: Diese lebten in winzigen verdreckten Hütten, ohne Gas oder Elektrizität und ohne WC im Haus. Ein entscheidendes Kriterium der Nationalsozialisten bei der Klassifizierung einer Rasse scheint übrigens der Mangel an sanitärenAnlagengewesenzusein–wenigstens,wennmandieAussageneines an der Ostfront stationierten deutschen Offiziers ernst nimmt: Er behauptete, dass sich der rassisch Höhergestellte von einem »Untermenschen« dadurch unterscheide, dass jenem ein Abort im Innern des Hauses zur Verfügung stünde. Nach dieser Einschätzung musste ein Großteil der Insulaner (ganz zu schweigen von der Bevölkerung des britischen Festlands) von einer untergeordneten Spezies gewesen sein.
EinwesentlicherTeildesEinkommensderInselnstammteausdemdamalsnochnichtsoumfänglichenBankwesen,dasmitdemheutigennicht zu vergleichen ist. Eine weitere Einnahmequelle war der Tourismus: Die Urlauber waren bemüht – und sei es auch nur für wenige Tage –, dem Lärm und der Hektik der Städte auf dem britischen Festland zu entkommen. Sie verbrachten die wenige, aber kostbare Zeit am Strand von St. Brelades Bay oder schwammen in den kristallklaren Gewässern – und dann genossen sie vielleicht einen köstlichen Jersey cream tea in einem der luxuriösen Hotels. Man ließ es sich gut gehen in einer Welt, die weit entfernt war vom bedrängten Europa und seinen tollwütigen Diktatoren.
Historisch gehörten Jersey und die anderen Kanalinseln zum Herzogtum der Normandie. Als Wilhelm I. (der Eroberer) nach der Schlacht bei Hastings im Jahr 1066 König von England wurde, herrschte er weiterhin als Herzog der Normandie auch über die Inseln. Obwohl England über die Jahrhunderte hindurch allmählich seinen Besitz auf dem französischen Festland verlor, blieben die Kanalinseln der englischen Krone treu ergeben. Sie waren und sind es noch: ein »Kronbesitz« (Peculiar of the Crown). Das bedeutet, dass sie weder dem britischen Parlament Rechenschaft schuldig sind noch von diesem regiert werden, sondern von der Königin im Kronrat (Privy Council) oder einem aus diesem hervorgehenden Komitee. Die Inseln genießen – mit Ausnahmen in der Außen- und Verteidigungspolitik – eine beneidenswerte Autonomie. Die innenpolitische Gesetzgebung ist Sache der States, den Parlamenten der Inseln. Der Präsident des Parlaments wird Bailiff genannt, faktisch ist dieser der Ministerpräsident (First Minister) des Bailiwick Jersey bzw. Guernsey (zu welchem Sark und Alderney gehören).
Im Jahr 1940, da unsere Geschichte beginnt, war Alexander Moncrieff Coutanche Bailiff von Jersey. Ihm werden wir während dieser fünf Besatzungsjahre noch oft begegnen. Bailiff von Guernsey war zu dieser Zeit der ältere und etwas korpulente Victor Gosselin Carey – er verbrachte einen unglücklichen 69. Geburtstag, denn er war an diesem Tag gezwungen, die ersten deutschen Besatzer zu begrüßen. Beide Inseln hatten jeweils einen Vizegouverneur (Lieutenant-Governor): Major General Richard Harrison auf Jersey und Major General A. P. D. Telfer Smollet auf Guernsey.
Nicht weit entfernt von der Küste Guernseys liegt die am wenigsten bebaute und damit schönste der Inseln, nämlich Sark: lediglich 4,6 km lang und 2,7 km breit. Die kleine Insel wird durch Felsen geschützt, die 300 Fuß in die Höhe ragen und deshalb extrem schwer zu besteigen sind – was später die britischen Soldaten bei ihren nächtlichen Kommandounternehmen am eigenen Leib erfahren würden. Einen einfacheren Zugang zu der Insel hat man über einen kleinen Hafen und durch einen in den Felsen gehauenen Tunnel, der während der Besetzung von den Deutschen allerdings streng bewacht wurde. Der Haupterwerb der Sarkeser bestand in der Fischerei, der Milchwirtschaft und in dem kleinen Tourismusgewerbe. Bei Ausbruch des Krieges kümmerte sich die eindrucksvolle Dame von Sark, Sibyl Hathaway, geborene Collings, auf ihre altehrwürdige Weise um die 600-köpfige Bevölkerung. Ihr Urgroßvater John Allaire, ein waschechter Insulaner, war ein Freibeuter, eine Art »lizenzierter Pirat«, der ein großes Vermögen erwirtschaftet hatte, indem er Handelsschiffe ausraubte, die im Ärmelkanal verkehrten. Wie die Dame von Sark selbst bemerkte, war er ein Mann von »unchristlichem Temperament, der sich durch Prasserei und Frevel auszeichnete«. Mit diesem »erwirtschafteten« Vermögen war es ihm allerdings möglich, den Titel des Seigneurs auf Sark zu erwerben. Ihm folgte seine Tochter Mary als Dame von Sark. Mary heiratete den aus Guernsey stammenden Thomas Collings, Sibyls Großvater. Auf diese Weise konnte der Titel des Herzogs (Seigneur) in der Familie weitergereicht werden, bis ihn 1940 Sibyl Hathaway (wie sie nach der Hochzeit mit dem Amerikaner Bob Hathaway hieß) erhielt. Ihr Mann war amerikanischer Staatsbürger und hatte im Ersten Weltkrieg als Offizier bei den Royal Flying Corps gedient – dieser Umstand sollte sich bei der Deportationsanordnung von 1943 noch rächen.
Sibyls eigentlicher Titel war »La Dame de Serq«, die weibliche Entsprechung des Seigneur. Sie leitete die Inselregierung durch ihre eigene Inselversammlung, Court of Chief Pleas genannt, und den dazugehörigen Court of Justice. Weder Einkommenssteuer noch Erbschaftssteuer waren vorhanden – und auch kein einziges Auto! Sark war eine schöne, kleine, in einer feudalen Zeitkapsel gefangene Insel: ungestört, ruhig und komplett abgeschottet von der gefährlichen Welt jenseits des Meeres, dem europäischen Festland.
Eine kurze Fahrt von Sark aus über das Meer führt zur letzten der vier Hauptinseln: Alderney, die, so der allgemeine Konsens, das Auge weniger erfreut als Sark. Tatsächlich war Alderney 1940 ein eher trostloser, ungastlicher Ort, und – das ist nicht abzuleugnen – ziemlich rückständig. Zwar existierte eine Landwirtschaft, doch diese war ziemlich primitiv und mehr auf den Eigenbedarf hin ausgerichtet. Einige wenige Geschäftstüchtige züchteten reinrassige Kälber für den Export nach Guernsey, manche arbeiteten im Granitabbau. Außerdem machte man von Zeit zu Zeit Geld durch Schmuggelgeschäfte – mehr gab es auf Alderney nicht zu tun. Es existierte so gut wie kein Kommunikationssystem auf der Insel. Telefone gab es keine und – im Juni 1940 sollte dieser Umstand sehr unangenehm werden für die Inselbewohner – kein unterirdisch verlaufendes Kabel, das die Insel mit Guernsey verbunden hätte. Neuigkeiten wurden auf der Insel vom Stadtausrufer überbracht und das Radio diente dazu, den Kontakt zur Außenwelt zu pflegen. Alderney hatte keine eigene Legislative und kein Gericht. Per Verfassung gehörte die Insel zum Bailiwick von Guernsey. Zuständig für die Insel war der dort ansässige Frederick George French, Judge of Alderney, ein Engländer und ehemaliger Soldat. Er war es auch, der das Volk von Alderney von der Insel brachte und dadurch den Deutschen ermöglichte, die quasi menschenleere Insel in Besitz zu nehmen.
Diese »Stückchen Frankreich, ins Meer gefallen und von England aufgesammelt«, wie sie Victor Hugo beschrieben hat, waren in diesem heißen und verhängnisvollen Sommer 1940 wehrlos angesichts der vorrückenden Deutschen. Niemand stand ihnen bei. Keine britischen Truppen waren da, um sie zu verteidigen. Im Juni 1940 kam eine schlechte Nachricht, die Major General Harrison, von 1939–40 Vizegouverneur auf Jersey, auf der Rückseite eines Briefumschlags notierte, während er mit Major General Percival, dem stellvertretenden Generalstabschef im Kriegsministerium, telefonierte. Anschließend eilte er zur Versammlung der States von Jersey, wo er die Neuigkeit verkündete: »Entscheidung des Kriegskabinetts: Die Insel Jersey soll demilitarisiert werden. Alle Truppen sind abzuziehen.«
I.
Verrat und Possenspiel
»Wir werden kämpfen bis zum Ende. Wir werden in Frankreich kämpfen, wir werden auf den Meeren und Ozeanen kämpfen, wir werden mit wachsender Zuversicht und wachsender Stärke am Himmel kämpfen, wir werden unsere Insel verteidigen, wie hoch auch immer der Preis sein mag. Wir werden auf den Stränden kämpfen, wir werden an den Landungsabschnitten kämpfen, wir werden auf den Straßen kämpfen, wir werden in den Bergen kämpfen […]«. Wir werden überall kämpfen, außer auf den Kanalinseln – hätte Winston Churchill hinzufügen können.
Lord Portsea, ein couragierter 80-jähriger Mann aus Jersey, der mit bürgerlichem Namen Bertram Falle hieß, hat das Verhalten der britischen Regierung gegenüber den Kanalinseln in den Wochen vor dem desaströsen 28. Juni mit vernichtenden Worten charakterisiert: »Ein schier unfassbares Possenspiel!« Ja, schlimmer noch: Die Insulaner seien von der britischen Regierung »verraten« und »im Stich gelassen« worden, jedem feindlichen Angriff vollkommen wehrlos ausgesetzt. Der Einschätzung des noblen Lords ist schwer zu widersprechen, denn tatsächlich hatten die Insulaner an jenem sommerlichen Freitagabend, als die Heinkelbomber aus heiterem Himmel herabstießen, keine Waffen zur Verfügung, um sich zu verteidigen. Weder eine Bürgerwehr noch ein einziger britischer Soldat konnte irgendeine Form von Schutz gewähren. Lord Portsea hatte recht. Man hatte die Inseln aufgegeben – und das machte ihn wütend: »Auch wenn die Einwohner die Inseln nicht länger als einige Wochen hätten halten können, so wären diese Männer doch wenigstens mit Anstand gestorben, anstatt Sklaven zu sein. Und wie hätten sie würdevoller sterben können? Man stelle sich hingegen eine britische, eine englische Regierung vor, die behauptet, das Risiko sei zu groß, dass Menschen sterben würden, tausend zu eins. Als hätten wir nicht von der Schlacht von Azincourt gehört.« Die Inseln wurden tatsächlich aufgegeben und »verraten«, allerdings auf eine wesentlich subtilere Art, als es sich Bertram Falle damals hätte vorstellen können. Hinter dieser Geschichte des »Verrats« steckt eine Mischung aus panischer Angst, Naivität, politischer und militärischer Ignoranz – vor allem aber das zwar nicht direkt beabsichtigte, aber doch gravierende Versäumnis, Leben und Wohl des bedrängten Volkes auf den Inseln zu sichern.
Die unglückliche und unangenehme Wendung der Ereignisse sollte tiefgreifende Auswirkungen auf die Beziehung zwischen der britischen Regierung und den Insulanern haben, und das ganz besonders in der unmittelbaren Nachkriegszeit, die geprägt war von Vorwürfen und gegenseitigen Beschuldigungen. Die folgenden Ereignisse führten zum 28. Juni 1940:
Mittwoch, der 5. Juni
Der Stabschef im königlichen Generalstab, General Sir John Dill (Chief of the Imperial General Staff), hielt vor den Stabschefs der Streitkräfte im Kriegskabinett (Chiefs of Staff Committee of the War Cabinet) einen Vortrag, in welchem er nach einer langen, detailreichen und absolut überflüssigen Abhandlung über die Militärgeschichte der Kanalinseln seit 600 n. Chr. erklärte, dass keine Gefahr für eine richtige Invasion bestünde; sollte aber der Feind dennoch auf den Inseln landen, müsse er aus Prestigegründen vertrieben werden. Dieser letzte Hinweis gibt zu erkennen, dass der potentielle Propagandawert der Inseln erkannt worden war. Wenn Sir John seinen Gedankengang etwas weiter fortgeführt hätte, so hätte er erkennen können, dass, wenn es nötig ist, den FeindausPrestigegründenzuvertreiben,derFeindesalleinausdemselben Grund seinerseits für notwendig erachten könnte, die Inseln einzunehmen und zu besetzen. Was für ein Propagandacoup, wenn die WehrmachtihrenFußaufbritischenBodensetzenwürde!SolcheÜberlegungen hätten natürlich die Annahme entkräftet, die Deutschen würden sich möglicherweise gar nicht darum bemühen, die Inseln anzugreifen.
Die Beurteilung seitens der Briten, dass keine unmittelbare Gefahr für die Inseln bestünde, gründete auf der seit mehreren Jahren anhaltenden Überzeugung, dass die Kanalinseln für beide Seiten keinen strategischen Wert haben würden. Anders ausgedrückt: Weder der Angriff noch die Verteidigung der Inseln konnten militärisch begründet werden. Die Deutschen würden demnach, so glaubten sie, die Inseln links liegen lassen. Sie würden die Inseln das sein lassen, wofür sie stets gerühmt wurden: ein Ferienparadies mit viel Sonnenschein, weit weg von den Schrecken des Krieges.
Mittwoch, der 12. Juni
An diesem Mittwochmorgen trug Sir John Dill seinen Bericht ein weiteres Mal vor, diesmal jedoch direkt vor dem Kriegskabinett. Er betonte erneut, dass die Kanalinseln keinen strategischen Wert besäßen. Der eigenen Reputation wegen sollten trotzdem einige Verteidigungsmaßnahmen getroffen werden. Die Stabschefs stimmten zu. Es wurde die Entscheidung getroffen, zwei Bataillone auf die Inseln zu schicken.
Dann allerdings überschlugen sich die Ereignisse: Dieser Krieg war nämlich keine Wiederholung des Ersten Weltkriegs, welcher ein Zermürbungskrieg war und in ein Patt führte. Er war gewiss kein Stellungskrieg, sondern ein rasanter Krieg voller improvisierter und schneller Manöver: ein Blitzkrieg.2 Noch während der Sitzung kam die Nachricht von der bevorstehenden, siegreichen Ankunft des Feindes an der Küste Frankreichs. Eine zweite Dringlichkeitssitzung des KriegskabinettswurdefürdenNachmittageinberufen.ImLichtedieserjüngsten Information sollte die zuvor getroffene Entscheidung, zwei Bataillone zur Verteidigung der Kanalinseln über das Meer zu schicken, überdacht werden.
Donnerstag, der 13. Juni
An diesem Morgen nahm General Sir John Dill eine Neubewertung der Situation auf den Kanalinseln vor. Da sich der Feind nun in Cherbourg befand und in Richtung St. Malo drängte, bestand kein Zweifel, dass die Deutschen früher oder später die absolute Kontrolle über die gesamte französische Küste erlangen würden. Nichts konnte sie stoppen. Daher wurde die Kabelverbindung von Frankreich nach Jersey und zum britischen Festland gekappt, deren Existenz bis dahin noch als kleiner Anreiz für die Verteidigung der Inseln gedient hatte. Nicht der geringstestrategischeGrundwarnochvorhanden,umdieVerteidigungderInselndurchzweiBataillonezurechtfertigen.Überdiesbenötigte man die beiden Bataillone dringend zur Verteidigung des FestlandesgegendiebevorstehendeInvasiondurchdenFeind.DieEntscheidung wurde aufgehoben: Es sollten keine britischen Truppen zur Verteidigung der Inseln entsandt werden.
Freitag, der 14. Juni
Die Deutschen hatten bei Quillebeuf die Seine überquert. Der etwas trübsinnige, gleichwohl kompetente und zudem mit einem messerscharfen Verstand ausgestattete Alexander Moncrieff Coutanche deutete die Lage so: »Zufälligerweise kenne ich diesen Teil des Landes sehr gut. Wenn die Deutschen erst einmal bei Quillebeuf die Seine überquert haben, dann wird sie nichts mehr davon abhalten können, hierher zu kommen.« Er hatte recht. Es gab nichts, das sie aufhalten konnte. Das beängstigte ihn. Von seinem Kronanwalt begleitet eilte der BailiffzueinemTreffenmitVizegouverneurJ. M. R.Harrison.Erbatihn, wegen dieser dringenden Angelegenheit London anzurufen und herauszufinden, wie man dort diese in jeder Hinsicht gefährliche Situation einschätzte. Wie sollten sich die Insulaner verhalten? Sie hatten bis dahin nämlich nicht einen Ton vom Innenministerium vernommen.
Harrison, selbst sehr betroffen, führte ein Ferngespräch mit Charles Markbreiter, dem für die Kanalinseln zuständigen Unterstaatssekretär im Innenministerium. Markbreiter schien äußerst desinteressiert zu sein: »Ich habe nicht sehr viel darüber nachgedacht, aber mir scheint, die Situation hat sich nicht wesentlich verändert.« Coutanche sah das ganz anders. Seiner Meinung nach hatte sich die Lage drastisch zum Schlechteren gewendet: »Wann haben Sie zuletzt eine Beurteilung vom Kriegsministerium erhalten?«, fragte der Bailiff. Markbreiter antwortete: »Oh, das weiß ich nicht ganz genau, aber es gab da nichts, das uns sehr beunruhigt hätte.« Coutanche, bemerkenswert beherrscht und freundlich,fragtedensehrvageantwortendenStaatssekretär,oberfreundlicherweise das Kriegsministerium kontaktieren könnte, um herauszufinden,wiemandortdieLagegenaubeurteilte.Markbreiterfolgte der Aufforderung und erfuhr, dass die Verantwortlichen im Kriegsministerium, wie Coutanche auch, nicht glücklich waren über die aktuelle Situation. Sie wollten tatsächlich, dass der Bailiff noch am gleichen Nachmittag nach London fliegt, um diese dringende Angelegenheit zu besprechen.
Der Plan wurde allerdings von den Ereignissen überholt. Anstatt nach London zu fliegen, musste Coutanche auf Jersey bleiben, um die Evakuierung der britischen Truppen aus St. Malo zu organisieren, die dort aufgrund des raschen Vorrückens der Deutschen festsaßen. Statt seiner flog Jurat Edgar Dorey nach London.
Samstag, der 15. Juni
Die Briten beschlossen, die Kanalinseln zu demilitarisieren. Die beiden Flugplätze der Inseln sollten jedoch als Fliegerhorste weiterhin verteidigt werden, damit die Royal Air Force (RAF) die britischen TruppenimNordwestenFrankreichsvondortaussolangewiemöglichunterstützenkonnte:»ErstdanachtrittdiePolitikderEntmilitarisierung in Kraft.« Zu diesem Zeitpunkt wurde noch keine formelle ErklärungzurEntmilitarisierungabgegeben,dasKriegskabinetthatteallerdings definitiv entschieden, die Kanalinseln »zu einem baldigen Zeitpunkt« zu entmilitarisieren.
Sonntag, der 16. Juni
An diesem Sonntag wurde der Befehl zum sofortigen Abzug aller Truppen von den Kanalinseln erlassen.
Dienstag, der 18. Juni
ZuletztmusstendieInsulanerdarüberinformiertwerden,wasauf sie zukam. Anstelle von Bailiff Coutanche reiste Jurat DoreynachLondon.DortwurdeerüberdiedreiTagezuvorvomKriegskabinett getroffene Entscheidung, die Inseln zu entmilitarisieren, informiert. Darüber hinaus wurde ihm mitgeteilt, dass »im Interesse der Einwohner« keinerlei Versuche unternommen würden, die Inseln zu verteidigen; sie sollten als »offene Städte« (open towns) deklariert werden. Alle bewaffneten Streitkräfte würden abgesetzt und Schiffe für all jene Insulaner zur Verfügung gestellt, die beschlossen hatten, sich evakuieren zu lassen.3 Die Vizegouverneure würden abberufen, ihren Titel und ihre Pflichten sollten dann die Bailiffs übernehmen.
Um welche Pflichten es sich dabei genau handeln würde, legte der Staatssekretär im Innenministerium, Sir Alexander Maxwell, in einem Brief an den Lord Lieutenant4 dar, in welchem es heißt: »Sir, ich wurde vom Außenminister angewiesen, Ihnen mitzuteilen, dass die Regierung seiner Majestät es wünscht, der Bailiff möge im Falle einer Abberufung die Pflichten des Vizegouverneurs erfüllen, die sich dann auf zivile Aufgaben beschränken würden. Er soll im Amt bleiben und die Insel nach bestem Wissen und Gewissen und im Interesse der Einwohner regieren, ungeachtet dessen, ob er Anweisungen von der Regierung Seiner Majestät erhalten kann oder nicht. Die anderen Crown Officers [i.e. die der britischen Krone direkt unterstellten Inselbeamten] sollen ebenso auf ihren Posten verbleiben. So verbleibe ich, Sir, als Ihr ergebener Diener, A. Maxwell«.
Die Entscheidung zur Entmilitarisierung wurde im Interesse der Einwohner getroffen. Man wollte sie davor bewahren, von einem erbarmungslosen Feind bombardiert, angegriffen und getötet zu werden. Es war die löbliche und redliche Absicht der britischen Regierung, das Leben der Insulaner zu bewahren und ihre Sicherheit zu gewährleisten – auch wenn sie angesichts der herrschenden Umstände ihre Freiheit nicht länger garantieren konnte.
Mittwoch, der 19. Juni
Während einer Sitzung der Jersey States (das Parlament der Insel) war Vizegouverneur General Harrison damit beschäftigt, den dort versammelten und sehr besorgten Ministern (Jurats) und Stellvertretern zu erklären, in welcher Situation man sich befand, als ein Anruf aus London kam. Churchill selbst missbilligte den Beschluss zur Entmilitarisierung vehement. Er sagte: »Es ist abscheulich, jetzt britisches Territorium zu verlassen, das seit der normannischen Eroberung im Besitz der Krone war!« Er war ganz einig mit Lord Portsea und glaubte, dass man um Stolz und Ehre der Nation willen um die Inseln kämpfen und diese verteidigen müsse. In diesem Fall allerdings beugte er sich dem fundierten Urteil des Vizeadmirals Thomas Phillips, dass eine militärische Verteidigung der Inseln aufgrund ihrer Nähe zur deutschen Frontlinie und auch wegen der strapazierten britischen Militärressourcen in dem Gebiet schier unmöglich war. Zum Glück für die Insulaner beriet sich der britische Kriegsführer, anders als sein deutsches Pendant, mit seinen Feldkommandanten.5 Hätte man sich tatsächlich bemüht, etwas zu verteidigen, das nicht zu verteidigen war, so wäre die Anzahl der zivilen Opfer ohne jeden Zweifel enorm hoch gewesen.
Auf Guernsey wurde an diesem Tag in der Abendzeitung bekanntgegeben, dass die Inseln entmilitarisiert werden würden. Entscheidend ist aber, dass auf diplomatischem Wege keine offizielle Deklaration erfolgte, dass die Entmilitarisierung tatsächlich stattgefunden hatte. Den Deutschenwurdenichtsmitgeteiltundsiekonnten,außersiehätteneinen Spion im Parlament von Jersey oder in der Guernsey-Abendzeitung gehabt, vom neuen militärischen Status der Inseln nichts erfahren.6 Sie hatten aber keinen solchen Spion und lasen die Guernsey-Nachrichten offenbar nicht. Folglich blieben die Kanalinseln für sie ein legitimes Angriffsziel. Die Insulaner waren nun in großer Gefahr. Die Besetzung der Kanalinseln war als Teil der Operation Grüner Pfeil für Ende des Monats geplant. Die Inseln waren schutzlos.
Dienstag, der 20. Juni: Evakuierung!
An diesem Dienstag wurden alle übriggebliebenen britischen Truppen an Bord der SS Marlines und SS Biarritz abtransportiert. Das Kabel zu Frankreich wurde gekappt. Die zwei Vizegouverneure packten ihre Sachen und gingen. Die Insulaner waren auf sich selbst gestellt: wehrlos und leicht angreifbar. Panik brach aus. Geschichten über die unmenschliche Brutalität der Deutschen, die nur wenige Meilen entfernt waren, verbreiteten sich wie ein Lauffeuer, Geschichten von Vergewaltigung, willkürlichen Tötungen, Massenmord an Zivilisten und Verstümmelungen von Kindern.7 Das alles schürte Angst. Angesichts der schrecklichen Neuigkeiten aus Polen entbehrten diese Berichte nicht jeglicher Grundlage. Reverend Douglas Ord auf Guernsey schreibt in sein Tagebuch:
»Es ist, als wäre dies das Ende der Welt – oder von dieser kleinen Welt zumindest. 20. Juni. Der gestrige Abend war für die Anmeldung zu knapp. Menschenmassen belagerten das Polizeirevier (Constables office) und der vorgeschlagene Zeitplan lief aus dem Ruder. Im Schutz der Dunkelheit verließen die Kinder die Inseln. Nun, seit Tagesanbruch führen alle Wege nach St. Peter Port. Tausende drängen sich in den Straßen. Das normale Leben ist vollständig lahmgelegt. Überall hört man die gleichen Fragen: ›Was sollen wir tun?‹ und ›Wohin sollen wir gehen?‹
InderLefebvreStreetbildetensichschonum6UhrinderFrühlange Schlangen, die Straße war voll mit Menschen, so dass es fast unmöglich war, sich zu bewegen. Wer zur Anmeldung kam, musste sich anstellen, die Warteschlange füllte die gesamte Straßenlänge. Wer ohnmächtigwurde,konntenurmitMüheundNotärztlichbehandeltwerden. Was für ein leichtes Ziel für Luftangriffe! Es wurden aber keine Befehle zur Auflösung der Menge gegeben. Die Anweisung zur Registrierung war so abgefasst, dass viele glaubten, die Anmeldung sei obligatorisch. Daher meldeten sich viele vorsichtshalber an – ich tat das auch, obwohl sich dann zeigte, dass das gar nicht notwendig war. Mr. Sherwill tat sein Bestes und sprach von Vorbereitungen, die getroffen würden, und fügte hinzu, dass es äußerst unwahrscheinlich sei, dass die ganze Menschenmasse aus Guernsey hoffen könne, evakuiert zu werden. Männer im wehrfähigen Alter sollten freiwillig nach England gehen und dort ihrer Pflicht nachkommen. Wer bleibt, dem droht Sklavenarbeit, das sei jedoch nach Sherwills Meinung eher unwahrscheinlich. Er sagte, er wisse wirklich nicht, ob die Deutschen auf die Insel kommen würden. Vielleicht könnten wir schließlich doch der Härte einer Besetzung entkommen. Die Ernährungsfrage würde wohl das ernsthafteste Problem darstellen, dem wir uns stellen müssten. Deshalb die Evakuierung der jungen Leute. Und mit weiteren solchen aufmunternden Worten schickte er die Leute weg.«
Eine sehr dunkle und zweideutige Botschaft des Attorney Generals. Die Menschen waren sich unsicher, was sie tun sollten. Am besten ginge man auf Nummer sicher. Es fand eine Massenevakuierung statt: 17 000 von 42 000 Menschen auf Guernsey verließen die Insel; 6500 von 50 000 auf Jersey, auf Alderney blieben nur 19 übrig, 129 von 600 verließen Sark. Es war eine furchtbare Zeit für die Insulaner, insbesondere auf Guernsey, wo eine richtiggehende Panik ausbrach und es an klaren Anweisungen von Seiten der Inselführung mangelte.
Zwar wussten die Menschen nicht, was sie genau machen sollten, aber man war im Allgemeinen der Ansicht, dass es besser war, die Inseln zu verlassen. Die Kinder sollten zuerst gehen. Eine Menschenmenge stürzte zum Hafen von St. Peter Port, um auf ein Boot zu gelangen, das Richtung Westen aufbrach – wenn denn eines zu finden war; so erinnert sich Eileen du Mouilipied: »Ich war gerade eingeschult worden und werde nie das Durcheinander vergessen, das im Klassenzimmer herrschte. Ich bekam eine Gasmaske und ein Namensschild, das ich an meinen Mantel heften musste, und dann war auf einmal wieder alles anders, wir wurden nach Hause geschickt, weil das Boot nicht gekommen war, das uns mitnehmen sollte.« Stanley Martin berichtet: »Sie wussten nicht, was passiert war, sie hatten keine Ahnung, ob das Boot noch kommen würde, um uns zu holen, der Rektor sagte, es tut mir leid, ihr müsst alle nach Hause und morgen früh um 2 Uhr wiederkommen, also gingen wir alle zurück, meine Mutter und mein Vater brachten mich zur Schule und da waren eine Menge Menschen und Busse, die auf uns warteten, das war in der Morgendämmerung, es wurde schon hell.«
Eileen und Stanley gelang es möglicherweise, wegzugehen, aber drüben auf Jersey erinnert sich Marion Rossler an Folgendes: »Wir blieben. Ich glaube, meiner Mutter ging es nicht sehr gut, aber ich weiß nicht, ob es nicht nur eine Ausrede meines Vaters war, um bleiben zu können. Er war durch und durch überzeugter Jerseyer und wollte nicht gehen, obwohl wir die Möglichkeit dazu hatten.«
Aber 6500 Menschen aus Jersey verließen die Insel so schnell wie möglich: »Wir sahen Autos runter zum Pier fahren, Menschen herausstürzen und Koffer hinter sich herziehen, die Wagen wurden mit offenen Türen und Zündschlüssel stehengelassen und sie eilten einfach auf die Boote, so war das.« (Leo Harris) Wer entschieden hatte zu bleiben, befand sich nun in einer gefährlichen Situation. Einer viel gefährlicheren Situation, als er ahnen konnte. Die beiden Bailiffs waren nämlich nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass man die Deutschen über die Entmilitarisierung der Inseln bisher noch nicht informiert hatte. Die Insulaner waren vollkommen wehrlos. Die Inseln stellten in den Augen des Feindes weiterhin ein legitimes Angriffsziel dar. Ihre einzige Verteidigung vor einem Angriff war, paradoxerweise, dass sie keine Verteidigung hatten. Das wussten die Deutschen aber nicht. Sie nahmen vielmehr an, dass auf den Inseln Truppen in Garnison lagen und sie aufs Äußerste verteidigt werden würden. Dementsprechend mussten sie handeln.
Samstag, der 22. Juni
Die Stabschefs verlangten, dass das Außenministerium (Foreign Office) dem Feind gegenüber pro forma die Entmilitarisierung der Inseln deklariert. Eine Pressemitteilung wurde erstellt, aber mit der Begründung zurückgehalten, dass die Deutschen diese als eine offene Einladung sehen und einfach einmarschieren würden. Auch zu diesem Zeitpunkt gab es demnach keine offizielle Erklärung. Die Inseln waren für die Deutschen weiterhin legitime Angriffsziele.
Montag, der 24. Juni
Eine Nachricht des Königs, Georg VI., erreichte die Inseln: »Aus strategischen Gründen wurde es für notwendig befunden, die Streitkräfte von den Kanalinseln abzuziehen. Ich bedauere diese Notwendigkeit zutiefst und möchte meinen Untertanen auf den Inseln versichern, dass meine Regierung bei dieser Entscheidung Ihre Lage in Betracht gezogen hat. Dieser Schritt ist in der augenblicklichen Situation in Ihrem besten Interesse. Die lange Verbindung der Inseln mit der Krone und die treuen Dienste, die die Menschen der Inseln meinen Vorfahren und mir erwiesen haben, garantieren, dass das Band ungebrochen bleiben wird, und ich weiß, dass mein Volk auf den Inseln mit der gleichen Zuversicht, mit der auch ich in die Zukunft blicke, auf den Tag, an dem die entschlossene Stärke, mit der wir unseren gegenwärtigen Schwierigkeiten entgegentreten, die Frucht des Sieges ernten wird.«
Die Nachricht wurde begleitet von einer verwaschenen Anweisung, wie die Nachricht den Insulanern zu kommunizieren sei: »Auf eine solche Weise, wie es Ihnen ratsam scheint, in Anbetracht der Interessen der nationalen Sicherheit.« Mit anderen Worten: so wenige Menschen wie möglich sollten davon erfahren – aus Angst, der Feind könnte ansonsten von der Entmilitarisierung Wind bekommen. Das führte dazu, dass nur wenige Insulaner von der Nachricht des Königs und dem kleinen Trost, der darin enthalten war, Kenntnis bekamen. Sie wussten nichts von der Sorge und dem Anliegen des Königs, die er während dieser entsetzlichen Zeit geäußert hatte. Ihr Eindruck, zurückgelassen worden zu sein, war damit besiegelt.
An diesem Tag gab es weiterhin keine formelle Deklaration der Entmilitarisierung. Die Stabschefs wiederholten abermals ihren Vorschlag, dass das Außenministerium eine solche Erklärung liefern sollte. Es fand eine Sitzung statt. Das Thema wurde besprochen. Erneut war man der Meinung, dass eine solche Deklaration einer offenen Einladung an den Feind gleichkäme, die Inseln zu besetzen. Nicht diskutiert wurde allerdings eine andere Möglichkeit, nämlich dass die Deutschen auch ohne eine solche Deklaration und dann durchaus angriffslustig einmarschieren könnten.
Außerdem wurde in dieser Sitzung beteuert, und das auf eine durchaus paradoxe Weise, dass eine formelle Deklaration der Entmilitarisierung gar nicht notwendig sei, da die Deutschen womöglich durch ihr Spionagenetzwerk bereits davon erfahren hatten. Dem war aber nicht so. Ihr Geheimdienst war nicht dermaßen effizient. Die Deutschen hatten die Inselzeitungen nicht gelesen, sie hatten keine Spione imParlamentderInseln–undsiehattendieNachrichtdesKönigsnicht vernommen. Die Deutschen wussten von nichts, obwohl sie unter den Ersten hätten sein sollen, die von der Entmilitarisierung erfahren. Die Inseln blieben in den Augen der Deutschen eine militärische Zielscheibe – und die Zeit lief ihren Bewohnern davon.
Freitag, der 28. Juni
Es war ein schöner, sonniger Tag. Die Inseln lagen in der sommerlichen Hitze. Die Kinder spielten an den Stränden. Unten an den Hafenanlagen von St. Helier und St. Peter Port standen Lastwagen in einer Reihe, um die Schiffe mit Kartoffeln und Tomaten zu beladen. Auch auf Guernsey wurden gerade Rinder abgeladen, die auf Alderney zurückgelassen worden waren und von einer Einsatztruppe aus Guernsey gerettet werden konnten. Eine große Versammlung war geplant, bei welcher Major Ambrose Sherwill, der Attorney General, eine Rede halten wollte.
DieBomberkamenamfrühenAbend–zuerstnachJerseyunddann nach Guernsey. Zunächst wurden die Lastwagen bombardiert, dann wurde der gesamte Frachthafen mit Maschinengewehren beschossen. Das Guernsey-Rettungsboot wurde auf seinem Weg nach Jersey angegriffen. Der junge Sohn des Bootsführers, Harold Hobbs, wurde dabei getötet.
Insgesamt kamen 44 Menschen ums Leben. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass niemand getötet worden wäre, hätte der Feind durch eine formelle Erklärung von der Entmilitarisierung erfahren.
Um weitere Bombenangriffe zu vermeiden und ein weiteres Gemetzel zu verhindern, war es nun unabdingbar, die Entmilitarisierung zu deklarieren. Ambrose Sherwill bekräftigte dies. Das hatte den erhofften Effekt. An diesem Abend, um 21 Uhr, wurden die Inseln in den BBC-Nachrichten zur entmilitarisierten Zone erklärt. Wie es das Schicksal wollte, hat es der so hochgepriesene Geheimdienst der Deutschen verpasst, die Übertragung abzuhören.
Sonntag, der 30. Juni
An diesem letzten Sonntag des Monats wurde schließlich das Außenministerium aktiv. Man tat das, was schon in den letzten zwei Wochen hätte getan werden sollen: Der Botschafter der (weiterhin neutralen) Vereinigten Staaten in London, Joseph P. Kennedy, wurde gebeten, den Deutschen über die US-Botschaft in Berlin einen Bescheid zu übermitteln, in dem es hieß: »Die Inseln wurden entmilitarisiert und stellen kein legitimes Ziel für Bombardements dar.«
Es war falsch und gefährlich, den Deutschen die Entmilitarisierung vorzuenthalten. Diese Zurückhaltung hätte bestenfalls dazu führen können, dass die Deutschen – in dem Glauben, die Inseln würden verteidigt – ihren Angriff um wenige Stunden verzögert hätten, um dann, falls gewünscht, voranzurücken. Nur aufgrund dieser wenigen Stunden wurdedenDeutschengegenüberkeineangemesseneundklareAnsagegemacht. Folglich waren die Kanalinseln ein offenes Ziel und anfällig für den Angriff, der am 28. Juni erfolgte. Nicht die Sicherheit und das Wohlergehen der Insulaner war, wie man vermuten könnte, die Hauptsorge der britischen Regierung gewesen. Sie wollte vielmehr eine Invasion durch die Deutschen um ein paar wenige Tage hinauszögern.
Die Insulaner zahlten einen hohen Preis für dieses Durcheinander von Prioritäten, entstanden aus einer verständlichen Panik und Verwirrung. Lord Portseas Vorwurf, die Insulaner seien »verraten« worden, war begründet. Wie sehr sich die britische Regierung ihres Fehlverhaltens bewusst war, ist entscheidend für das Verständnis ihres Benehmens gegenüber den Insulanern, als es am Ende des Krieges zur Abrechnung kommen sollte.
Dieser Tag sollte indes noch fünf Jahre auf sich warten lassen.
II.
Bomben fallen
Der Bailiff von Jersey, Alexander Moncrieff Coutanche, hatte ganz Recht mit seiner Einschätzung vom 14. Juni 1940. Der alles überrennende Vormarsch der Deutschen über die Seine würde nicht an der französischen Küste Halt machen. Ohne Zweifel würden sie versuchen, diewenigenMeeresmeilenzuüberqueren,umaufdenKanalinselneinzumarschieren und sie zu besetzen. In einer dringenden Anordnung verkündete Hitler klar seine Entschlossenheit, diese kleinen TeileGroßbritannienseinnehmenzuwollen.Erwarsichbewusst–wasfür London nicht immer der Fall gewesen zu sein scheint –, welch enormen Propagandawert es haben würde, wenn deutsche Stiefel auf britischem Boden marschierten. Dies wäre ein gewaltiger Triumph für Hitler und das Dritte Reich, eine glorreiche Eröffnungsszene für den Schlussakt des Krieges im Westen, der, was mit Zuversicht erwartet wurde, binnen weniger Monate, wenn nicht Wochen, enden sollte.8
Abgesehen von dem kaum zu bezweifelnden Propagandawert einer solchen Besetzung, unterschied sich auch die Einschätzung der Deutschen über den strategischen Wert der Inseln sehr von jener der Briten. Wie wir bereits gesehen haben, war der königliche Generalstab in London davon überzeugt, dass die Kanalinseln für beide Parteien innerhalb dieses Konflikts von geringfügigem strategischen Nutzen waren, ja mehr noch: dass sie aufgrund ihrer geografischen Lage gar nicht zu verteidigen waren. Diese Ansicht war nicht neu – sie bestand bereits seit 1932. Man hatte sich einige Gedanken darüber gemacht, die Inseln mit militärischen Schutzmaßnahmen zu versehen, als die Kabelleitung, die England über die Kanalinseln mit Frankreich verband, noch eine funktionsfähige Installation war. Aber mit den Deutschen an der Küste der Halbinsel Cherbourg wurde ihre Benutzung hinfällig und sie wurde am 13. Juni gekappt. Es wurden auch einige Versuche unternommen, die Seehäfen und Flughäfen der Inseln zu sichern, um die Evakuierung der besiegten britischen und französischen Truppen aus Frankreich zu gewährleisten; diese waren aber alle bis zum 20. Juni abgezogen worden. Zu dieser Zeit hörten die Kanalinseln auf, in strategischer oder sonstiger Hinsicht für die Briten von Bedeutung zu sein. Es waren keine Truppen mehr da, weder Häfen noch Flughäfen waren in Betrieb, noch mussten Kommunikationssysteme gesichert werden. Die Inseln waren vollständig entmilitarisiert, aber die Deutschen wussten nichts von dieser (für sie glücklichen) Sachlage.
Das deutsche Oberkommando sah in den Kanalinseln tatsächlich eine durchaus reale und sehr nahe Bedrohung für ihre westliche Flanke, denn von den Inseln aus hätten Angriffe auf das französische Festland gestartet werden können. Eine Besetzung der Kanalinseln wurde daher nicht nur aus propagandistischen Gründen angestrebt, sondern hatte auch aus einem militärischen Sachzwang zu erfolgen. Daher mussten Antworten auf zwei Fragen gefunden werden: (1) »Wie gut werden die Inseln verteidigt?« und (2) »Welche Art von Einsatzkräften werden wir benötigen, um sie einzunehmen?«
Zur Beantwortung der ersten Frage startete die Luftwaffe Aufklärungsflüge, um die Inseln zu beobachten und zu fotografieren. Wären die Deutschen informiert worden über die am 15. Juni getroffene Entscheidung der Briten, die Inseln zu entmilitarisieren, hätten sie gleich beide Fragen mit einem Schlag beantworten können: Die Inseln werden nicht verteidigt und es werden daher keine großen Einsatzkräfte benötigt, um sie zu besetzen. Leider waren die Deutschen uninformiert und führten ihre Erkundungsflüge fort als Vorbereitung für den Start von Operation Grüner Pfeil, um die kleinen Stücke Großbritanniens für AdolfHitlereinzunehmen.DieAufklärungsübungenfördertenverschiedene, widersprüchliche Resultate zutage:
Ja, auf Jersey, Guernsey und Alderney gab es mehrere, militärischen Anlagen ähnliche Einrichtungen, aber – wie Michael Ginns,9 der namhafte Experte in Fragen der Besetzung bereits hervorgehoben hat – viele der Aufnahmen wurden aus so großer Entfernung gemacht, dass es oft unmöglich war, das korrekte Baujahr oder ihre Leistungsfähigkeit zu bestimmen. Viele, wenn nicht die Mehrheit der militärischen Installationen, Festungen und Kanonentürme auf den Inseln waren über ein Jahrhundert zuvor während der Napoleonischen Kriege erbaut worden. Das Problem, sie exakt zu identifizieren, erschwerte es, die Inseln im Hinblick auf ihre Verteidigungsfähigkeit angemessen zu bewerten. Obwohl nicht ein einziger Schuss auf die Beobachtungsflugzeuge abgefeuert wurde, während sie über die Inseln flogen, schlossen die Deutschen daraus keineswegs, dass die Inseln nicht verteidigt wurden. Sie nahmen vielmehr an, dass die Inselgarnisonen ihre Positionen nicht preisgaben und auf der Hut waren.
Am 28. Juni hatten die Deutschen nach wie vor keine gesicherte Kenntnis über den militärischen Status der Inseln. Sie hatten bis dato keine korrekte und offizielle Information über den wehrlosen Zustand der Inseln bekommen. Sie wussten daher nicht, dass die Kanalinseln eine entmilitarisierte Zone darstellten. Die Deutschen glaubten, dass hartnäckigere Methoden angewandt werden mussten, um herauszufinden, was auf den Inseln vor sich ging. So kam es, dass am Nachmittag des 28. Juni Heinkelbomber in Cherbourg abhoben, um eine »bewaffnete Aufklärung« durchzuführen. Die Mission war: Bombenangriffe auf St. Helier und St. Peter Port. Das Ziel: eine Gegenwehr zu provozieren, deren Ausmaß den Invasoren die tatsächliche Verteidigungskapazität und Bewaffnung der Inseln offenbaren würde.
Das für diese »bewaffnete Aufklärung« verwendete Flugzeug war die Heinkel He 111, der von der Luftwaffe zu Anfang des Krieges am meisten verwendete Bomber. Dieser zweimotorige Mittelstreckenbomber war, mit einer Spitzengeschwindigkeit von 330 km pro Stunde bei voller Beladung, zugestandenermaßen etwas langsam. Aber er war mit dem mörderisch effizienten 7,92 mm Maschinengewehr ausgestattet, dem MG15, das mit einer Frequenz von tausend Schuss pro Minute feuern konnte, jede Kadenz mit einer Geschwindigkeit von 2721 km/h. Kein Zweifel, die Heinkel He 111 war eine höchst wirkungsvolle Killermaschine. Das konnte sie an jenem Sommerabend des 28. Juni unter Beweis stellen, als sie sich auf die Inseln stürzte: bombardierend, beschießend, tötend.
Die Piloten konnten Mary, Bernard und Eva womöglich nicht sehen, wie sie sich unter einer Bank kauernd am Hafen von La Rocque (Jersey) versteckten. Die Kinder aber sahen sie:
»Wir sahen die Flugzeuge. Mary Roberts, Bernard und ich standen da. Wir hatten den ganzen Tag am Strand verbracht, waren geschwommen. Mr. Gallichon, den alle Kinder Onkel Frank nannten, war auch da. Er zog uns unter die Bank, um uns zu schützen, sonst wären wir automatisch die Straße entlang nach Hause gelaufen. Wir blieben dort, bis alles vorbei war, dann ließ er uns gehen. Unsere Mutter steckte uns unter das Bett, noch bevor sie mit den Maschinengewehren schossen. Sie flogen im Kreis, schossen auf alles. Wir gingen dann runter zu Mrs. Mauger, um dort über Nacht zu bleiben, falls sie zurückkommen würden. Nach dieser Erfahrung hatte ich lange Zeit Angst vor Flugzeugen, hätte mich am liebsten unter dem Tisch versteckt – und auch jetzt mag ich sie nicht, mir dreht sich dann alles.«
Yvonne Bouteloupe erzählt von ihrer Mutter und ihrem Bruder, die wie durch ein Wunder entkamen:
»Ich wartete darauf, dass mein Bruder und meine Mutter nach Hause zurückkehrten. […] Ich stand gerade an der Türschwelle unseres Hauses, das sich auf der anderen Seite von La Rocque befindet, als ich drei Flugzeuge sah. Ich dachte, es handle sich um jene Flugzeuge, die ich früher am Tage gesehen hatte, wie sie Richtung Frankreich flogen, und ich dachte, es seien dieselben, die jetzt zurückkehrten. Plötzlich hörte ich diesen pfeifenden Ton und – boom! – boom! Ich wusste, wir werden bombardiert. Ich rannte zurück den Gang hinunter zu meiner Großmutter, die in der Küche saß. Sie war gehbehindert und wäre sowieso nirgends hingegangen, und ich versteckte mein Gesicht in ihrem Schoß und schrie: ›Großmutter, sie bombardieren uns!‹ Später schossen sie mit Maschinengewehren. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, wo mein Bruder und meine Mutter waren, ich machte mir große Sorgen. Später kehrten sie nach Hause zurück und es stellte sich heraus, dass sie wegen des Vorstellungsgesprächs bei Mr. Gallichon gewesen waren. Eddie sollte zur Lehre angenommen werden. Auf ihrem Rückweg hatten sie ihre Fahrräder abgestellt, um mit dem Major zu sprechen, der dort auf einen Bus wartete. Sie sind dann weitergegangen, weil es Zeit war, nach Hause zu gehen. Als sie mit ihren Fahrrädern um die Ecke fuhren, fingen die Bombardierungen an und Mutter sagte ›Oh! Komm schon Eddie! Wir müssen uns beeilen!‹ Als die Flugzeuge zurückkamen und schossen, warfen sie ihre Fahrräder weg auf die Straße und versteckten sich dort im grünen Gebüsch.
Als meine Mutter wieder im Haus war, erkannte sie erst, wie knapp sie dem Tod entkommen war, denn sie hatte Löcher am Ärmel ihres (neuen) Mantels, durch welchen ein Geschoss gegangen war – und sie rief, ›noch dazu dieser Mantel!‹ Aber keiner von beiden war verletzt. Wir verließen das Haus nicht bis zum nächsten Morgen, als die Flugblätter ausgeworfen wurden. Wir erfuhren, dass die arme Mrs. Kitchen von einer direkt durch das kleine Spülküchenfenster fliegenden Kugel am Hals getroffen worden war. Mutter fand Einschusslöcher an den Wänden – vor allem am Montag, als wir große weiße Laken raushängen mussten, das wurde in den Flugblättern angeordnet. Wir halfen Mutter. Eddie stieg mit ihr auf das Dach, um die Laken am Schornstein festzumachen und ich lehnte mich aus einem Dachbodenfenster und machte einen Knoten, damit sie der Wind nicht wegweht. Da sah sie die Einschusslöcher. Wir hatten Glück gehabt!«
An jenem Abend des 28. Juni saß ein gewisser W. Bertram Payne, ganze 18 Jahre alt, mit seiner Mutter an der Granit-Ufermauer gegenüber dem elterlichen Bauernhof in Grouville, der den exotischen Namen Côte d’Or hatte, wenige Schritte entfernt von der Nordseite vom Hafen La Rocque. Es war 18.45 Uhr: »Ich war dabei, einige Sachen mit meiner Mutter zu besprechen – über den Bauernhof und Ähnliches, und sie sagte, ›Sieh!‹ und im gleichen Moment sah ich drei Punkte am Himmel hinter dem Seymour-Turm. Sie kamen direkt auf uns zu und wurden größer, und sie kamen aus Richtung der französischen Küste. Ich dachte, es wären Deutsche. Wir rannten beide über die Straße (La Grande Route des Sablons) und wir kauerten uns hinter der Hecke zusammen, die unsere Stelle von der Uferstraße trennte. Kein wirklicher Schutz, wenn man es bedenkt! Dann hörten wir die Flugzeuge und plötzlich geschah alles blitzschnell. Man hörte einige wirklich sehr laute Knalle, Bomben fielen und das Geräusch von Ziegeln, die von den Dächern herunterschlitterten und herumgeschleudert wurden. Als Nächstes gingen wir zur Slipanlage unten am Hafen, wo sich einige Menschen aufhielten, die wir kannten. Ein Besucher, der dort auf einen Bus wartete, wurde getötet, und gegenüber der Straße, an einer Hütte, die man Harbour View nennt, war einer der hiesigen Luftschutzbeauftragten, Mr. Thomas Pilkington, getroffen worden und lag tot bei der offenen Tür. Dort lag auch Mrs. Farrel, aus ihrem Hals strömte Blut. Ich nahm den Traktor, wir wickelten sie in einer Decke ein und legten sie auf den Rücksitz, aber sie verblutete, bevor wir ihr ärztliche Hilfe holen konnten.«
Nachdem die Heinkelbomber La Rocque bombardiert und beschossen hatten, flogen sie langsam hinunter zum Hafen von St. Helier. Sie benötigten mehr als eine Minute, um dorthin zu gelangen. Dort sahen sie eine Reihe von Lastwagen. Man war dabei, die Jersey-Kartoffeln von den Lastern auf ein Frachtschiff zu laden. Aber die deutschen Piloten wussten das nicht. Wie sie bereits bei früheren Aufklärungsflügen vermutet hatten, nahmen sie auch diesmal an, dass es sich um militärische Fahrzeuge und damit legitime Angriffsziele handelte. Erst bombardierten sie die Lastwagen, dann nahmen sie sie unter Beschuss.
Einige Jachten und kleinere Boote am Hafen wurden zerstört. Elf Menschen wurden getötet und neun wurden entweder von Granatsplittern der explodierenden Bomben oder von den Schüssen der tödlichen MG15-Maschinengewehre verletzt. Am Hafendamm selbst wurden drei Menschen getötet, Mr. L. Bryon, Mr. W. Moodie und Mr. R. Fallis.
Mit dem letztgenannten Robert Fallis hängt eine überaus traurige Geschichte zusammen. Er war als Zollwächter verantwortlich für die Einnahme der Hafengebühren, die beim Anlegen der Schiffe im Hafen fällig wurden. Diese Arbeit zog eine angenehme Vergünstigung nach sich: Er konnte eine bescheidene, aber komfortable Wohnung am oberen Promenadenweg von Albert Pier bewohnen. Als Fallis sterbend am Hafen lag, fand eine Blitzattacke ganz anderer Art am Albert Pier statt. Jemand hatte es gezielt auf das kleine Haus des Zollwächters abgesehen: Er nutzte nämlich die Gelegenheit, bei diesem von den Deutschen erzeugten Durcheinander unbemerkt in Fallis’ Wohnung zu schleichen, eine Golduhr, verschiedene Wertgegenstände und acht Pfund zu entwenden – und sich davonzumachen. Zu dieser Zeit waren acht Pfund eine Menge Geld. Es war das Dreifache der Summe, die Mr. Fallis in der Woche als Lohn erhielt. Die Evening Post vom 3. Juli 1940 veröffentlichte einen Artikel mit der Schlagzeile »Verachtenswerter Dieb«, parallel dazu wurden Einzelheiten über die Beerdigung des Zollwächters mitgeteilt.
Der Angriff auf Guernsey war brutaler und schlimmer als derjenige auf Jersey. Die Zahl der Todesopfer war dreimal so hoch: 27 wurden getötet und 36 verletzt.10 Um 18.45 war der Kronanwalt Guernseys, Ambrose James Sherwill, gerade damit fertig geworden, die Fragen einer großen Menschenmenge zu beantworten, deren Befürchtungen er zu beschwichtigen versucht hatte. Er kehrte in sein Büro zurück und telefonierte mit Markbreiter vom Innenministerium:11 »In dem Moment, als wir gerade dabei waren aufzulegen, hörte ich das Geräusch von Flugzeugen und das Rattern von Maschinengewehren, die aus Richtung St. Samson kamen (sie beschossen wohl das kleine Dampfschiff Courier, das unterwegs war von Alderney nach Guernsey, beladen mit Schweinen, die von unseren Leuten auf Alderney nach der kompletten Evakuation der Insel zusammengetrieben worden waren). Ich erinnere mich, wie ich zu Markbreiter sagte: ›Hier kommen sie‹, und wie ich den Hörer an das offene Fenster hielt, sodass er es auch hören konnte.«
Die ersten Bomben fielen auf Guernsey am Freitag, dem 28. Juni 1940, um 18.54 Uhr. Wir können die Zeit so präzise bestimmen, weil eine dieser (ersten) Bomben auf die Brückenwaage des Hafens fiel und die Uhr genau zu dieser Zeit zum Stehen brachte. Die Piloten der drei Bomber sahen die Lastwagen am Hafen in einer Reihe aufgestellt, wie sie sie auch in St. Helier gesehen hatten. Sie nahmen an, dass die Lastwagen militärische Kriegsgeräte transportierten, was sie zu einem militärischen Hauptziel machte. Sie griffen mit Brandbomben und Maschinengewehrfeuer an. Es brach eine Panik aus. Die Menschen suchten Deckung unter der Anlegestelle. Es war ein Segen, dass Ebbe herrschte, ansonsten hätte es dort keinen Schutz gegeben. Die Fahrer der mit Tomaten beladenen Lastwagen waren schlimmer dran. Sie warfen sich unter ihre Fahrzeuge, in der Hoffnung, sich so vor dem deutschen Terror zu retten. Aber natürlich boten diese minderwertig konstruierten, größtenteils aus Holz bestehenden Lastwagen keinerlei Schutz. Ein Bombenhagel ging nieder. Mörderischer Beschuss folgte. Die vollen Tanks explodierten. Die Männer starben auf grausame Weise, ihr Blut mischte sich mit dem Saft der Tomaten, der über den Hafendamm rann und Pfützen bildete.
Es gab auch mutige Versuche, den Hafen zu verteidigen und gegen den Luftangriff anzukämpfen. Das kleine Postschiff Isle of Sark, das unter dem Kommando von Captain Golding stand, lag längsseits am Hafen von St. Peter Port, als die Luftwaffe angriff. Dem gegenwärtigen Kriegszustand entsprechend, war es grau gestrichen. Zudem war es mit vier automatischen Lewis-Maschinengewehren ausgerüstet. Die Schützen reagierten unverzüglich mit Sperrfeuer gegen die anfliegenden deutschen Bomber – und das mit solch einem Erfolg, dass weder die Isle of Sark selbst, noch ein anderes Schiff im Hafen ernsthaft beschädigt wurde. Dennoch wurde während des einstündigen Angriffs ein großer Schaden an der Brückenwaage und entlang der Esplanade angerichtet. Den Deutschen genügte das nicht und sie setzten die Beschießung an anderen Punkten der Insel fort. Dabei ging es nicht mehr darum, militärische Ziele aufs Korn zu nehmen.12 Sie fegten über die Insel, beschossen die Bauern beim Heumachen auf den Feldern, überhaupt jeden, der sich bewegte, genau so, wie sie es dann auf der Insel Sark machten.
Später hatte Ambrose Sherwill ein Gespräch mit dem eben angekommenen Deutschen Dr. Maaß: »Ich stellte Dr. Maaß wegen der Angriffe zur Rede. Er sagte, die deutschen Piloten hätten die mit Tomaten beladenen Lastwagen für militärische, mit Munition beladene Fahrzeuge gehalten. Ich fragte ihn dann, wie er erklären könne, dass das als solches klar gekennzeichnete Rettungsboot beschossen wurde. Ich erinnere mich, wie er mir erwiderte: ›Es gibt Irre in den Streitkräften aller Nationen.‹«
III.
Den Deutschen die Hände schütteln
Wie gehst du mit den Deutschen um, wenn die viel entscheidendere Frage lautet: Wie wird der Feind mit dir umgehen? Noch bevor die Truppen des Dritten Reichs die Kanalinseln überhaupt erreicht hatten, waren, wie bereits erwähnt, Geschichten von Grausamkeiten und Gewalttaten im Umlauf. Auf der Insel Alderney, die von allen Kanalinseln der französischen Küste am nächsten liegt, sammelte Frederick George French, Judge of Alderney, seine kleine Herde um sich. Er wollte nicht bleiben, um dann die Deutschen mit einem Handschlag begrüßen zu müssen. »Wir befinden uns in Lebensgefahr«, verkündete er, als die Deutschen immer näher rückten und man die großen Rauchwolken der brennenden Ölraffinerien auf der Halbinsel Cherbourg sah. »Was sollen wir tun?«, fragte er sie. »Lasst uns gehen«, riefen sie zur Antwort. So schnell als möglich verließen sie die Insel. Nahezu die gesamte Bevölkerung machte sich auf zum britischen Festland. Es blieb alles stehen und liegen, Haustiere, Hunde und Katzen trieben sich auf den Straßen herum, auf den Feldern verdursteten Pferde und nicht gemolkene Kühe wurden verrückt vor Schmerzen.13 Kaum ein Mensch blieb auf Alderney zurück, um diesen äußerst unwillkommenen Deutschen zu begegnen.
Auch Guernsey verlor viele Bewohner. Am 23. Juni hatten 17 000 von 42 000 die Insel verlassen, einschließlich der meisten Schulkinder. Das Oberhaupt der Gemeinde war zu diesem Zeitpunkt der 69-jährige Bailiff Victor Gosselin Carey, der – wie auch sein Amtskollege Alexander Coutanche auf Jersey – als kommissarischer Vizegouverneur vereidigt wurde. Carey hat bei niemandem je eine gute Presse gehabt. Seine Eignung für das Amt wurde von Beginn an in Frage gestellt, sein Führungsstil während der Besetzung als kollaborativ und feige kritisiert. Sein Enkel sagte, die Briten hätten am Ende des Krieges nicht gewusst, ob sie ihn hängen oder zum Ritter schlagen sollten, so umstritten war seine Amtszeit. Im Geiste der von der britischen Regierung betriebenen Aussöhnungspolitik billigten auch die Angehörigen der Befreiungseinheit Victor Careys Ritterschlag. Ambrose Sherwill gibt uns in seinem A Fair and Honest Book einen Eindruck davon, wie der Bailiff Carey wahrgenommen wurde: »Victor Carey war für das Amt des Bailiff nicht besonders geeignet. Als Kronanwalt habe ich manch eines seiner Plädoyers in Strafverfahren gehört. Ich weiß nicht, welche Wirkungen diese auf die Delinquenten auf der Anklagebank hatten, ich weiß aber, dass sie mir Angst machten. Seine Fähigkeit in der schriftlichen Darstellung war sehr mittelmäßig. Sein Sekretär Louis Guillemette14 und ich mussten ihn etliche Male aus einer misslichen Lage retten, etwa bei der Ausarbeitung der Vorworte für die Billets d’Etat, die er anlässlich der Einberufung von Staatsversammlungen ausfertigen musste.«
Allgemein hielt man Carey für zu alt und ungeschickt, um während der Besetzung für irgendetwas nützlich zu sein. In zwei uns bekannten Fällen hat er durch sein Handeln das Moralgefühl seiner Mitbürger verletzt und durch seinen Mangel an Rückgrat im Umgang mit der Besatzungsmacht Anstoß erregt.
Einmal war da die am 8. Juli 1941 veröffentlichte, das »Victory«-Zeichen betreffende Anzeige, die er selbst verfasst hat – ein deutscher Einfall war das nämlich nicht. Darin bot der Bailiff eine Belohnung von 25 Pfund für jeden, der Auskünfte über Personen liefern konnte, die auf den Inseln das V-Zeichen anbrachten. Das Angebot einer Belohnung, um die eigenen Landsleute wegen Widerstandshandlungen gegen die verhassten Deutschen zu denunzieren, war gewiss nicht der richtige Weg, um das eigene Ansehen zu verbessern oder den Respekt der Mitbürger zu gewinnen. Freilich wollte Carey durch diese Aktion lediglich die V-Kampagne, die epidemische Ausmaße angenommen hatte, zu einem völligen Stillstand bringen, um die Insulaner vor deutschen Repressalien zu bewahren. Seiner Ansicht nach handelte er »nach bestem Wissen und Gewissen, im Interesse der Einwohner«, schließlich eine Handlungsmaxime, die der Innenminister persönlich den beiden Bailiffs und Generalanwälten in einem Brief vom 19. Juni 1940 auferlegt hatte. Unglücklicherweise genügte Carey dieser Pflicht auf eine sehr ungeschickte Art und Weise, wie Sherwill bemerkte. Auch die Einwohner von Guernsey sahen in dieser Bekanntmachung keineswegs einen Versuch, sie zu schützen. Vielmehr empfanden sie diese anrüchige Einladung, mutige, den Besatzern Widerstand leistende Mitbürger gegen Geld preiszugeben, als Verrat. Für sie roch es nach Kollaboration.
Der Bailiff war kein beliebter Mann und er zog noch mehr Schmach auf sich, als er am 9. August 1941 eine weitere Bekanntmachung veröffentlichte, die jeden Insulaner betraf, der britische Agenten versteckt hielt: »Erhöhte Aufmerksamkeit ist auf die Tatsache zu richten, dass auf Grundlage der Verordnung über die Verhütung von Sabotagehandlungen vom 10. Oktober 1940 jede Person, die entflohenen Kriegsgefangenen Unterschlupf gewährt oder versteckt, mit dem Tode bestraft wird. Dasselbe gilt für das Verstecken und Beschützen von Angehörigen feindlicher Streitkräfte (besonders für Besatzungen von Landungseinheiten, Fallschirmjäger etc.). Wer diesen Personen zur Flucht verhilft, wird mit dem Tode bestraft.«





























