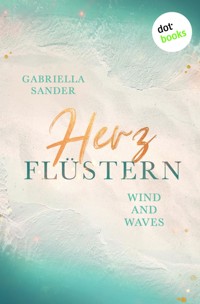6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie viele Rückschläge kann das Glück aushalten? Endlich glücklich sein – das ist es, was Leander sich vom Leben wünscht, doch glücklich ist er schon lange nicht mehr. Das Loch in seiner Seele füllt er mit Alkohol, Arbeit und oberflächlichen Affären, bis es bei einer rasanten Autofahrt zu einem Unfall kommt. Und das direkt vor Ellas Café, die ihm damit buchstäblich das Leben rettet. Während Ella sich einredet, bereits glücklich zu sein, versteckt sie sich in Wahrheit vor dem Leben – und davor, sich mit ihrer Fußprothese jemandem zu zeigen. Zu tief sitzt der Schmerz, den sie damit verbindet. Gerade als sich zwischen Ella und Leander Gefühle entwickeln, die sie beide nicht länger leugnen können, taucht ausgerechnet Leanders Exfreundin auf und Ella durchlebt ihren persönlichen Albtraum erneut ... Ein gefühlvoller New-Adult-Roman über zwei Menschen, die nach tiefen Verletzungen lernen müssen, sich selbst und einander wieder zu vertrauen – Für alle Fans von Anna Todd und Sarah Stankewitz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Über dieses Buch:
Endlich glücklich sein – das ist es, was Leander sich vom Leben wünscht, doch glücklich ist er schon lange nicht mehr. Das Loch in seiner Seele füllt er mit Alkohol, Arbeit und oberflächlichen Affären, bis es bei einer rasanten Autofahrt zu einem Unfall kommt. Und das direkt vor Ellas Café, die ihm damit womöglich das Leben rettet. Während Ella sich einredet, bereits glücklich zu sein, versteckt sie sich in Wahrheit vor dem Leben – und davor, sich mit ihrer Fußprothese jemandem zu zeigen. Zu tief sitzt der Schmerz, den sie damit verbindet. Gerade als sich zwischen Ella und Leander Gefühle entwickeln, die sie beide nicht länger leugnen können, taucht ausgerechnet Leanders Exfreundin auf und Ella durchlebt ihren persönlichen Albtraum erneut ...
eBook-Lizenzausgabe Januar 2026
Copyright © der Originalausgabe 2023 Bookapi Verlag, Kappenzipfel 4, 89312 Günzburg
Copyright © der Lizenzausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nina Hirschlehner
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (cdr)
ISBN 978-3-69076-333-2
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected] .
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Gabriella Sander
Hoffnungsleuchten: Ella & Leander
Roman
Für Dich! Du bist genug! Immer!
Kapitel 1: Leander
Ich konnte nicht fassen, was er mir gerade an den Kopf geworfen hatte, und stürmte aus seinem lächerlich dekadenten Büro. Warum tat er es immer wieder? Mir dieses Gefühl zu vermitteln, ich wäre ihm unterlegen.
»Eines Tages wirst du mir dafür danken, du wirst schon sehen«, waren die Worte, die ich noch hörte, als ich aus seinem Büro stolperte.
»Träum weiter«, äffte ich in Gedanken zurück. Warum, verdammt, ließ sich die schwere Bürotüre nicht zuknallen?
»Leander! Du kommst sofort zurück«, hämmerten seine Worte in meinen Ohren durch den Flur der Firma und bewirkten diesen ekligen Tinnitus, der seit Tagen wie ein kleiner Teufel in meinem Ohr saß.
Warum hatte ich mir das angetan? Mich wiederholt auf eine Diskussion mit ihm eingelassen? Eine, die ich niemals würde gewinnen können. Lieber würde er tot umfallen, als mir nur einmal, ein einziges verdammtes Mal in seinem Leben recht zu geben.
Mein Kopf hatte auf Autopilot geschaltet, als ich die vielen Stufen in Richtung Tiefgarage hinunter hastete. Nichts wie raus hier. Raus aus dieser Enge und diesem Spießbürgertum. Aus unzählbaren Vorschriften und Zwängen. Die dort wie verstaubte Ordner in Regalen standen, um einem dann im falschen Moment vor die Füße zu fallen und mit dem Finger auf einen zu zeigen. War es eine gute Idee, mit dieser Wut ins Auto zu steigen? Wenn man davon ausging, dass Wut am Steuer vergleichbar mit Alkohol zu unbedachten Reaktionen führt, wer würde die Frage dann mit »Ja« beantworten? Trotzdem öffnete ich die Tür und ließ mich schwer auf den Ledersitz fallen. Mein Puls raste bis zum Anschlag. Das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen, wurde übermächtig und ich öffnete hektisch den obersten Knopf meines Hemdes. In meinen Ohren rauschte das Blut wie ein Fluss nach sintflutartigem Regenfall.
Diese endlosen lächerlichen Diskussionen mit ihm. Dass ich sie hasste, war noch untertrieben. Sie liefen immer auf das Gleiche hinaus. »Leander mach dies. Leander du musst das …« Immer und immer wieder. Bis ich innerlich kotzte.
Wütend hämmerte ich auf das Lenkrad meines absurd teuren Sportwagens ein. Startete, öffnete das Dach und stieg aufs Gas. Der Motor röhrte und ließ meinen ganzen Körper vibrieren. Geübt ignorierte ich den nervigen Ton, der mir sagte, dass ich mich anschnallen sollte. Wut, die wild in meinen Adern pulsierte, riss mich mit und ich drückte aufs Gas, während die Musik von Linkin Park aus den noblen Boxen wummerte.
Der Streit mit meinem Vater hatte meinen Verstand vernebelt. Wirre Gedanken drehten in meinem Kopf wilde Loopings, als ich mit überhöhter Geschwindigkeit durch Hamburg bretterte. Ich wollte weg. Einfach nur weg. Aus diesen Verpflichtungen. Aus der Enge, die mir immer mehr die Luft zum Atmen nahm. Und vor allem dem Einfluss meines Vaters. Wiederholt fragte ich mich, warum ich nicht früher die Eier gehabt hatte, ihm zu widersprechen. Doch was er sagte, war Gesetz. Oder eher: Er war das Gesetz! So dachte er zumindest. Und so behandelte er mich. Es gab keine andere Option. Das hatte ich schon mit der Muttermilch aufgesogen. Nicht bei meinem Vater und dessen Vater und …
Es war der rote Faden im Winterfeldt–Clan, der sich durch alle Generationen zog. Der, dass man sich zu fügen hatte. Um nach Möglichkeit zu nicken und im Strom mitzuschwimmen. Und ich? Ich war so verdammt gut im Schwimmen. Ich hatte es über die Jahre perfektioniert. Zudem hatte ich das große Los gezogen. Den Jackpot. Weil ich der Älteste von zwei Söhnen war. Sagte das nicht schon alles? Auf mir ruhten die Blicke und unausgesprochenen Erwartungen der ganzen Winterfeldt-Immobilien-Sippschaft. Vermutlich mit meinem ersten Herzschlag hatte mein Vater beschlossen, dass ich die Firma eines Tages übernehmen sollte. Ob er sich manchmal selbst zuhörte?
»Eines Tages … Das glaubst du ihm doch nicht wirklich?«, höhnten mir meine Gedanken durch den Kopf, um sich zu einem wirren Knäuel zu formen und mich dann auszulachen. Weil ich genau wusste, dass er nie Wort halten würde. Denn er würde niemals das Zepter aus der Hand geben. Er musste immer und zu jederzeit die Kontrolle behalten. Trotz allem hatte ich das Spiel jeden verdammten Tag mitgespielt. Hatte das Büro-Bullshit-Bingo perfektioniert. Angepasst hatte ich meinen Platz eingenommen, in der abgestandenen Luft zwischen den vermeintlich Schönen und Reichen. Nebenbei hatte ich die Privilegien genossen, die ich dadurch hatte. Lächerlich schnelle, teure Autos, mein Penthouse, Partys und unverbindlichen Sex. Oh ja! Partys waren meine Spielwiese in diesem Anzugseinheitsgrau. Ablenkung von Bürostuhlquietschen und Betongeflüster. Beim Feiern versuchte ich all dem Trott zu entfliehen, und der Sex ließ mich wenigstens für kurze Zeit vergessen, wie erbärmlich mein Leben sich anfühlte. Die Namen der Ladys, mit denen ich eine schnelle Nummer schob, waren so austauschbar, wie sich ihre perfekte Fassade unter dicken Schichten von Make-up ähnelte.
Im Moment befand ich mich in einem Zustand, den man als normaler Mensch vermutlich als Beziehung bezeichnen würde. Doch normal kam ich mir schon lange nicht mehr vor. In meinem Inneren herrschte so etwas wie tiefster Winter. Und wie ich in diese Beziehung geraten war, war mir selbst nicht mehr klar. Vermutlich war zu viel Alkohol im Spiel gewesen.
Warum löste ich diese Verbindung nicht auf? Es war meiner Bequemlichkeit zuzuschreiben. Und mir schlichtweg egal. Mein Leben lief sowieso nicht in die Richtung, die ich mir wünschte. Da konnte ich die Leck-mich-am-Arsch-Haltung doch auch gleich weiter beibehalten. Und Romy? Sie war schön und perfekt. Zumindest nach außen. Und definitiv nicht wegen ihres wundervollen Charakters an meiner Seite. Ihr getünchtes Äußeres hatte einen sehr explosiven Kern. Sie war die Smalltalk-Königin und aus Champagnerflöten trinkend dauerlächelnd. Und wir zusammen waren seit ein paar Wochen das, was manche Menschen als Paar bezeichneten. In mir wehrte sich alles gegen diese Betitelung. Ich ließ mich nicht gerne einengen. Zumindest nicht auch noch in diesem Bereich meines Lebens. Romy arbeitete hart an unserem Traumpaar-Image. Die Fotos von uns in ihrem Instagram-Account waren bezeichnet mit #love und #couplegoals. Mich überkam jedes Mal dieses drückende Gefühl der Enge, das aus meinem Bauch in meinen Brustkorb schlich und mir dort die Luft zum Atmen nahm, wenn ich ihren Feed anschaute.
Es reichte doch, dass mein Vater diesen Part großzügig erledigte. Dieses nach außen mehr darstellen, als man in Wirklichkeit war. Vorzeigesohn hieß das, was ich sein sollte. Blender war, was ich von mir dachte.
Verdammt, konnte der Idiot vor mir nicht schneller fahren?
Womit ich wieder beim Stichwort war. Schneller. Die letzten Jahre waren an mir vorbeigerauscht. Atemlos und ohne viel nachzudenken. Es gab zu wenig Raum, um mich zu hinterfragen. Bis heute das Fass übergelaufen war. Ich hatte nur noch auf Autopilot funktioniert. Ich war ein funktionierendes Zahnrad im Getriebe, das nur deshalb weiterläuft, weil es muss. Weil es das schon immer so gemacht hat. Ich war ein Hamster im Rad. Ich rannte. Rannte und kam nie an. Schneller, immer schneller. Bis jetzt. Doch der Streit mit meinem Vater hatte etwas ins Rollen gebracht. Ein Stein aus Zweifeln und Fragen hatte sich in meinem Inneren gelöst und ich hatte die leise Ahnung, dass er eine Lawine auslösen könnte. Ich wusste nur noch nicht genau, was das bedeutete.
Der Klingelton meines Handys riss mich aus meinen Gedanken, die in meinem Kopf Achterbahn fuhren. Der Name meines Vaters erschien auf dem Display meines Cockpits. Mein Vater, mit dem ganz speziellen Gang. Dieses Bild hatte sich über die Jahre in meiner Erinnerung eingebrannt. Ich konnte ihn in meiner Vorstellung mit dem Telefon am Ohr in seinem Büro auf- und abgehen sehen. Die Schultern gestrafft, die Nasenspitze nach oben tragend, den Wohlstandsbauch im Hohlkreuz vor sich her schiebend.
»Was willst du denn noch? Warst du noch nicht fertig mit deiner Moralpredigt?«, nölte ich ins Telefon, nachdem ich widerwillig abgenommen hatte.
»Leander.« Die Stimme meines Vaters klang eisig. »Wie redest du mit mir? Hast du völlig den Verstand verloren, mitten im Gespräch abzuhauen?«
»Gespräch nennst du das? Echt jetzt? Für mich war es eher ein Monolog.« Ich hatte Mühe, meine Fassung zu wahren. Ich klammerte mich mit meinen Händen am Lenkrad fest, als wäre es ein untergehendes Schiff und ich kurz vor dem Ertrinken.
»Was für einen Blödsinn redest du denn da? Wie dem auch sei, du hast Verantwortung zu tragen. Und dieser musst du verdammt nochmal in deinem Posten gerecht werden. Alles, was ich die letzten Wochen bei dir beobachtet habe, ist egoistisches, rücksichtsloses Verhalten. Du schadest dem Ruf meiner Firma. Entweder du reißt dich ab jetzt zusammen, benimmst dich wie ein richtiger Winterfeldt und machst, was ich dir sage, oder …«
»Oder was?«, fiel ich ihm ins Wort.
»Oder du bist als Geschäftsführer entlassen. Deine Frauengeschichten und Saufeskapaden haben genug Schaden angerichtet.«
War das sein verdammter Ernst?
»Oh? Das tut mir leid. Danke, Dad. Vielen Dank auch. Hast du für einen Moment nachgedacht, warum das so sein könnte? Nein?« Meine Stimme triefte vor Spott und ich war an der Schwelle zum Ausrasten. »Danke für Nichts, Dad. Ich kann doch in deinen Augen absolut nichts richtig machen. NICHTS, verdammte Scheiße! Es reicht nie! Also lass ich es am Besten doch gleich bleiben! Da spare ich mir jede Menge Energie! Und du lässt mich jetzt verdammt nochmal in Ruhe! Ende der Durchsage!«
Ich drückte auf Auflegen und schrie vor Wut gegen die Windschutzscheibe. Mich beschlich immer mehr das fiese Gefühl, im falschen Film die Hauptrolle zu spielen. In den letzten Wochen hatte sich langsam, fast unscheinbar etwas verändert. Nach und nach merkte ich, wie meine mühsam errichtete Fassade aus funktionieren, ohne nachzudenken, am Abbröckeln war. Wie ich die Gefühle nicht weiter unterdrücken konnte, die sich in mir angestaut hatten. Das dumme Spiel meines Vaters nach noch mehr Besitz und Geld nicht mehr mitspielen wollte. Als ob er nicht schon genug hatte. Es reichte nicht. Nie. Er war wie besessen von der Gier. Sollte er doch seinen platt gesessenen Bürostuhl-Hintern mit den Scheinen polstern.
Wenn ich abends im Bett lag, wurden die Stimmen in meinem Kopf laut. Weil sie tagsüber kein Gehör fanden. Sie lieferten sich diese Streitgespräche in Endlosschleife in meinem Hirn und machten mich mürbe. Diese unterdrückte Stimme in mir, die die endlos langweiligen, oberflächlichen Gespräche hasste, die ich auf zahlreichen Events und Partys der Firma und Geschäftsessen führen musste.
Genauso wie diese von Arroganz geschwängerte Luft, die um all diese Menschen waberte. Die, je höher man stieg, immer dünner wurde.
Die andere Stimme wollte mich davon überzeugen, dass alles nach Plan lief und ich eines Tages den Platz meines Vaters einnehmen würde. Dass ich ohne das Geld und Ansehen eine Null war und nicht existieren konnte. Diese Stimme, die mich jahrelang im Glauben gelassen hatte, dass ich es weit nach oben schaffen würde. Und meine Probleme sich alle in Luft auflösen würden. Die, die mir immer wieder ins Ohr säuselte und Honig ums Maul schmierte, um mich dann in meinen schwachen Momenten wie ein abgenutztes Wäschestück fallen zu lassen. Ich war an einem Punkt, an dem ich ihr nicht mehr glauben wollte. Nicht glauben konnte.
In einem hatte sie allerdings recht. Was hatte ich schon vorzuweisen, außer als ein Winterfeldt geboren zu sein? Mein Studium? Wow, ich war so stolz auf mich, wieder einmal mehr das getan zu haben, was mein Vater von mir erwartete. Und nicht das, was ich wirklich wollte. Applaus, Winterfeldt. Und verdammt, ja, der plattgedrückte Büroarsch hatte teilweise recht mit seinen Anschuldigungen.
Schon lange hatte ich die Kontrolle über mein Leben verloren. Mir das jedoch nie eingestehen wollen. Den Frust und die Leere hatte ich wieder und wieder erfolgreich mit Alkohol heruntergespült. Es war nicht so, dass ich ohne Alkohol nicht existieren konnte. Und genau das klang wie die typische Ausrede eines Süchtigen. Wem machte ich hier etwas vor? Ich war ja nicht permanent betrunken. Trotzdem war es so, dass einige Promille im Blut mich vergessen ließen. Mich hin und wieder aus meinem selbsterwählten Gefängnis ausbrechen ließen.
Entschieden drückte ich noch mehr aufs Gas. Ich wollte mich endlich wieder spüren. Gefangen im Geschwindigkeitsrausch sah ich, wie erneut das Display aufleuchtete. Dad.
»Was willst du denn noch?«, schrie ich, ignorierte jedoch das Klingeln. Der Idiot konnte mich mal.
Während ich kurz mit der Hand Richtung Cockpit greifen wollte, um das Bild meines Vaters wegzudrücken, konnte ich gerade noch erkennen, wie ein Auto aus der Seitenstraße bog und mir die Vorfahrt nahm. Im Versuch, das Lenkrad herumzureißen, kam mein Wagen ins Schlingern. Dann lief alles ab wie im Film. Und ich war Zuschauer meines eigenen Dramas, in der ersten Reihe. Sequenzen, die surreal vor meinen Augen abliefen. In Zeitlupe und doch gleichzeitig ganz schnell. Ich spürte einen Aufprall an meiner Beifahrertür. Er erschütterte das gesamte Auto. Der Airbag platzte auf. Etwas Hartes schob sich gegen meinen Körper. Katapultierte mich aus meinem Sitz. Im nächsten Moment wurde ich in die Luft geschleudert. Drehte mich einige Male um mich selbst. Sah in Sekundenbruchteilen abwechselnd verschiedene Szenarien. Himmel. Asphalt. Blau. Grau. Bis ich auf genau diesem Grau aufprallte. Hart, erbarmungslos und kalt. Dann wurde es dunkel.
Weit entfernt hörte ich Verkehrslärm. Gedämpfte Geräusche. Hupen. Pochen. Schmerzen, Stimmen … Ich schmeckte Beton und Blut. Mir war speiübel. Alles war verschwommen. Wie hinter dichtem Nebel. Wo um alles in der Welt war ich?
Was war passiert? Wo …?
Ich öffnete die Augen, als ich das Bewusstsein wieder einigermaßen erlangte. Mein Schädel dröhnte, mein Körper schrie vor Schmerz, als mich jemand vorsichtig berührte. Ich lag in einer warmen Pfütze. Als meine Lider gerade wieder zufallen wollten, erkannte ich unscharf ein Gesicht, welches sich über mich beugte. Plötzlich waren da Augen, die mich beruhigend anschauten. Die grünsten Augen, die ich je gesehen hatte.
Da waren weiche Hände, die mich berührten und meinen Kopf hielten und eine warme Stimme, die sagte: »Halten Sie durch, Hilfe ist unterwegs.«
Dann ging in meinem Kopf erneut das Licht aus.
Kapitel 2: Ella
5 Minuten zuvor
Ich stand an der der Theke, meine braunen Haare locker zu einem Messy-Bun hochgesteckt und war dabei, einen Cupcake auf einen Teller zu legen. Das Café war gut gefüllt. Stimmengewirr vermischte sich mit leiser Musik und erfüllte die Atmosphäre. Wie ich es liebte, hier zu sein. Zwischen all den Menschen, die auf den alten, zum Teil abgewetzten Sesseln und Stühlen saßen. An Tischen aus Holz, die so alt waren, dass sie Geschichten erzählten. Von Menschen, die an ihnen gegessen hatten. Geredet, gelacht, gestritten hatten. Über die Jahre hatte ich die Einrichtung des Cafés aus verschiedensten Orten zusammengetragen. Schon lange, bevor ich wusste, dass ich das Café eröffnen würde.
Sammelleidenschaft nannte Oma das. Verrückt nannte Opa es. Gut, dass sie einen großen Keller hatten, in dem die Möbel über die Jahre untergestellt werden konnten.
An den Backsteinwänden hingen verschieden gerahmte und verschnörkelte Spiegelformen, die ich zwischen Bildern und alten Buchseiten angeordnet hatte. Das Licht der Lampen, die von den Decken hingen, spiegelte sich darin. Dieses Café war mein zweites Zuhause und es war, als würde man eine andere Welt betreten, sobald man einen Fuß über die Türschwelle setzte. Das hier war mein ganz eigenes Wohlfühluniversum, in dem die Welt in Ordnung war.
Lächelnd strich ich über den Tresen mit den vielen Gebrauchsspuren. Das alte Holz mit den unzähligen Kerben hinterließ ein wohliges Gefühl in mir. Tief atmete ich den Duft von frischen Kaffeebohnen ein und machte mich daran, die Bestellungen zu bearbeiten. Die hungrigen Studenten, die das Café bevölkerten, zeigten an, dass Mittagszeit war, und an den Tischen saßen zahlreich Gäste.
»Ella, ich brauch zwei Espresso«, riss Amy mich aus meinen Gedanken. Meine beste Freundin, seit ich meinen Namen in geraden Linien schreiben konnte. Meine rechte Hand in »Ellas-Welt«.
Ich hatte das Café vor gut einem Jahr eröffnet. Amy und ich hatten es gemeinsam zum Leben erweckt. Diesen Traum hatten wir gesponnen, als wir noch mit Zahnlücken Sprüche in Freundebücher geschrieben hatten. Und nun, viele Jahre später, hatten wir es geschafft, diesem Traum Leben einzuhauchen.
»Weißt du, Ella, ich hab sie alle durch. Alle Dating-Apps dieser Welt, vermute ich. Und jetzt schau mich an, ich bin immer noch single.«
Ich versuchte mich auf Toms Monolog zu konzentrieren, der mindestens einmal die Woche, wie so manch anderer Gast, bei mir am Tresen saß. Dem ich neben Café zubereiten und bedienen zuhörte. Wiederholt bekam ich lustig-tragische Dating-Geschichten serviert. Und ja, er tat mir leid.
»Hast du nicht vielleicht ein paar Freunde, die dich verkuppeln könnten?« Ich war großartig, anderen auf diesem Gebiet Ratschläge zu erteilen. Solange es mich nicht betraf, war alles okay.
»Willst du wissen, warum ich jede Woche hier bei dir am Tresen sitze?« Huch, was wurde das jetzt? »Weil ich mich entspanne, sobald ich einen Fuß über diese Türschwelle setze. Ohne Scheiß.«
Ich lächelte zufrieden.
»Danke«, sagte ich und schob ihm einen Café Americano vor die Nase. »Geht aufs Haus. Hoffentlich hilft es gegen deinen Dating-Frust.«
Mein Zwinkern quittierte er mit einem schiefen Lächeln.
»Omsi, kannst du bitte die Tagessuppe an Tisch sieben bringen?«, rief ich über meine Schulter in Richtung Küche.
Omsi war mein Kosename für Oma. Bei ihr und Opa war ich aufgewachsen. Sie war 76 Jahre alt, was sie nicht davon abhielt, uns auszuhelfen, wenn Not an der Frau war. Dann stellte sie sich ins Café und zeigte, dass man nie zu alt für was auch immer war.
Ich zuckte zusammen, als draußen ein blecherner Knall ertönte. Wie wenn eine Autopresse ein Fahrzeug zusammenfaltet, und das innerhalb Sekunden. Das Glas der Fensterscheiben vibrierte leicht.
Amy, die neben mir stand, zog erschrocken die Schultern hoch. Hektisch lief sie zum Schaufenster, an dem die ersten Gäste schon aufgeregt ihre Köpfe in Richtung Straße streckten.
Oma kam verwundert aus der Küche. »Was war das denn?«
Ich stellte mich irritiert auf die Zehenspitzen, um besser sehen zu können, was unmittelbar vor der Tür des Cafés passiert war.
»Ach du Scheiße!«, rief Amy schrill. Sie rannte Richtung Tresen zum Telefon. »Ich rufe einen Notarzt.« Die Panik in ihrer Stimme ließ meinen Puls schlagartig in die Höhe schnellen. Und dann funktionierte ich auf Autopilot.
Erschrocken ließ ich den Siebträger der Kaffeemaschine fallen, das Kaffeepulver flog in alle Richtungen und ich rannte zur Tür. Zwei total verbeulte Autos, die ineinander verknotet zu sein schienen, hatten sich quer auf die Straße geschoben. Eines davon musste ein Cabrio gewesen sein. Ein Mann lag auf der Straße, der von jeder Menge Blut umgeben war. Blut! Hilfe! Ich konnte doch kein Blut sehen, hatte aber keine Zeit, diesen Gedanken zu Ende zu denken. Der andere Mann saß noch im Auto und wurde von Passanten herausgezogen.
»Scheiße! Scheiße! Scheiße!« Die Worte sprudelten panisch aus meinem Mund, während ich auf die Straße rannte. Warum verdammt war mein Erste-Hilfe-Kurs gefühlte hundert Jahre her? Es gab keine Zeit zum Nachdenken, ich musste funktionieren. Sofort. Ich kniete mich neben den verletzten Mann und umfasste vorsichtig sein Gesicht mit meinen Händen. »Können Sie mich hören?«, redete ich auf ihn ein und er öffnete langsam seine Augen.
Er versuchte, etwas zu sagen, doch die Worte erstarben in seinem Mund, ehe er sie aussprechen konnte. Während ich ihm in die Augen schaute und versicherte, dass Hilfe unterwegs war, klammerte ich mich krampfhaft an die Reste meines kläglichen Wissens. Ich nahm das verdrehte Bein des Mannes wahr und mir wurde schlecht. Beruhigend redete ich weiter auf ihn ein. Bis mich kurz darauf das erlösende Geräusch des Rettungswagens aus meiner Panik riss.
Dann lief alles ab wie im Film. Sanitäter, die herumrannten und erste Hilfe leisteten. Ein Notarzt, der eine Infusion legte, ein Druckverband, der angelegt wurde. Eine Bahre, die in den Krankenwagen geschoben wurde, die Tür des Krankenwagens, die mit einem »Rums« geschlossen wurde.
Plötzlich klang alles dumpf in meinen Ohren. Die Stimmen und Geräusche hörte ich nur noch weit entfernt. Ich nahm ein Piepsen wahr und sämtliche Geräusche wirkten mit einem Mal wie in Watte gepackt. Mir wurde schwindelig und ich wollte mich setzen.
»Geht es Ihnen gut?«, hörte ich entfernt, wie unter Wasser, einen Sanitäter sagen.
Was passierte hier?
»Ich … ich … muss mich setzen. Mir ist so schlecht.« Die Worte fielen wie von allein aus meinem Mund. Ich war nicht mehr fähig, klar zu denken. Auf einmal wurde mir schwarz vor Augen und ich spürte zwei kräftige Hände nach mir greifen.
Dann riss die Erinnerung ab wie ein Faden und ich fiel in ein dunkles Loch.
Als ich meine Augen öffnete, lag ich im Büro des Cafés und blickte auf zwei Beine, die in die Luft gehoben wurden. Meine Beine?
Drei Augenpaare sahen mich besorgt an und in meinem Kopf begann es zu rattern, bis ich wieder in der Realität ankam.
Oma streckte mir ein Glas Cola entgegen. »Hier, trink. Du bist weiß wie eine Wand.«
Ein Sanitäter überprüfte meinen Puls und Blutdruck und erklärte mir, dass ich am Unfallort zusammengeklappt wäre.
»Oh, verdammt«, sagte ich schwach. »Geht es den Verletzten gut?«
Ich erinnerte mich an den Mann, der aus dem Cabrio geschleudert worden war. Sofort krampfte sich mein Magen wieder zusammen.
»Es ist alles gut, sie sind versorgt und auf dem Weg ins Krankenhaus«, beruhigte mich der Sanitäter.
»Wird … wird er durchkommen?«, hörte ich mich leise fragen.
»Es sieht gut aus. Er hat Glück gehabt. Trotz allem. Auch deswegen, weil Sie sofort den Notarzt gerufen haben.«
»Das ist gut.« Ich atmete erleichtert aus. »Zum Glück haben wir so was nicht jeden Tag vor dem Café«, sagte ich erschöpft an Amy und Oma gewandt. »Das brauche ich echt so schnell nicht wieder.«
Ich lächelte schwach und Oma und Amy nickten nur mit ernsten Gesichtern.
Kapitel 3: Leander
Als ich meine Augen öffnete, fand ich mich in einem Raum wieder, den ich nie zuvor gesehen hatte. Mein verschwommener Blick richtete sich auf sterile, hellblaue Schränke und in den tiefen meiner Erinnerung suchte ich nach einer Erklärung, weshalb ich hier lag.
Wo war ich? War ich auf einer Party gewesen? Hatte ich einen Filmriss gehabt? Warum lag ich in einem fremden Bett? Der Himmel konnte es nicht sein, da war ich mir fast sicher angesichts der hässlichen Schränke und ungemütlich kratzenden Bettwäsche. Mein Kopf schmerzte und meine Kehle brannte. Ich wollte mich bewegen, doch die Kabel, die überall an mir hingen, hinderten mich daran.
Kabel?
Auf einmal pumpte sich ein Gerät an meinem Arm auf, welches ein surrendes Geräusch von sich gab. Was zum Henker lief hier für ein Film? Ich fühlte mich wie nach einem Boxkampf mit K.o. und hatte bis gerade noch wirres Zeug geträumt. Mein Zeigefinger war in einer Klemme eingezwängt und ich fing an zu husten.
Das durchdringende Piepen eines Alarms ging los. Kurz darauf wehte eine Frau ins Zimmer, die mich besorgt anblickte. Warum verdammt konnte ich mich nicht erinnern?
Mein verwirrter Blick musste Bände gesprochen haben, denn ihre Sätze kamen betont langsam aus ihrem Mund. Als wäre ich ein kleines Kind. Oder schwer von Begriff. Oder beides.
»Sie hatten einen Unfall vor ein paar Tagen und wurden schwer verletzt hierhergebracht. Sie liegen auf der Intensivstation im Marienkrankenhaus«, hörte ich sie monoton sagen und identifizierte sie als Krankenschwester oder Ärztin. Sie checkte alle Monitore und überprüfte meine Vitalfunktionen, um kurz darauf den Raum wieder zu verlassen.
In meinem Kopf suchte ich nach Informationen zu meinem Unfall und die Erinnerung kam schemenhaft zurück. Erinnerungsfetzen an den Streit mit meinem Vater tauchten auf. All die hässlichen Dinge, an die ich mich nicht erinnern wollte.
Im selben Moment ging die Tür auf und als ich erkannte, wer es war, verließ ein tiefes Seufzen meine Kehle. Mein Vater, der einen grünen Umhang trug, rauschte herein. Er bot einen absolut merkwürdigen, lächerlichen Anblick. Die buschigen Augenbrauen quollen unter einer Haube, die er über der Glatze trug, hervor. Meine Tasche mit meinen persönlichen Sachen stellte er auf einem Stuhl ab, was bedeutete, dass er in meiner Wohnung gewesen war. Wie ich das hasste. Warum ausgerechnet er? Ich konnte es nicht ausstehen, wenn er in meinen privaten Dingen herumwühlte, vor allem mit dem Wissen im Hinterkopf, wie neugierig er war.
»Leander, du bist bei Bewusstsein, dem Himmel sei Dank.«
Bitte … was? Welchen Film spulte er jetzt ab? Ich wünschte mich augenblicklich in den wirren Schlaf zurück.
Erinnerte er sich nicht an unseren Streit? War nicht ich der mit der Kopfverletzung? Und was zum Henker sollte das geheuchelte Interesse?
»Dad.« Ich konnte nicht mal mit den Augen rollen, weil auch das schmerzte. »Was genau willst du hier?«, fragte ich nochmal und atmete hörbar aus. Selbst das Reden fiel mir schwer.
»Was soll diese dumme Frage?« Sofort wechselte seine Stimmung von vorgetäuschtem Interesse zu seiner gewohnt unterkühlten Art und seine Gesichtszüge verhärteten sich. »Wie oft, verdammt nochmal, habe ich dir schon gesagt, du sollst nicht so schnell fahren! Ich werde sofort veranlassen, dass du in eine Privatklinik verlegt wirst. Dieses Krankenhaus hier ist …« Er machte eine theatralische Pause. »Sagen wir es mal so, unter unserem Standard und absolut nicht unserer Vorstellung entsprechend.«
Hektisch zog er seine Augenbrauen hoch und sein Handy aus der Tasche und begann zu tippen.
»Echt jetzt? Das meinst du doch gerade nicht ernst, oder?«
Er reagierte nicht.
»Dad!« Ich versuchte es etwas lauter.
»Kannst du bitte damit aufhören?« Er ließ irritiert das Handy sinken.
»Es entspricht nicht deiner Vorstellung. Meiner aber schon, verstehst du das? Ich werde nirgendwo anders hingehen und ich möchte auch nicht, dass du dich darum kümmerst. Ich bin keine fünfzehn mehr.«
»Du kannst doch nicht ernsthaft meinen, dass du in diesem Krankenhaus bleiben willst? Du brauchst die beste Behandlung, um schnell wieder arbeitsfähig zu werden. Ich werde alles Notwendige sofort in die Wege leiten. Mach dir keine Sorgen, du brauchst dich auch um nichts zu kümmern.«
»Darum geht es also, ja? Wieder mal nur ums Geld? Echt jetzt? Du tauchst hier auf und alles, was dich interessiert, ist, wie schnell ich wieder arbeiten kann? Weißt du was? Ich will das nicht! Ich will verdammt nochmal nicht, dass du dich kümmerst und ich will auch nicht schnell wieder funktionieren, sondern gesund werden.«
»Wie kannst du nur so egoistisch sein, Leander? Denkst du nie an die Firma?«
»Okay, Dad. Du verstehst mich nicht. Vergiß es einfach, okay?« Resigniert stieß ich die angestaute Luft aus. »Kannst du bitte jetzt gehen? Ich brauch meine Ruhe und bin müde«, sagte ich, so laut es mir in meinem Zustand möglich war, was mir unendlich schwerfiel. Ich fühlte mich wie ausgekotzt.
»Du möchtest bitte was?« Sein Blick signalisierte mir, dass er nicht glauben konnte, was er eben gehört hatte.
»Du sollst gehen. Jetzt. Sofort. Lass mich bitte einfach nur in Ruhe. Ich will genau hier in diesem Krankenhaus bleiben. Was genau kapierst du daran nicht? Kannst du bitte nur einmal meine Wünsche akzeptieren?«
Mein Vater legte die Stirn, die sowieso schon faltig war, noch mehr in Falten. Als würde er mich nicht verstehen. Als wäre meine Aussage das Absurdeste, was er je gehört hatte. Einige Zeit starrte er mich nur eisig an. Seine Augen waren zu Schlitzen verengt, er stand in leicht nach vorn gebeugter Haltung am Fußende meines Bettes und hielt sich daran fest. Dies hier war ein Machtkampf und ich hatte eine Ahnung, dass ich nicht in der Lage war, als Gewinner herauszugehen.
»Das kannst du doch nicht ernst meinen, nach allem, was ich jahrelang in dich investiert habe?« Er wurde lauter. Wie immer, wenn es nicht nach seinen Vorstellungen lief. Es war noch nicht vorbei. Ich hatte diesen Knopf gedrückt, der den Choleriker in ihm weckte.
»Sag mal, checkst du nicht, dass du mich erst vor ein paar Tagen aus der Firma werfen wolltest?«, legte ich nach. Mir war klar, dass ich ihn damit provozierte, doch es war mir egal. Es war sowieso schon alles zu spät.
»So siehst du diese Sache also, ja?«
Ich spürte, wie seine Wut anschwoll. Es passierte wie so oft zuvor. Ich kannte es schon. Er wurde lauter und der Vulkan mit dem Gesicht meines Vaters spuckte glühend heiße Lava über mich. Eine Ader trat bedrohlich an seiner Stirn hervor. Er versuchte, seine Wut zu kontrollieren, die sich einen Weg nach draußen bahnen wollte. Seine Hände waren zu Fäusten geballt.
»Hätte ich nicht die Notbremse gezogen, hättest du die Firma langsam, aber sicher gegen die Wand gefahren. Etwas, was ich nicht zulassen werde. Nicht, nachdem ich Jahre investiert habe, um für dich und Ben etwas aufzubauen. Ich erwarte, dass du dieses Erbe nicht mit Füßen trittst, sondern dich deinem Namen entsprechend verhältst. Ich habe das für euch getan. Für die Familie.« Inzwischen schrie er fast.
Die Diskussion ging wie immer in die übliche Richtung und ich spürte, dass ich dieser kräftemäßig null gewachsen war. Das kleine bisschen Energie, das ich eben verbraucht hatte, war purer Erschöpfung gewichen.
Wie selbstlos, dachte ich.
»Dad. Du kannst nicht mehr so tun, als wärst du auf meiner Seite, wenn du es nicht bist. Ich bin nicht mehr der Junge von damals, mit dem du deine Spielchen spielen kannst.«
»Spielchen? Werd du erstmal erwachsen, um mir zu sagen, was ich zu tun habe.«
Es war, wie es immer gewesen war. Er hatte recht. Zu jeder beschissenen Zeit. Es war sinnlos, zu denken, dass er auch nur ansatzweise versuchte, mich zu verstehen.
Entmutigt und frustriert seufzte ich tief, als eine verärgerte Krankenschwester zur Tür hereinkam und ich mich erlöste. Mit einem Infusionsbeutel in der Hand funkelte sie meinen Vater böse an.
»Hatte ich Ihnen nicht ausdrücklich erklärt, dass Sie sich still verhalten sollen und die Patienten hier Ruhe brauchen? Ich möchte, dass Sie diese Station verlassen, und zwar sofort!« Ihr strenger Blick traf den eisigen meines Vaters.
»Sie wissen wohl nicht, wen Sie hier vor sich haben?«, meuterte mein Vater unbeeindruckt und machte wie immer seinen Einfluss geltend.
Mir wurde klar, wie eklig selbstgefällig der Mann war, und es widerte mich an. So wollte ich nie enden. Diese Erkenntnis traf mich wie ein Schlag. Es war, als hätte mir jemand einen Spiegel vorgehalten. Was mich aus diesem anschaute, war nichts, worauf ich stolz war. Es war eine arrogante Fratze und diese gehörte zu mir.
Ich fühlte mich leer, ohne Perspektive und hatte keine Kraft mehr, meinem Vater die Stirn zu bieten. Noch weniger aber, so weiterzumachen. In diesem Augenblick stand es mir klar vor Augen. Ich musste raus aus diesem goldenen Käfig, der mir zwar finanzielle Sicherheit gab, aber meine Freiheit raubte. Mit der Konsequenz, dass ich nichts als die lächerliche Marionette meines Vaters war.
Mein Kopf dröhnte und die Müdigkeit zog an mir. »DAD. GEH. JETZT!«
»Du wirst es noch bereuen!«
Sein Gesicht lief rot an vor Wut. Er machte auf dem Absatz kehrt, riss sich die Haube vom Kopf und stürmte aus dem Zimmer.
Die Luft war Minuten später noch durchdrungen von Arroganz und Machtgehabe. So war es immer gewesen. Wie machte er das bloß? Dass man sich in seiner Gegenwart klein und mies fühlte.
Bilder drängten sich in meinen Kopf. Bilder, die ich verdrängt hatte, ganz weit unten in einem versteckten Winkel meiner Seele. Meine Mutter. Ein Krankenhausbett. Schwach. Blass. Viel zu dünn.
Ich öffnete meine Augen und atmete durch. Ich konnte nicht daran denken. Es tat zu sehr weh. Der Schmerz drohte mich in ein Loch zu reißen, das so tief war, dass ich Angst hatte, verschlungen zu werden. Dort nie mehr herauszukommen. Angestrengt drängte ich die schmerzenden Gedanken wieder dorthin zurück, woher sie gekommen waren.
Eine Weile später schlief ich erschöpft ein.
***
Ich war vor einer Woche aus dem Krankenhaus entlassen und direkt in eine Reha Klinik gekommen, um meine Beweglichkeit wieder herzustellen.
Gerade kam ich von einer anstrengenden Physiotherapie-Einheit, als mir eine mir bekannte Silhouette den langen Flur entgegenkam. Es war Ben, mein zwei Jahre jüngerer Bruder. Er trug eine Tasche in der Hand und grinste schon von Weitem, als er mich erkannte. Während ich noch sehr langsam an Krücken ging, kam er schnellen Schrittes auf mich zu und umarmte mich freudig, als er vor mir stand.
»Hey Großer!« Er klopfte mir fest auf den Rücken, sodass ich Mühe hatte, das Gleichgewicht zu halten. »Wie geht es dir?« Prüfend blickte er mich an und ich zuckte lustlos mit den Schultern.
»Können wir uns irgendwo hinsetzen?«, fragte ich. Langes Stehen machte mir große Mühe und nach der Physio war ich sowieso erschöpft. »Da vorne ist ein Aufenthaltsraum oder wir gehen in mein Zimmer, das wäre noch besser. Ich bin komplett erledigt.«
Kaum hatten wir mein Zimmer erreicht, ließ ich mich erschöpft auf das Bett fallen. Ben zog sich einen Stuhl an den Bettrand und nahm Platz.
»Hier! Ich hab dir was mitgebracht. Deine alte Sim-Karte ist drin, die war nicht kaputt. An der Nummer hat sich also nichts geändert.«
Er streckte mir ein neues Smartphone entgegen, da mein Altes bei dem Unfall zerstört wurde.
»Danke, Mann. Jetzt bin ich nicht mehr komplett von der Außenwelt abgeschnitten.« Ich seufzte erleichtert.
»So und jetzt erzähl mal. Wie geht’s dir?« Ben ließ nicht locker.
»Was willst du hören? Dass ich Mühe habe, zwanzig Meter am Stück zu gehen, weil ich danach kaputt bin und mein Bein verdammt wehtut? Dass ich eine beschissene Wut habe, auf Dad und auf mich selbst. Oder dass ich mich frage, wie ich so selten dumm sein konnte, unangeschnallt Cabrio zu fahren? Vielleicht auch, dass ich dankbar bin, dass ich nur ein Schädel-Hirn-Trauma hatte und mir nicht gleich das Genick gebrochen habe. Gott, Ben, ich bin solch ein Vollidiot. Und gleichzeitig bin ich so froh, dass ich das Ganze so gut überstanden habe. Das hätte verdammt nochmal ganz anders ausgehen können.« Ich seufzte und versuchte, im Liegen eine bequeme Position zu finden.
Ben schüttelte den Kopf. »Du bist so kaputt, Junge.«