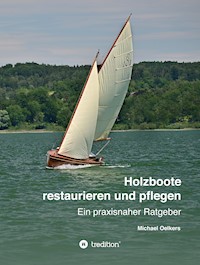
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Umfangreich bebildertes Fachbuch mit vielen Tipps - nun in Zweiter Auflage überarbeitet und ergänzt - zum Thema Holzbootsrestauration sowie Pflege und Erhalt von alten Segelbooten. Ein praxisnaher Ratgeber, der anschaulich an vielen Beispielen auch dem Laien aufzeigt, wie es richtig gemacht werden kann. Kein weiteres Buch für den Bootsbauer, nein ganz absichtlich für den Laien gedacht, der sich an die Thematik herantraut!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Holzboote restaurieren und pflegen
Ein praxisnaher Ratgeber
Michael Oelkers
Holzboote restaurieren und pflegen
Ein praxisnaher Ratgeber
Impressum
© 2019 Michael Oelkers
2. erweiterte, überarbeitete Neuauflage
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN Hardcover: 978-3-7497-3993-6
ISBN e-Book: 978-3-7497-3994-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
INHALT
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Sachstandsklärung – Bestandsaufnahme
Der Transport
Werkzeug und Arbeitsplatz
Das traurige Ende eines Star-Bootes
Kleine Holzkunde
Die Qual der Wahl bei den Schrauben
Allheilmittel (?) Epoxid
Alles im Lack
Bodenwrangen- und Spantenbau
Ausleisten
Steven- und Kielschäden
Konservieren von Metallteilen
Mast- und Riggpflege
Segel – Persenning
Kleine Jollenklassenübersicht
BM - Jolle
Winter(ein)lagerung
Veränderung
Zwanziger Jollenkreuzer „King Louie“
Offener 15 qm-Jollenkreuzer „Louie“, Typ Seerose
Die Rettung des R 101 „Phönix“
Wässern vorm Wassern
Nachspann
Bildnachweise
VORWORT
Praktische Holzbootpflege
Dieses Buch soll dem Holzbootliebhaber als praktischer Ratgeber dienen. Es ist ganz absichtlich kein weiteres Buch, welches als Restaurationsgrundlage möglicherweise den Bootsbauer ersetzen soll. Nein, es soll vielmehr Mut machen, sich mit den alten Booten zu beschäftigen – sie zu segeln und zu erhalten. Es ist gedacht als Ratgeber „aus der Praxis – für die Praxis“, meine Grundaussage lautet schlicht: „Trauen Sie sich ran!“. An unterschiedlichen Bootstypen will ich exemplarisch darstellen, welche Arbeiten überwiegend auf Eigner zukommen.
In den Jahren meiner Holzbootleidenschaft habe ich hierzu viele unterschiedliche Erfahrungen bei den Restaraurationen sammeln können und wurde bei meinen Vorträgen zum Thema immer wieder mit denselben Problemstellungen konfrontiert. Daraus ergab sich folgerichtig die Motivation, ein Buch über die Thematik zu verfassen, das diese Fragen beantwortet; die zweite, überarbeitete Auflage desselben halten Sie gerade in Händen. Es soll als praktischer Ratgeber für die Interessierten unter uns dienen – und ermutigen, sich auf das „alte schwimmende Holz“ einzulassen.
Allein hätte ich aber diese Erfahrungen in ihrer Tiefe gar nicht machen können. Ich hatte das Glück, vor Jahren einen Handwerker gefunden zu haben, der für mich ein Holzkünstler ist und bleibt. Klaus Walbrun ist seitdem ein guter Freund geworden, der diesem Holzbootvirus ebenso verfallen ist. Holz ist ohnehin seine Profession. Er ist selbstständiger Zimmermeister, bei dem ich unglaublich viel über das Grundmaterial Holz lernen durfte. Bei ihm erlebte ich, welche Waffe ein Hobel sein kann und er beeindruckt mich immer wieder aufs Neue mit seiner ruhigen und fachkundigen Art. Das Arbeiten mit Holz macht mir in diesem Umfeld einfach Freude – und ich werde wohl für immer sein „ältester Lehrling“ bleiben…!
Eines seiner Statements aufgrund eines skeptischen Blickes meinerseits, werde ich nie vergessen:
„Keine Angst – alles, was man aus alten Holzbooten herausnimmt, kann man auch wieder neu einsetzen!“
EINLEITUNG
Was will ich?
Diese wichtige Frage muss sich vorab jeder Holzbootliebhaber selbst stellen. Hierzu kann es von außen lediglich Hinweise geben – was eines der Ziele dieses Buches ist. Schnell bilden sich beim Anblick eines in voller Fahrt vorbeirauschenden Schärenkreuzers, von Sonder- oder Meterklasse, eines Drachens oder ähnlicher Schönheiten, Falten der Freude um die Augen des Betrachters. Natürlich ist so etwas schlichtweg ein Traum – aber kann man sich den Unterhalt von so einem großen Kielboot als „Normalo“ überhaupt leisten?
Die Antwort auf die Entscheidung für das subjektiv passende Boot ruft sogleich Folgefragen auf. Wo bekomme ich einen Liegeplatz, will ich „bootswandern“ oder bleibe ich an „meinem“ Gewässer. Hieraus stellt sich sofort die weitere Frage nach dem Transportmittel – Trailer genannt – und ganz plötzlich findet man sich bei der Fragestellung, wieviel Anhängelast denn eigentlich das eigene Auto erlaubt… Ferner: Wo kann man problemlos slippen – oder benötige ich einen Kran?
Schon reduziert sich das anfängliche Wunschdenken auf das jeweilig Machbare. Keine Angst vor baulichen Änderungen, das ist ebenfalls hilfreich und ganz schnell sieht sich der Holzbootinteressent mit der Problemstellung einer Restauration konfrontiert – die übrigens bei näherer Betrachtung ganz schnell in einer Rekonstruktion enden kann.
Begrifflichkeiten
„Restaurare“ steht im Lateinischen als Begriff für „Wiederherstellung“. Dies bedeutet nichts anderes, als Ehemaliges wieder in den Stand von damals zurückzuführen. Ganz eng gesehen – in den Originalzustand. Meines Erachtens nach haben moderne Kunststoffteile oder Beschläge auf einem historischen Schiff wenig zu suchen. Selbst bei den Tauen kann man heute auf sehr schöne Produkte – optisch nah am alten Original – zurückgreifen. Es gibt für den Autor nichts unpassenderes, als ein verschlimmbessertes Holzboot mit Teilen, die es zum Zeitpunkt seiner Herstellung noch nicht gegeben hat. Die Maxime heißt (für mich) demnach: Originalgetreu.
„Rekonstruktion“ bedeutet nichts anderes als das neuerliche Erstellen von etwas nicht mehr Vorhandenen – wenn man so will: ein Neuaufbau auf Basis alter Strukturen. Plakativ will ich dies kurz an einem Beispiel einer Yacht verdeutlichen. Viele Planken erwiesen sich als unbrauchbar, lediglich die Stahlspanten waren noch vorhanden – und selbst diese hatten in den letzten Jahrzehnten an ihrer Verzinkung erheblich gelitten. Teilweise mussten sie durch neue ersetzt werden. Das Schiff wurde also von Grund auf neu aufgebaut – genau deshalb haben wir es an dieser Stelle mit einer Rekonstruktion zu tun. Nachdem dabei Teile des Originals verwendet wurden (z.B. der Ballastkiel), hat so ein Schiff immer noch seine Geschichte und kann ohne Zweifel als historisch angesehen werden. Ein kompletter Neubau hat dies eben nicht zu bieten.
Sensibilisierung
Grundsätzlich ist der Autor kein Freund von ständigen Reglements, davon gibt es ohnehin schon zu viele. Stichwort „Brüssel“ und in Ergänzung dazu die (mit großer Leidenschaft gepflegte) deutsche Gründlichkeit, alles (vorauseilend) noch besser machen zu wollen… Wir Holzbootsfreunde sollten/müssen uns zielgerichtet vor Augen halten, über welches Thema wir reden: Den Erhalt von überwiegend alten Booten/Schiffen. Selbstverständlich gibt es hierzu ebenfalls Regelungen, respektive einen entsprechenden Anhalt, den man zumindest einmal zur Kenntnis nehmen sollte.
Die Grundlage zum Erhalt historischer Schiffe ist in der sogenannten „Charta von Barcelona“ zu finden. Sie legt Mindeststandards für Erhaltung und Restaurierung fest und ist eine europäische Charta für historische Wasserfahrzeuge. Die bereits im Jahre 1964 verabschiedete Charta von Venedig bildet die verbindliche Grundlage für den Umgang mit historischer Bausubstanz auf internationaler Ebene. Sie beginnt mit folgender Präambel:
Als lebendige Zeugnisse jahrhundertelanger Traditionen der Völker vermitteln die Denkmäler der Gegenwart eine geistige Botschaft der Vergangenheit. Die Menschheit, die sich der universellen Geltung menschlicher Werte mehr und mehr bewusst wird, sieht in den Denkmälern ein gemeinsames Erbe und fühlt sich kommenden Generationen gegenüber für ihre Bewahrung gemeinsam verantwortlich. Sie hat die Verpflichtung, ihnen die Denkmäler im ganzen Reichtum ihrer Authentizität weiterzugeben.
Es ist daher wesentlich, dass die Grundsätze, die für die Restaurierung der Denkmäler massgebend sein sollen, gemeinsam erarbeitet und auf internationaler Ebene formuliert werden, wobei jedes Land für die Anwendung im Rahmen seiner Kultur und seiner Tradition verantwortlich ist.
Indem sie diesen Grundprinzipien eine erste Form gab, hat die Charta von Athen von 1931 zur Entwicklung einer breiten internationalen Bewegung beigetragen, die insbesondere in nationalen Dokumenten, in den Aktivitäten von ICOM und UNESCO und in der Gründung des „Internationalen Studienzentrums für die Erhaltung und Restaurierung der Kulturgüter“ Gestalt angenommen hat.
Während die „Charta von Venedig“ den Umgang mit alten Gebäuden, Monumenten und historischen Stätten regelte, setzt die „Charta von Barcelona“ seit dem Jahre 2001 durch die Versammlung des IV. European Maritime Heritage Congress nun europaweit gültige Mindeststandards speziell für die Erhaltung und Pflege von in Betrieb befindlichen historischen Wasserfahrzeugen fest.
Definitionen
ARTIKEL 1. Das Konzept des maritimen Erbes umfasst sowohl das einzelne traditionelle Schiff, das von einer ihm eigentümlichen Zivilisation Zeugnis ablegt oder eine bezeichnende Entwicklung erkennen lässt, sowie das traditionelle Segeln, Seemannschaft und seemännische Fertigkeit. Es bezieht sich nicht nur auf größere Schiffe, sondern auch auf bescheidenere Werke, die im Laufe der Zeit eine kulturelle Bedeutung bekommen haben.
ARTIKEL 2. Die Bewahrung, die Wiederherstellung und der Betrieb der traditionellen Schiffe muss sich aller naturwissenschaftlichen und technischen Mittel und Methoden bedienen, die einen Beitrag zur Erforschung und Erhaltung des überkommenen maritimen Kulturerbes leisten können.
Ziel
ARTIKEL 3. Die Absicht bei der Erhaltung und Restaurierung traditioneller Schiffe in Fahrt ist es, sie sowohl als Kunstwerke als auch als geschichtliches Zeugnis zu bewahren und um traditionelle Handwerksfertigkeiten am Leben zu erhalten.
Erhaltung
ARTIKEL 4. Es ist für das anhaltende Überleben der traditionellen Schiffe wesentlich, dass sie andauernd gepflegt werden.
ARTIKEL 5. Der Einsatz der traditionellen Schiffe in einer gesellschaftlich nützlichen Form begünstigt immer ihre Bewahrung. Der Gebrauch ist folglich wünschenswert, aber er darf das äussere Erscheinungsbild des Schiffs nicht erheblich verändern. Die Änderungen, die durch eine Änderung der Funktion verlangt werden, sollten innerhalb dieser Grenzen gehalten werden.
ARTIKEL 6. Ein traditionelles Schiff ist mit seiner Geschichte, deren Zeuge es darstellt, sowie mit dem Gewässer, in dem es segelte, untrennbar verbunden. Folglich sollten Heimathafen und Einsatzbereich sich idealerweise in den Regionen seines ursprünglichen Heimatreviers befinden.
Restaurierung
ARTIKEL 7. Der Prozess der Restaurierung ist ein in hohem Grade spezialisierter Vorgang. Sein Ziel ist es, den ästhetischen, funktionellen und historischen Wert der traditionellen Schiffe zu konservieren und zu entdecken. Er gründet sich auf die Respektierung des alten Originalbestands und auf authentische Dokumente. Vor Beginn und während der Restaurierung werden stets historische Untersuchungen zum Schiff anzustellen sein.
ARTIKEL 8. Die Wiederherstellung der traditionellen Schiffe wird am besten mittels der traditionellen Materialien und der Techniken vollendet. Wo traditionelle Materialien oder Techniken sich als unzulänglich herausstellen, kann die Konsolidierung der Schiffe durch den Gebrauch von modernen Konservierungsverfahren gesichert werden, deren Wirksamkeit durch wissenschaftliche Erkenntnisse bewiesen und durch praktische Erfahrung garantiert ist.
Man kann natürlich trefflich darüber diskutieren, ob es einer derartigen Regelung bedarf. Ich bin der Meinung, dass die Standards eingehalten werden sollten, um ein entsprechend authentisches Boot zu erhalten. Sie einmal kennengelernt zu haben, dient meines Erachtens der Grundhaltung gegenüber dem historischen schwimmenden Holz.
Boote haben geschichte
Über die Jahrzehnte seines Bestehens erlebt jedes Boot meist verschiedene Eigner mit unterschiedlichen Einstellungen die entsprechend umgesetzt wurden. So ändert sich z.B. die Inneneinrichtung in Holz und/oder Ausdruck, ein neuer Mast mutiert von der ehemaligen Gaffeltakelung zur 7/8-Takelung. Solange dies alles klassenkonform ausgeführt wurde, spricht im Grunde nichts dagegen. Boote sind letztlich nur Gebrauchsgegenstände, die deshalb einem entsprechenden Verschleiss unterliegen.
Dabei sollte allerdings jedweder Eingriff in die Originalsubstanz nachvollziehbar und – wenn möglich – belegbar sein. Alte Beschläge gilt es, so weit wie möglich zu erhalten und entsprechend aufzuarbeiten. Gerade die oftmals einfache Bauweise sollte unbedingt bewahrt werden und als Zeugnis seiner Zeit dienen. Es sind nicht die „übertakelten Fregatten“ die beeindrucken, es sind immer die einfachen Dinge, die über Jahrzehnte hinweg bestens funktionierten und sich somit bewährten.
So, wie wir Menschen individuell über einen eigenen Charakter verfügen, sind es die besonderen Eigenschaften alter Boote, die aus der Masse herausstechen und ihre Individualität belegen. Und: Es gibt keine hässlichen Schiffe! Nur verschlimmbesserte Objekte empfinden wir als unschön. Spuren des Alterns sollen und dürfen sichtbar sein, sie passen zur Identität des jeweiligen Schiffes und schaffen Authentizität. Was hilft denn ein dem Aussehen nach nagelneues Schiff, wenn im Gespräch irgendwann das Alter genannt wird und Umbauten einfach irgendwie nicht in das ästhetische Gesamtbild passen? Hierzu sei exemplarisch ein Beispiel genannt: Ein Jollenkreuzer aus Baujahr 1934 mit großer rundumlaufender Seereeling aus hochglänzendem Edelstahl – im Erscheinen geprägt von einer – nach meinem Empfinden – für sich selbst sprechenden Widerlichkeit und völlig unpassend.
Informationsquellen
In den Zeiten der schnellen Medien findet sich ein weltweites Netz von Interessierten, die über die unterschiedlichsten Quellen Informationen/Unterlagen zu einem ins Auge gefassten Schiff besitzen. Logo: Fragen kostet nichts. Ich bin in den Jahren meines Holzboothobbys ausschließlich auf hilfsbereite und nette Menschen gestoßen, die jederzeit bereit waren, mir weiterzuhelfen. Sei es mit Skizzen/Rissen oder Bildern für dieses Buch, Tipps und Adressen von gleichgesinnten Bootsbesitzern – es ist einfach wunderbar, wie diese Szene lebt. Hilfreich ist es zudem, nach Leuten zu suchen, die schon Erfahrungen mit dem von mir ins Auge gefassten Boot gemacht haben. Der Kreis der Werften oder auch private Liebhaber, die auf die jeweiligen Klassen spezialisiert sind, ist ohnehin übersichtlich und im Zuge einer Online-Recherche meist schnell und entsprechend zielführend.
Wenn jemand von uns Holzbootfreunden Fragen zu bestimmten Produkten hat, sei es zu Lacken/Farben oder Ausstattungsgegenständen, dann bekommt er unter Garantie jederzeit von den Herstellern/Vertrieben perfekte Aussagen. Oftmals sitzen nämlich am Ende der Leitung Bootsbaumeister oder Segelmacher oder/und… Also jeder, der sich entsprechend artikulieren kann, bekommt mindestens eine (qualifizierte) Antwort auf seine Fragen. Und bitte nie vergessen: Es gibt keine dummen Fragen!
Die Seele der holzboote
Ich bin inzwischen fest davon überzeugt, dass alte Holzboote eine Seele besitzen und glaube deshalb an den alten englischen Spruch: „People don‘t find boats – boats find people“.
Holzboote sind im Grunde nichts für nervöse Menschen, sie bereiten nämlich schnell Kummer, gelegentlich sogar Stress und Sorgen. Man wird nie wirklich fertig mit den Booten – „…irgend etwas ist ja immer…“
Und genau das liebe ich am alten, schwimmenden Holz. Holzboote erziehen zur Demut, fordern Respekt und wollen ständig gut behandelt werden. Im Gegenzug erfreuen sie aber jedesmal aufs Neue. Alles schon irgendwo mal gehört, oder? Ja, schon, aber Holzboote haben einen riesigen Vorteil – sie widersprechen nicht. Allerdings nehmen sie Misshandlungen irgendwann krumm und bereiten dann entsprechenden Ärger, wie es an Beispielen in diesem Buch aufgezeigt wird.
Typfindung
Bei der durchaus übersichtlichen Typenanzahl ist man im Grunde schnell auf dem Punkt. Möchte man mit den (vielleicht noch kleinen) Kindern Bootswanderungen durchführen, bieten sich Jollenkreuzer oder die Kielschwerttypen wie Hansa-, oder, eine Nummer größer, die inzwischen immer seltener werdende Niedersachsenjolle, an.
Will man im Grunde ein eher kleineres und vor allem handliches Schiff, dann steht man vor der Wahl in den Jollenklassen, die über Schwert- (alternativ Kiel-) Zugvogel zu H-, Elb-E-, J- oder M-, O- und Z-Jollen – nicht zu vergessen Pirat und Korsar – ganz unterschiedliche seglerische Ansprüche stellen. Und bei der Frage nach dem Rigg üben die gaffelgetakelten Typen ohnehin ihren ganz besonderen, eigenen Reiz aus.
Aber auch schon fast vergessene Klassen, wie z.B. eine Grünhagen-Weser-Jolle (Kielschwert-Jolle) oder die bekannteste Kieljolle aus den Niederlanden – die BM-Jolle – haben ihren besonderen Charme. Beide Typen sind vor allem in Norddeutschland besser bekannt als im Süden. Eine Grünhagen-Weser-Jolle lässt sich durchaus ambitioniert im Wattenmeer bewegen, und bei der BM-Jolle wird angeblich erst ab Windstärke fünf gerefft. Aus eigener Erfahrung kenne ich die beeindruckenden Segelleistungen einer BM-Jolle recht gut. So ein kleiner Gaffelsegler war mein erstes eigenes Holzsegelboot, welches ich restaurierte. In Deutschland gibt es für die BMs leider keinen richtigen Markt. Ein Sachverhalt, der zwar die Preise unten hält, dem Boot aber in keinster Weise gerecht wird.
Preisfindung
Eine der schwierigsten Fragen überhaupt, ist die Suche nach dem „richtigen“ Preis für ein altes Holzboot. Im Vergleich zu Automobilen gibt es keine Schwacke-Liste oder DATEinstufung.
Bei alten Schiffen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am einfachsten sind noch die Restaurationsfälle einzuordnen. Warum? Falls man die Schäden gleich ersehen kann, sind deren Umfänge recht schnell zu beurteilen. Wenn möglich, sollte ein geübter Holzbootsbesitzer bei der Besichtigung mit dabei sein.
Als exemplarisches Beispiel will ich an dieser Stelle eine Schwertkastenerneuerung bei einem „Zwanziger Jollenkreuzer“ nennen. Runde vierzig Stunden als reine Arbeitszeit sind kein übertriebener Anhalt. Muss das Schwert ebenfalls erneuert werden, befindet man sich schnell im soliden vierstelligen Euro-Bereich. Dieser Sachverhalt reduziert zwar den Gestehungspreis, sorgt allerdings sogleich für entsprechende Folgekosten. Billig reparieren – quasi nur so ein bisschen – funktioniert nur kurzfristig, es rächt sich unter Garantie mit einer „großen Baustelle“.
Falls wirklich „nur etwas“ Lack fehlt, ist dies bei einem Schiff (vergleichbar mit dem angesprochenen Jollenkreuzer) im jährlichen Erhaltungslack ein Aufwand von ein bis zwei Dosen Lack mit entsprechendem Zubehör und rund drei bis vier Stunden Beschäftigung – quasi Erholung in der Tätigkeit.
Als Leitfaden kann folgende Listung dienen. Sind die Fragen positiv zu beantworten, dann ist die Preisfindung durchaus leichter:
• Bei einem rundum renovierten Boot sollte die Restauration anhand von Bildern umfassend dokumentiert sein.
• Ist das Objekt der Begierde ein seltenes Boot und zudem auf der Basis der Originalität gearbeitet worden, wirkt sich dies möglicherweise wertsteigernd aus.
• Befindet sich ein tadellos funktionierender und zugelassener Trailer mit dabei?
• Gibt es passende und vor allem noch brauchbare Segel (also keine ausgehängten Tücher) dazu?
• Ist das laufende und stehende Gut gebrauchstüchtig und vielleicht sogar ein guter, weil entsprechend gepflegter Holzmast (Stichwort Lack/Risse) vorhanden?
• Ist eine entsprechend passende und frische Persenning ebenfalls dabei?
• Gibt es einen originalen Messbrief – sprich: die entsprechende Historie – zum Boot?
Meine Gleichung lautet daher schlicht: Je weniger Substanz vorhanden ist, umso günstiger ist das Boot. Folgekosten sind nicht immer kalkulierbar und werden gerne unterschätzt.
Angebote zum Vergleich gibt es im Markt genügend. Ich habe alle meine Boote im Internet gefunden. Gespräche mit Bootsbesitzern oder Werften aus der gleichen Klasse bieten sich ebenfalls an – man kennt dort möglicherweise die Boote und deren Eigner. Letztlich bleibt allerdings jedem Interessierten nur das disziplinierte Handeln und der Entschluss zu seinem ganz persönlichen Ja oder Nein.
Kauf und Vertrag
Ist man sich handelseinig geworden, dann empfiehlt sich ein schriftlicher Kaufvertrag. In diesem sollte die Herkunft (Werft) des Bootes mit Baujahr fixiert sein. Wenn möglich, durch einen originalen Messbrief. Gibt es sogar noch dazu eine originale Plakette – fein!
Das gesamte, originale Zubehör empfiehlt sich, im bestehenden Zustand ebenfalls aufzuführen. Der Verkäufer sollte ergänzend bestätigen, dass der Kaufgegenstand frei von Rechten Dritter ist und Ort/Datum/Unterschrift beschließen üblicherweise Verträge. Entsprechende Vordrucke gibt es Internet genügend. Entweder bei www.yacht.de/service/pdf/gebrauchtboot-kaufvertrag.pdf oder bei den Versicherungen.
An dieser Stelle soll und darf meinerseits keine Rechtsberatung stattfinden – das versteht sich wohl von selbst. Als Nicht-Jurist bin ich an dieser Stelle raus.
Und: Bei aller Euphorie und aufkommenden Glücksgefühlen beim Kauf, muss letztendlich doch der Käufer nüchtern und sachlich handeln.
KAPITEL 1
Sachstandsklärung – Bestandsaufnahme
Eine durchaus absichtlich provokant gestellte Frage will ich vorausschicken: „Muss wirklich jedes alte Schiff erhalten werden – und dies auch noch unabhängig davon, in welchem Zustand es sich befindet?“ Ganz nüchtern gesehen: Nein – nicht jedes! Denn oftmals befinden sich Boote in einem derart desolaten Zustand, dass sie im Grunde lediglich als Beitrag zu einer Sonnenwendfeier taugen. Wobei ich natürlich sogleich relativieren muss, denn wenn eine Restauration aus persönlichen Gründen unbedingt sein muss, dann darf in letzter Konsequenz auch der monetäre Einsatz keine Rolle spielen. Als persönliches Beispiel nenne ich die Rettung des R 101 „Phönix“ aus dem Jahre 1934. Ich musste ihn haben und irgendwie wollte er auch zu mir (denke ich), denn bei der Restauration ging alles erstaunlich glatt – gerade so, als ob das Boot mitmachen wollte.
Auch ein Erfahrungswert: Ein altes Boot umfänglich zu restaurieren, um es dann anschließend gewinnbringend zu verkaufen, rechnet sich in den allermeisten Fällen nicht. Die Entscheidung pro Restauration muss jeder zukünftige Eigner also für sich selbst treffen.
Im Grunde hat sich folgende Erkenntnis bei mir verinnerlicht:
• Schadensstellen, die wirklich notwendig zur Erhaltung der Bootsstruktur sind, stehen an erster Stelle der Tätigkeitsliste. Sie sind ein Muss und erzwingen sofortiges Handeln vor der nächsten Saison. Aufschub ist nicht zulässig. Dazu zählt auch ohne Diskussion der jährliche Lackauftrag am klarlackierten Rumpf.
• Schadensstellen, die zwar erste Anzeichen andeuten, aber noch nicht wirklich kritisch aussehen, stehen an zweiter Stelle der Liste. Spätestens im Zeitraum der nächsten Winterpause wird allerdings ein intensiver Blick darauf geworfen.
• Stellen, die lediglich oberflächlich etwas gelitten haben – wie z.B. der Lack eines Kajütdaches, das ohnehin unter einer Persenning liegt – sind bei mir nachrangig. Sie sind lediglich aus ästhetischen Gründen (irgendwann) fällig.
Der Kauf
Nehmen wir einmal an, das Objekt der Begierde ist in das nähere Betrachtungsfeld gerückt und die Besichtigung steht an.
Wir unterscheiden hierbei den Kauf:
• beim Bootsmakler/-bauer oder
• von privat oder
• von gewerblichen Internetanbietern.
Ersterer hat seinen Ruf zu wahren und wird deshalb (hoffentlich) die Wahrheit über das Boot sagen. Wenn er geschäftstüchtig ist, wird er auf noch zu behandelnde Stellen hinweisen und möglicherweise gleich ein Angebot dazu unterbreiten. Das kann auf den ersten Moment erschreckend hoch klingen, bei genauerer Betrachtung wird die Preisvorstellung allerdings recht schnell darstellbar.
Besondere Vorsicht gilt es bei gewerblichen Anbietern aus dem Internet walten zu lassen, die bei näherer Inaugenscheinnahme der Firma nichts anderes als An- und Verkäufer sind. Da offiziell gewerblich unterwegs, kollidieren hier übrigens ganz schnell die gesetzlich verankerten Gewährleistungsrichtlinien mit den Anbietern.
Größere Unterschiede wird es zwischen den Werften nicht geben. Die Auftragslage ist gerade an den großen Seen oder Küsten gut, zudem gibt es dort bei den Werften bereits langjährige Stammkunden. Es lohnt sich deshalb mit Sicherheit ein Blick in die Fläche. In welcher Werkstatt/Werft das eigene Holzboot den Winter verbringt, ist im Grunde ziemlich egal. Warum also nicht gleich bei einer entsprechenden Werkstatt irgendwo auf dem Land?
Wenn ein Privatmann sein Holzboot verkauft, hat dies immer unterschiedlichste Gründe, die hier nicht näher geschildert werden können. Da reicht die Spannweite von „Opas Schatz“ bis zur gut getarnten „Grotte“. Vor allem bei frisch farbig lackierten Rümpfen (plakativ ist hier ein vom Verkäufer wiederholt lobend angesprochenes neues Antifouling) gilt es, eine gesunde Skepsis walten zu lassen. Was verbirgt sich darunter? Lieber diese Streicharbeit in Kauf nehmen und dabei erkennen, wo sich eventuelle Schäden verbergen, als spätestens im nächsten Herbst zum Ende der Saison mit Erschrecken die bis dato versteckte Baustelle bemerken.
Wie oben schon benannt, gilt es, besondere Vorsicht bei (Internet-)Unternehmen walten zu lassen, die oftmals reine Postenschieber sind. Meist sind diese sofort erkennbar durch Angaben, welche eine Seriosität und/oder Sachkenntnis vermitteln sollen. Da finden sich gerne Bemerkungen in der Art von: „vor Jahren wurden bereits zigtausend Euro investiert“ und überwiegend in Prosa gehaltene Beschreibungen wie: „zieht lediglich alle 14 Tage zwei bis drei Schwammfüllungen Wasser“. So etwas zeigt mit derartigen Umschreibungen schonungslos die tatsächlich vorhandene Kompetenz auf. Stutzig werde ich allein schon bei Angeboten, in denen das Boot im Angebotsbild zwar auf dem Trailer steht, dieser allerdings extra bezahlt werden soll. Besonders lustig fand ich auch einmal ergänzend die Bemerkung: „multiradiales Hydranet“. Gemeint ist damit ein hochfestes Polyestergewebe mit einem eingewebten Dyneema®-Netz bei Segeln, welche dadurch die Bezeichnung: Hydra Net® erhält. Radiale Hydra Net®-Segel sind jedoch Tücher, die erst ab 340g/qm im Angebot der Segelmacher stehen und somit für die meisten Binnen-Boote viel zu schwer sind. Die erwähnten „Fachbegriffe“ fand ich übrigens bei einer Annonce zu einem 15er Jollenkreuzer und so etwas ist ja bekanntlich alles andere, als ein Schwerwetterschiff. Bei derartigen Anbietern wird man mit Verlaub „über den Leisten gezogen“ und die Juristen unter uns haben mit Sicherheit nicht ganz unrecht, wenn hier der Begriff der „irreführenden Angaben“ ins Spiel kommt…
Bringen wir es auf den Punkt.
Nachvollziehbar will jeder Holzbootliebhaber so wenig Geld wie möglich ausgeben. Das „dicke Ende“ folgt dann aber garantiert danach. Alte Holzboote zu nutzen und zu erhalten, ist und bleibt kein billiges Hobby. Je nach eigenen handwerklichen Fähigkeiten, lässt sich zweifelsfrei viel Geld bei der (irgendwann anstehenden) Restauration sparen. Der Unterhalt ist übersichtlich mit jährlichem Lackauftrag und, falls nötig, unbedingt biozidfreiem (!) Antifouling – wenn die Grundsubstanz vorhanden ist. Und bei aller Begeisterung für ein Schiff, darf beim Kauf nicht das Zubehör vergessen werden. Ich habe bei jedem meiner Holzboote immer ganz schnell einen soliden dreistelligen Euro-Betrag dafür investiert, um Fender, Taue, Beschläge usw. zu ergänzen und das Boot entsprechend komplett auszurüsten. Wie bereits angemerkt – nicht zu vergessen einen passenden Trailer, Segel, Persenning, etc., pp. Das stehende und laufende Gut ist ebenfalls ein nicht unwesentliches Thema.
KAPITEL 2
Der Transport
Dieser erfolgt üblicherweise mit einem entsprechenden Trailer. Bei allen meinen Booten musste zu diesem Thema immer etwas getan werden – selten stand nur eine neue TÜV-Plakette an.
Tipp: Der TÜV-Prüfer legt das Hauptaugenmerk normalerweise auf die Reifen; dabei wirft er einen Blick auf das Alter der Reifen sowie deren Zustand. Alle sechs Jahre neue Pneus sorgen hier für eine gewisse Grundsicherheit – bei „Tempo 100“-Trailern ohnehin. Dass die Beleuchtung entsprechend funktionstüchtig ist – genau wie die Bremsen auch – versteht sich sicherlich von selbst.
Erwerb von Bootstrailern
Reicht ein Slippwagen vom Segelverein oder benötige ich einen zugelassenen Bootstrailer? Falls das Boot den Platz des Vereines auch im Winter nicht verlassen muss, kann ein entsprechender Slip- oder Hafentrailer völlig ausreichen. Allerdings dürfen solche Fahrzeuge nie auf öffentlichen Straßen bewegt werden – auch nicht bei niedrigen Geschwindigkeiten oder mit Warndreieck. Auf öffentlichen Straßen darf nur ein zugelassener Bootsanhänger gefahren werden.
Für einen Trailerkauf sind zwei Dinge entscheidend:
1. Gewicht des Bootes
2. Länge des Bootes





























