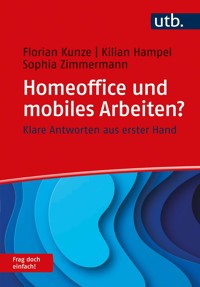
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Frag doch einfach!
- Sprache: Deutsch
Arbeiten im Homeoffice – für viele ist das mittlerweile Alltag. Die Tendenz zu mehr mobilem Arbeiten zeichnet sich seit Längerem ab und wurde durch die Corona-Krise noch beschleunigt. Da sich diese Entwicklung wohl nicht wieder umkehren wird, stehen viele Unternehmen, Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer vor der Frage nach dem richtigen Umgang mit der neuen Form des Arbeitens. Die Autoren dieses Buches beantworten die wichtigsten Fragen systematisch aus wissenschaftlicher sowie praktischer Perspektive. Dabei finden sich Tipps und Beispiele für Mitarbeitende, Teams, Führungskräfte, Organisationen sowie Politik und Gesellschaft. Frag doch einfach! Die utb-Reihe geht zahlreichen spannenden Themen im Frage-Antwort-Stil auf den Grund. Ein Must-have für alle, die mehr wissen und verstehen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Florian Kunze / Kilian Hampel / Sophia Zimmermann
Homeoffice und mobiles Arbeiten? Frag doch einfach!
Klare Antworten aus erster Hand
Umschlagabbildung und Kapiteleinstiegsseiten: © bgblue – iStock
Abbildungen im Innenteil: Figur, Lupe, Glühbirne: © Die Illustrationsagentur
© UVK Verlag 2021— ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
utb-Nr. 5664
ISBN 978-3-8252-5664-7 (Print)
ISBN 978-3-8463-5664-7 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Die aktuelle Corona-SituationCorona-Situation hat zu einer massiven Transformation der Arbeitswelt geführt. Von jetzt auf gleich wurde für Millionen von Beschäftigten das mobile Arbeiten im Homeoffice zur Realität. Nach Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) arbeiteten im Mai 2020 etwa 35 Prozent der Beschäftigten von zu Hause (DIW, 2020). Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu einer Studie von 2016, nach der nur 12,5 Prozent der deutschen Beschäftigten regelmäßig im Homeoffice arbeiteten und Deutschland damit im OECD Vergleich im unteren Drittel rangierte (DIW, 2016).
In unserem Future of Work Lab an der Universität Konstanz haben wir diese Entwicklung seit Beginn des ersten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lockdowns im März 2020 durch empirische wissenschaftliche Forschung begleitet. In inzwischen 12 Befragungswellen haben wir 700 für die deutsche Erwerbsbevölkerung repräsentative Beschäftigte, die derzeit von zu Hause arbeiten, zu Ihren Erfahrungen im mobilen Arbeiten befragt. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen deutlich, dass sich ein Großteil der Beschäftigten keine Rückkehr zur Vollzeit-Präsenzpflicht wünscht und sich für eine Fortführung des mobilen Arbeits, zumindest in Teilen, ausspricht. 56 Prozent der Befragten möchten auch in Zukunft von zu Hause arbeiten, wobei nur knapp ein Viertel ausschließlich den Heimarbeitsplatz der Büroatmosphäre vorzieht. Das Wunschmodell ist bei vielen Befragten eine ausbalancierte Mischung aus Homeoffice und Präsenztätigkeit. Während 25 Prozent vollständig von zu Hause arbeiten wollen, gibt die Mehrheit der Befragten an, zwei bis drei Tage pro Woche im Homeoffice zu präferieren (Mittelwert aller Befragten: 2,88 Tage) (Kunze, Hampel, & Zimmermann, 2020). Zusätzlich berichten 78 Prozent der Befragten konstant über alle Erhebungszeitpunkte, dass sie im Homeoffice engagiert und auch produktiv arbeiten (Kunze et al., 2020). Der Wert ist 15 Prozent höher als in einer vergleichbaren Studie von 2015, in der fast alle Befragten in Präsenzform arbeiteten (Hauser, Schubert, & Aicher, 2015).
Auch wenn das Arbeiten von zu Hause durchaus auch Schattenseiten hat, wie eine soziale Isolierung und eine mögliche emotionale ErschöpfungErschöpfung, dürfte es vielen Unternehmen schwerfallen, nach Corona das Rad wieder hin zu einer vollständigen Präsenzpflicht zurückzudrehen. Die Kultur in vielen Unternehmen, die Präsenz im Büro mit Leistung gleichsetzt, dürfte beträchtlich ins Wanken kommen und auch die Argumentation von Führungskräften, dass spezifische Bürotätigkeiten grundsätzlich nicht im mobilen Arbeiten möglich sind, dürfte schwer zu halten sein. So planen zum Beispiel alle DAX 30 Konzerne, mobiles Arbeiten nach dem Ende der Corona-PandemieCorona-Pandemie deutliche stärker als zuvor fortzusetzen (Spiegel, 2020a).
In dem vorliegenden Buch wollen wir deshalb den aktuellen Stand der Management- und Organisationsforschung zum Thema Homeoffice und mobiles Arbeiten systematisch aufarbeiten und über die Fragenstruktur in konkrete Empfehlungen für verschiedene Anspruchsgruppen in der Arbeitswelt und GesellschaftGesellschaft überführen. Hierbei werden wir sowohl eigene Ergebnisse aus unserer Konstanzer Homeoffice StudieKonstanzer Homeoffice Studie als auch umfangreiche, wissenschaftliche Literatur zu den verschiedenen Themenbereichen verwenden. Begleitet wird die wissenschaftliche Perspektive von Beispielen guter Praxis aus der Unternehmenswelt zu mobilen Arbeiten sowie von konkreten Handlungsempfehlungen für Mitarbeitende, Führungkräfte, Personalverantwortliche und gesellschaftliche Entscheidungsträger. Nach einem einleitenden Kapitel mit zentralen Definitionen für Phänomene in der mobilen Arbeitswelt bietet dieses Buch eine Zusammenfassung der Forschungsergebnisse und Empfehlungen auf fünf verschiedenen Ebenen – (1) einzelne Mitarbeitende , (2) Teams, (3) Führungskräfte, (4) Organisationen, (5) Politik & Gesellschaft – die auch die Oberstruktur des Buches darstellen.
Im zweiten Kapitel wird der Fokus auf den einzelnen Mitarbeitenden liegen, die im Homeoffice arbeiten. Exemplarische Fragestellungen auf dieser Betrachtungsebene sind: Ist das Arbeiten von zu Hause zuträglich für die eigene ProduktivitätProduktivität und GesundheitGesundheit? Wie kann man den Arbeitstag zu Hause möglichst optimal strukturieren? Gibt es Erkenntnisse darüber, ob es förderlich oder schädlich für die eigenen Karrieremöglichkeiten ist, wenn man häufig von zu Hause arbeitet?
Der dritte Abschnitt wird sich damit beschäftigen, wie man effektiv als Team in einer Homeoffice Situation zusammenarbeitet. Hierbei greifen wir vorwiegend auf die umfangreiche Forschungsliteratur zur Zusammenarbeit in virtuellen Teams zurück. Beispielhafte Fragestellungen sind, wie man kooperativ in virtuellen Teams zusammenarbeitet, was eine optimale TeamkulturTeamkultur ist, wie man einen optimalen Wissens- und Kommunikationsfluss in virtuellen Teams sicherstellt und mögliche KonflikteKonflikte vermeidet.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Rolle der Führungskraft während des mobilen Arbeitens. Beispielhafte Fragestellungen sind: Sollte eine Führungskraft im virtuellen Rahmen anders führen als in Präsenz? Welche Formen der Kommunikation sind optimal, um Mitarbeitende und Teams virtuell zu führen? Wie führt man am besten Gespräche mit Mitarbeitenden in virtuellen Rahmen durch und wie kann eine Führungskraft auch im mobilen Arbeiten charismatisch auftreten?
Im fünften Kapitel nehmen wir die Organisation als Ganzes in den Blick und beschreiben, welche Erkenntnisse es zu Maßnahmen und Praktiken gibt, die in der gesamten Organisation im Zuge eines mobilen Arbeitens zu gestalten sind. Dies betrifft zum Beispiel die Gestaltung des richtigen Onboardings von neuen Mitarbeitenden, die Ausgestaltung von digitalen Weiterbildungsformaten und das Design von Betriebsvereinbarungen zum Homeoffice und mobilen Arbeiten zwischen den Akteuren der betrieblichen Mitbestimmung.
Im sechsten Kapitel schließlich wollen wir über den Rahmen der Organisationswelt hinaus die politischen und gesellschaftlichen Perspektiven zunehmender mobiler Tätigkeiten diskutieren. Exemplarische Fragestellungen auf dieser Betrachtungsebene sind: Brauchen wir ein gesetzliches Recht zum Arbeiten von zu Hause und in welchen Ländern gibt es dies schon mit welchem Erfolg? Was bedeutet zunehmendes mobiles Arbeiten für KlimaKlima und UmweltUmwelt? Wird sich durch das mobile Arbeiten die Nachfrage von Büroraum hin zu innovativen Arbeitsorten wie Coworking SpacesCoworking Spaces verändern?
Für die Unterstützung bei der Entstehung möchten wir uns bei dem Exzellenzcluster der „Politischen Dimensionen von UngleichheitUngleichheit“ (EXC 2035), das durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert wird, für die Finanzierung der Umfragen für die Konstanzer Homeoffice StudieKonstanzer Homeoffice Studie bedanken. Zusätzlich gilt unser besonderer Dank unseren beiden wissenschaftlichen Hilfskräften Esther Rümelin und Carolina Opitz, die uns tatkräftig und gewissenhaft bei der Recherche und Formatierung für dieses Buchprojekt unterstützt haben. Schließlich bedanken wir uns auch ganz herzlich bei Herrn Dr. Jürgen Schechler vom UVK Verlag München für die Unterstützung bei der Konzeption und Gestaltung des vorliegenden Buches.
Konstanz im Juni 2021
Florian Kunze, Kilian Hampel, Sophia Zimmermann
Was die verwendeten Symbole bedeuten
Toni verrät dir spannende Literaturtipps, YouTube-Seiten und Blogs im World Wide Web.
Die Glühbirne zeigt eine Schlüsselfrage an. Das ist eine der Fragen zum Thema, deren Antwort du unbedingt lesen solltest.
Die Lupe weist dich auf eine Expertenfrage hin. Hier geht die Antwort ziemlich in die Tiefe. Sie richtet sich an alle, die es ganz genau wissen wollen.
→
Wichtige Begriffe sind mit einem Pfeil gekennzeichnet und werden im Glossar erklärt.
Homeoffice und mobiles Arbeiten, was ist das?
Bevor wir uns im Detail mit Implikationen und dem Management des mobilen Arbeitens für Mitarbeitende, Führungskräfte, Teams und Organisationen auseinandersetzen, wollen wir zunächst die notwendigen zentralen Begriffe in diesen Forschungsbereichen definieren. Dies geschieht in diesem einleitenden Kapitel durch die Abgrenzung wichtiger Definitionen und mit einem Fokus auf die historische Entwicklung von mobilem Arbeiten in Deutschland.
Was unterscheidet Telearbeit, Homeoffice und mobiles Arbeiten?
Schon zu Beginn des Phänomens des ortsungebundenen Arbeitens in den 1980er Jahren gab es keine einheitliche Terminologie, sondern verschiedene Begrifflichkeiten wie außerbetriebliche Arbeitsverhältnisse, Teleheimarbeit, elektronische →Heimarbeit bis hin zur →Telearbeit (Mühleis, 1997). Bis heute hat sich diese Begriffsvielfalt fortgesetzt. Deshalb werden wir in diesem Kapitel den Versuch einer Abgrenzung verschiedener zentraler Begrifflichkeiten vornehmen, die für den Rest dieses Buches verwendet werden sollen.
Uns erscheint es sinnvoll, bei zentralen Definitionen besonderes auch den rechtlichen Rahmen in Deutschland einzubeziehen. Telearbeit wurde rechtlich das erste Mal 2016 bei der Novelle der →ArbeitsstättenverordnungArbeitsstättenverordnung (ArbStättV) definiert und ist nach § 2 Abs. 7:
„Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten, für die der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt hat. Ein Telearbeitsplatz ist vom Arbeitgeber erst dann eingerichtet, wenn Arbeitgeber und Beschäftigte die Bedingungen der Telearbeit arbeitsvertraglich oder im Rahmen einer Vereinbarung festgelegt haben und die benötigte Ausstattung des Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich der Kommunikationseinrichtungen durch den Arbeitgeber oder eine von ihm beauftragte Person im Privatbereich des Beschäftigten bereitgestellt und installiert ist.“
Es muss also ein durch den Arbeitgeber fest eingerichteter Arbeitsplatz zu Hause vorliegen, damit Telearbeit legal stattfinden kann. Telearbeit kann demnach als komplette Teleheimarbeit oder als alternierende Teleheimarbeit stattfinden (Deutscher Bundestag, 2017). Häufig regeln Betriebsvereinbarungen, wie die Telearbeit innerhalb von Unternehmen und öffentlichen Organisationen auszugestalten ist.
Im Gegensatz zur Telearbeit ist das →mobile Arbeiten oder auch die mobile Telearbeit bisher nicht rechtlich definiert. Zentral für diese Art der Tätigkeit ist aber, dass diese nicht an das Büro oder den häuslichen Arbeitsplatz gebunden ist, sondern von überall erledigt werden kann. Zusätzlich sind Telearbeitende meistens in einem regulären Arbeitsverhältnis beschäftigt, wohingegen mobiles Arbeiten auch freie Mitarbeitende umfassen kann (Deutscher Bundestag, 2017).
Auch für das →Homeoffice gibt es keine rechtlich bindende Definition. Häufig wird Homeoffice synonym für den doch etwas antiquierten Begriff der Telearbeit benutzt und als das gelegentliche oder ständige Arbeiten in privaten Räumlichkeiten verstanden. Demnach muss also Telearbeit im engeren Sinn zwangsläufig im Homeoffice stattfinden. Mobiles Arbeiten ist jedoch nicht auf das Homeoffice beschränkt, sondern kann auch in dritten Räumlichkeiten zwischen Büro und zu Hause stattfinden. Die aktuelle Debatte zu einem Recht auf Homeoffice lässt vermuten, dass es bald zu einer legalen Definition von Homeoffice kommen könnte.
Für den weiteren Verlauf dieses Buches werden wir größtenteils den breiten Begriff des mobilen Arbeitens verwenden, der damit auch die Begrifflichkeiten der Telearbeit und des Homeoffices miteinschließt.
Quellentipp:
Die gesamte Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV) findet sich unter:
www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/BJNR217910004.html
Historie: Seit wann gibt es das Arbeiten von zu Hause?
Arbeiten von zu Hause ist kein Phänomen, das erst mit dem Aufstieg der InformationstechnologieInformationstechnologie und des Computers entstanden ist. Vielmehr war die →Heimarbeit schon seit dem Ende der industriellen Revolution in den 1850er Jahren vor allem in der Bekleidungs- und Textilindustrie üblich. Heimarbeit im Textilbereich wurde vor allem von weiblichen Beschäftigten ausgeführt (Baylina & Schier, 2002). Um die Jahrhundertwende 1900 war Heimarbeit ein durchaus bedeutender Teil der Produktion und Wertschöpfung in Deutschland und noch in den 1960er Jahren gab es in Deutschland über 200.000 registrierte Heimarbeiter:innen (Seebald, 1992). Dies führte dazu, dass Heimarbeitende schon 1911 in das Sozialversicherungssystem aufgenommen wurden und Heimarbeit auch während der nationalsozialistischen Herrschaft als eine wichtige nationale Aufgabe gesehenen wurde. 1951 wurde dann das Heimarbeitergesetz eingeführt, welches noch immer in Kraft ist. Dieses GesetzGesetz stellt Heimarbeitende unter einen ähnlichen Schutz wie regulär Beschäftigte. Entscheidend ist jedoch, dass dieses Gesetz Heimarbeitende nur als Produzent:innen definiert, die lediglich Auftragsarbeit wahrnehmen und keine Produkte selbst vertreiben (Baylina & Schier, 2002).
Seit den 1960er Jahren hat die klassische Heimarbeit in Deutschland allerdings stark an Bedeutung verloren. Im Jahr 2000 waren offiziell nur noch 5.600 Personen in Deutschland in Heimarbeit beschäftigt (Baylina & Schier, 2002). Das ist vor allem mit zunehmenden Automatisierungs- und Rationalisierungstendenzen in der Textilindustrie zu erklären, die später noch durch die Globalisierung der Wertschöpfungskette verstärkt wurden. Heute ist die Produktion der Textilindustrie nur noch zu marginalen Teilen in westlichen Industrieländern wie Deutschland angesiedelt. Dementsprechend ist es auch nicht betriebswirtschaftlich sinnvoll, die Produktion in diesem Sektor in manueller Tätigkeit von Beschäftigten in Deutschland von zu Hause erledigen zu lassen. Heimarbeit im Produktionssektor hat deshalb nur noch eine Nischenfunktion in Deutschland. Ganz anders verhält es sich mit der Büro- und WissenstätigkeitWissenstätigkeit von zu Hause, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen rasanten Aufstieg genommen hat und auf welcher der Hauptfokus dieses Buches liegt.
Seit wann gibt es die modernen Formen der Heimarbeit wie Telearbeit und Homeoffice?
Dass Arbeiten von zu Hause auch für Beschäftigte mit Bürotätigkeiten möglich ist, hängt zentral mit der Entwicklung der Informations- und Kommunikations-TechnologieInformations- und Kommunikations-Technologie seit den 1970er Jahren zusammen. Als Pionier der Forschung zum mobilen Arbeiten gilt Jack Nilles, der schon zu Beginn der 1970er Jahre die These aufstellte, dass „TelecommutingTelecommuting“ (Telependeln) in dicht besiedelten Gegenden wie Südkalifornien sinnvoll für viele Beschäftigte und Unternehmen sein könnte (Nilles, 1975). Wie der Name („Commuting“) schon vermuten lässt, war der Fokus vor allem darauf gerichtet, Pendelstrecken und KostenKosten durch das Arbeiten von zu Hause zu reduzieren. Angetrieben wurden diese Überlegungen besonders durch die beginnende Diskussion in vielen Industrienationen zur Energieknappheit, die durch die erste Ölkrise zum Ausdruck kam (Godehardt, 1994). Fortgesetzt wurde diese visionäre Perspektive von Autoren wie Toffler in den 1980er Jahren, der von verbesserten kommunalen Strukturen, reduzierter Umweltbelastung und neuen Familienstrukturen durch ein dezentrales Arbeiten von zu Hause träumte (Toffler, 1980).
Obwohl der Fokus dieser ersten Welle mobiler Arbeit nicht auf der Organisation und den Mitarbeitenden lag, konnte Nilles mit einem interdisziplinären Forschungsteam zeigen, dass →mobile Arbeit zu steigender ProduktivitätProduktivität, besserer GesundheitGesundheit der Mitarbeitenden und geringeren KostenKosten für die InfrastrukturInfrastruktur der Unternehmen bei einem untersuchten Pilotunternehmen führt (Nilles, 1975). Trotzdem war in den 1970er Jahren die Zeit für eine Transformation der Arbeitswelt hin zum mobilen Arbeiten, vor allem aufgrund der fehlenden technischen Möglichkeiten, noch nicht reif.
In Deutschland kamen erste Diskussionen und Anwendungen zur →Telearbeit in den 1980er Jahren auf. Ein Pilotprojekt war das Teletypist:innen Projekt der SiemensSiemens AG, in dem von zu Hause Text per Diktat erstellt und dann elektronisch in die Zentrale zurücktransferiert wurde (Wegener, 1983). Trotz dieser ersten Versuche bewegte sich die Anzahl der Telearbeiter:innen in den 1980er Jahren im Promillebereich (Kordey, 1994). Richtig Schwung in die Entwicklung kam erst zu Beginn der 1990er Jahre, als zum Beispiel IBM 1991 eine umfassende BetriebsvereinbarungBetriebsvereinbarung mit dem Ziel, innerhalb von 10 Jahren ca. ein Drittel der Tätigkeiten im Hauptquartier im Stuttgart in häusliche Arbeit zu verlegen, einführte (Glaser & Glaser, 1995).
Videotipp:
Historisches Video aus dem Jahr 1984 zu den technologischen Anfängen der Telearbeit:
https://www.youtube.com/watch?v=szdbKz5CyhA
Wie haben technologische Veränderungen zu der Entwicklung der mobilen Arbeit beigetragen?
Nach der Konzeption von Messenger und Gschwind (2017) lassen sich drei Phasen oder Generationen der Telearbeit unterscheiden, die vor allem nach der Verfügbarkeit der InformationstechnologieInformationstechnologie differenzieren.
In der ersten Generation sah Nilles (1975) das Arbeiten von zu Hause an fest installierten Computern und Telefonen als vollständigen Ersatz für die Präsenztätigkeit im Büro vor. In dieser ersten Generation der Telearbeit, die sich allerdings nie richtig etablierte, war die vollständige Verlagerung der Arbeit vom Präsenzbüro in ein stationäres Homeoffice vorgesehen.
Als zweite Generation der Telearbeit gilt die Arbeit im mobilen Büro. Flexiblere und mobilere IT und Kommunikationsgeräte, wie Laptops oder Mobiltelefone, führten dazu, dass man nicht mehr zwingend von zu Hause, sondern theoretisch ortsunabhängig seiner Wissens- und Bürotätigkeit nachgehen kann. Besonders bei Führungskräften im Marketing sowie im Finanzbereich gibt es seit den 1990er Jahren Beschreibungen in der Literatur zu diesen neuen mobilen Arbeitsformen (Kurland and Bailey, 1999). Mobiles Arbeiten ist weder zeitlich noch räumlich so eng begrenzt wie im Homeoffice, sondern kann sich auch in den Abend oder ins Wochenende verlagern. Auch kann an dritten Orten außerhalb des Büros und der Wohnung gearbeitet werden, wie beispielsweise in Cafés oder auf Reisen.
Die dritte Evolution der Telearbeit hat sich schließlich durch Smartphones, Tablets und Computer in Verbindung mit der konstanten virtuellen Konnektivität entwickelt, die wir heute in fast allen Industrie- und Schwellenländern haben. Schon 1997 wagten Makimoto und Manners in ihrem Bestseller „Digital Nomad“ die Prognose, dass die Zukunft der Arbeit ohne feste Präsenz, sondern durch vollkommene räumliche Flexibilisierung gekennzeichnet sein würde. In dieser dritten Generation der Telearbeit, dem virtuellen Office, ist es Angestellten möglich, ständig und von überall zu arbeiten, da mobile Zugänge zu jeder Zeit verfügbar sind und wichtige Daten und Informationen nicht lokal gespeichert, sondern über das Internet und Clouds dezentral abgerufen werden können. Nach Messenger und Geschwind (2017) ist dadurch Arbeiten auch an intermediären Orten, wie Parkplätzen, den Bürgersteig oder dem Aufzug möglich.
Wer kann eigentlich mobil arbeiten?
Während des gesellschaftlichen Lockdowns in der Corona-PandemieCorona-Pandemie schien es in der öffentlichen Debatte fast so, als würde die ganze Erwerbsbevölkerung mobil arbeiten. Bei systematischer Analyse der Zahlen wird aber deutlich, dass das Arbeiten von zu Hause nur für eine Minderheit der Beschäftigten möglich ist und stark über verschiedene Tätigkeiten und Industrien variiert. Aktuelle Zahlen aus Deutschland zeigen, dass Homeoffice vor allem in dem Bereich der unternehmensbezogenen Dienstleistungen sowie der Unternehmensführung mit über 40 Prozent Nutzung schon stark angewendet wird. In anderen Bereichen hingegen, wie Verkehr und Logistik oder Fertigungstätigkeiten, ist Arbeiten von zu Hause nur für einen marginalen Anteil von weniger als 10 Prozent der Beschäftigten möglich (ZEW, 2020).
Auch in internationalen Studien zum Beispiel in den USA und Großbritannien gibt es ähnliche Ergebnisse. So kommt die sehr umfassende Studie von Adams-Prassel und Kollegen (2020) zu dem Ergebnis, dass es besonders bezüglich der Tätigkeitsebene große Unterschiede bei der Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten gibt. So können im Gastronomiebereich nur drei Prozent der Tätigkeiten von zu Hause verrichtet werden, wohingegen es für Softwareentwickler:innen zu 89 Prozent möglich ist, mobil zu arbeiten. Zusätzlich wird in dieser Studie deutlich, dass die Möglichkeit mobil zu arbeiten nicht gleich über die gesellschaftlichen Gruppen hinweg verteilt ist. So können in Großbritannien unter 20 Prozent aus der niedrigsten EinkommensgruppeEinkommensgruppe (weniger als 10.000 Pfund Einkommen) von zu Hause arbeiten, wohingegen bei der höchsten Einkommensgruppe (mehr als 70.000 Pfund Einkommen) das Arbeiten im Homeoffice für mehr als 60 Prozent der Tätigkeiten möglich ist. Zusätzlich zeigt sich ein starker statistischer Zusammenhang mit dem Bildungsgrad der Beschäftigten und der Möglichkeit von zu Hause zu arbeiten.
Ebenso kommt eine aktuelle Studie von Dingel und Neimann (2020) zu dem Ergebnis, dass in den USA 37 Prozent der Tätigkeiten komplett von zu Hause erledigt werden können. Allerdings stehen diese Jobs für 45 Prozent der Löhne in den USA, was ebenfalls die UngleichheitUngleichheit bei der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten deutlich macht. In Entwicklungs- und Schwellenländern wird dies noch deutlicher durch den Fakt, dass bei Staaten mit 30 Prozent der amerikanischen Wirtschaftsleistung weniger als 14 Prozent der Tätigkeiten von zu Hause erledigt werden können.
Diese Ungleichheitsperspektive ist wichtig, wenn es darum geht, mobiles Arbeiten in Organisationen mit sehr unterschiedlichen Tätigkeiten einzuführen oder auch im Rahmen einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive über ein Recht auf Homeoffice für alle Beschäftigten zu diskutieren. Diese Themen werden wir im Kapitel zu den politischen und gesellschaftlichen Folgen der mobilen Arbeit vertiefen.
Was sind eigentlich Coworking SpacesCoworking Spaces?
Ein weiterer wichtiger Faktor in der Diskussion um moderne und flexible Arbeitsformen sind →Coworking SpacesCoworking Spaces. Hierbei handelt es sich, um eine Mischform zwischen Bürotätigkeit und mobiler Arbeit, indem Wissensarbeitende auf Tages- oder sogar Stundenbasis Büroarbeitsplätze anmieten können, um mobil für einen Arbeitgeber:in oder auch in selbständiger Tätigkeit zu arbeiten (Bouncken & Reuschel, 2018). Wichtig ist die Schreibweise ohne Bindestrich (Coworking), um auf die individuelle Arbeit in einem gemeinschaftlichen Arbeitsplatz abzuzielen, im Gegensatz zu der Schreibweise mit Bindestrich (Co-Working), die das kollektive Zusammenarbeiten an einer gemeinsamen Aufgabe meint (Gandani, 2015). Entstanden ist dieser Trend 2005 in San Francisco als eine dritte Form der Arbeit zwischen Homeoffice und Präsenzarbeit. Coworking sollte besonders der empfundenen Einsamkeit von selbständig Beschäftigten entgegenwirken, die sonst permanent allein von zu Hause arbeiten würden (Gandani, 2015). Auch die psychologische Belastung durch die EntgrenzungEntgrenzung zwischen Arbeit- und Privatleben soll durch Coworking Spaces verbessert werden (Pohler, 2012). Ob diese Gesundheitseffekte und auch die vermutete Produktivitätssteigerung wirklich zutreffend sind, ist aufgrund der beschränkten empirischen Studienlage noch unklar (Bouncken & Reuschel, 2018).
Inzwischen sind Coworking SpacesCoworking Spaces dennoch ein globaler Trend geworden, mit steigenden Zahlen von Coworking-Möglichkeiten besonders in urbanen Ballungsgebieten. So haben sich von den drei ursprünglichen Coworking Spaces in San Francisco 2005 inzwischen geschätzte 26.300 weltweit im Jahr 2020 entwickelt (Statista, 2020). Inzwischen gibt es Anstrengungen, Coworking-Möglichkeiten auch außerhalb der urbanen Zentren zur ermöglichen, um so mobiles Arbeiten in Gemeinschaft auch ohne lange Pendelwege in Ballungsgebieten zu ermöglichen (Zeit, 2020). Ob dies eine Arbeitsform der Zukunft in Städten und in der Fläche ist, werden wir an anderer Stelle in dem Kapitel zu den gesamtgesellschaftlichen Debatten von mobilem Arbeiten genauer diskutieren.
Homeoffice und mobiles Arbeiten für einzelne Mitarbeitende
Das nachfolgende Kapitel beschäftigt sich mit Auswirkungen von mobilem Arbeiten auf Faktoren, welche die einzelnen Mitarbeitenden betreffen. Hier geht es sowohl um die Arbeitsleistung und ArbeitszufriedenheitArbeitszufriedenheit als auch um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, welche durch mobiles Arbeiten und das Verschwimmen der Grenzen von Arbeit und Privatem einen hohen Stellenwert erhält. Zusätzlich werden auch konkrete praktische Tipps entwickelt, wie man gesund, zufrieden und produktiv mobil arbeiten kann.
Habe ich mehr AutonomieAutonomie, wenn ich mobil arbeite?
Eine zentrale Annahme der Literatur zum mobilen Arbeiten ist, dass mobile Arbeit die Wahrnehmung von →AutonomieAutonomie erhöht (Gajendran, Harrison & Delaney-Klinger, 2015). Autonomie spiegelt das Ausmaß der Freiheit wider, in welchem Mitarbeitende selbst bestimmen können, wo, wann und wie sie ihre Arbeit verrichten (Spector, 1986). Mobile Arbeit ermöglicht Mitarbeitenden größere Kontrolle über ihren Arbeitsort und oftmals auch über die zeitliche Planung von Arbeit. Denn mobil Arbeitende können von jedem beliebigen Ort arbeiten – von zu Hause, Cafés oder →Coworking SpacesCoworking Spaces. Darüber hinaus können mobil Arbeitende tendenziell ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten zeitlich flexibler strukturieren, da sie sich der sozialen Kontrolle durch Führungskräfte und Kolleg:innen entziehen (Gajendran & Harrison, 2007). Zusätzlichen haben mobil Arbeitende Kontrolle über Pausen, Kleidung, Lichtverhältnisse, Temperatur, Musik, was zu ihrem Gefühl von Autonomie bei der Arbeit beitragen kann.
Empirische Studien unterstützen diese theoretischen Überlegungen. Mobil Arbeitende nehmen eine größere AutonomieAutonomie als traditionell Arbeitende in Präsenz wahr (Gajendran & Harrison, 2007; Gajendran et al., 2015). Außerdem ist die wahrgenommene Autonomie umso größer, je umfangreicher mobil gearbeitet wird (Gajendran et al., 2015). Darüber hinaus zeigt die Forschung, dass eine stärkere Wahrnehmung von Autonomie durch mobile Arbeit wiederum zu positiven Ergebnissen führt, wie beispielsweise größerer ArbeitszufriedenheitArbeitszufriedenheit und Leistung sowie weniger Kündigungsabsichten (Gajendran & Harrison, 2007).
Beeinflusst mobile Arbeit meine Arbeitsleistung?
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass mobile Arbeit viele Vorteile bietet, die zu einer höheren Arbeitsleistung führen können. Beispielsweise können mobil Arbeitende ihre Arbeitsroutinen so verändern, dass sie besser zu ihrem Produktivitätsrhythmus und Arbeitsstil passen. Außerdem gibt es während des mobilen Arbeitens in der Regel weniger Ablenkungen und Unterbrechungen und es können Ressourcen durch wegfallende Pendelwege eingespart werden. Eine Vielzahl von empirischen Studien unterstützt die Annahme, dass mobile Arbeit leistungsförderlich ist. Der positive Effekt von mobiler Arbeit auf die Mitarbeiterleistung ist unter Verwendung vielfältiger methodischer Vorgehensweisen nachgewiesen worden.





























