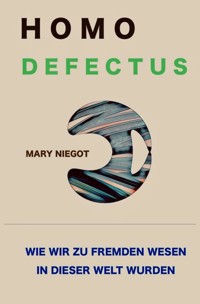
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Dieses Buch ist eine Einladung zu mehr Zärtlichkeit zu uns und der Welt gegenüber. Es begibt sich auf die Spurensuche zum Beginn der chronischen Angststörung unter uns Menschen und deren Entwicklung bis heute. Zumindest in unserer Vorstellung wurden wir unvollständige, defekte und unzulängliche Wesen, die im Grunde niemals unbeaufsichtigt bleiben dürfen, als würden uns essenzielle Teile fehlen, die wir erst im Außen suchen und integrieren müssen, um überhaupt ganz Mensch sein zu können. Mary Niegot sucht nach einer Möglichkeit, wie wir mit dem ständigen Kampf gegen die Welt aufhören und die Ganzheit, die ist, wieder wahrnehmen können
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Homo defectus
Wie wir zu fremden Wesen in dieser Welt wurden
Impressum
BIBLIOGRAPHISCHE INFORMATIONDER DEUTSCHEN NATIONALBIBLIOTHEK: DIE DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEKVERZEICHNETDIESE PUBLIKATIONINDER DEUTSCHEN NATIONALBIBLIOGRAPHIE; DETAILLIERTEBIBLIOGRAPHISCHE DATENSINDIM INTERNETÜBERDNB.DNB.DEABRUFBAR.
DIEAUTOMATISIERTE ANALYSEDES WERKES, UMDARAUS INFORMATIONENINSBESONDEREÜBER MUSTER, TRENDSUND KORRELATIONENGEMÄß §44B URHG („TEXTUND DATA MINING“) ZUGEWINNEN, ISTUNTERSAGT.
EINEHAFTUNGFÜRIMTEXTENTHALTENEEXTERNELINKSISTSTETSAUSGESCHLOSSEN.
TEXTUND VERLAG: ©2025 BY MARY NIEGOT
BURGTORSTARßE 37A, 56567 NEUWIED
COVERGESTALTUNG: © OLIVER RUPPEL
SATZ: MARY NIEGOT
DRUCK: EPUBLI – EIN SERVICEDER NEOPUBLI GMBH, BERLIN
HERSTELLUNG: EPUBLI - EIN SERVICEDERNEOPUBLI GMBH, KÖPENICKER STRAßE 154A, 10997 BERLINKONTAKTADRESSENACH EU-PRODUKTSICHERHEITSVERORDNUNG: [email protected]
Wau, Wau Wau, Wauwauwauwau,
Wuff Wau, Wau Wau Wau; Wuaaa,
Wuff, Grrrr, Wau Wau Wau, Wau Wuff!
Wau, Wau, Wau, Waaau, Wau?
(Hundbert von T., Appalachian Rhapsody, 2025)
Vorwort
Ich habe selten Menschen getroffen, die so sehr den Fokus auf Gegenwärtigkeit, Lebendigkeit, Klarheit und Entschiedenheit legen können wie Mary Niegot; dies meine ich vor allem auch in der Verbindung von rationalem und sinnlichem Denken. Und es ist ziemlich erstaunlich, da es selten vorkommt, dass man auf Menschen trifft, die zu einer Hingabe an die Existenz wirklich Ja sagen wollen. Denn diese Hingabe ist durchaus auch etwas Ungemütliches und Schmerzhaftes, zu der man dann bereit sein muss. Die Mehrheit der Menschen, mit denen wir leben, tut alles, um diese Art der Entschiedenheit zu vermeiden. Denn hinter ihr lauert ja das Gefühl einer tiefen Hilflosigkeit, die eigentlich niemand mehr fühlen will. Jemand mit einem solchen Mut zur Hingabe fällt auf und ist erstaunlich. Wer sich auf diese Art verletzlich macht, nimmt Dinge wahr, die andere verdrängen möchten. Oft spricht so jemand auch Dinge an, die andere nicht hören und sehen möchten. Es liegt immer eine Bedrohung in der Luft, dass die Wahrheit, die wir nicht sehen wollen, angesprochen wird, und dies nicht aus der Kritik am Anderen, sondern aus der Wahrheit heraus, die jemand zu sich selbst hat. Schließlich zeigt er mir durch seine Echtheit, dass ich diese auch haben müsste.
„Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in.”
Das sang Leonard Cohen in „Anthem“. Es gibt eine natürliche Fehlerhaftigkeit, die sein muss, weil Perfektion und Lebendigkeit nicht zusammenpassen. Wir benötigen Menschen, die darauf hinweisen. Für diese Menschen ist es nicht leicht, allerdings müssen sie auch nicht verdrängen, und das ist eben weniger kompliziert als uns das Leben gemeinhin erscheint, welches wir in der Matrix unserer neuzeitlichen Kultur leben. So etwas zu können, bedeutet, zart sein zu können, Zärtlichkeit zu haben und vulnerabel zu sein. Solche Menschen können uns Mut machen, zur eigenen Lebendigkeit zurückzufinden, nicht, indem sie an Utopie bauen, sondern in dem sie sagen, was sie wahrnehmen. Wenn ich über so etwas rede, fällt mir immer Joseph Beuys ein, der sagte: „Zeig mal deine Wunde. Wer seine Wunde zeigt, wird geheilt. Wer sie verbirgt, wird nicht geheilt.“ Das vorliegende Buch von Mary Niegot ist ein Blick in den Riss, in die Wunde. Der Text ist eine echte und wichtige Chance, die man ergreifen kann. Ich kann jedem nur raten, dies mit mehr Mut als Angst zu tun. Wer in diesen Riss schaut, der kann im Licht die Lebendigkeit funkeln sehen.
Oliver Ruppel, April 2025
Roadtrip mit Kindern: Eine Einführung
Ich kannte mal einen Mann, einen recht erfolgreichen Anwalt, Mäzen und Kunstsammler, mit dem ich als junge Psychologiestudentin auf einem ziemlich verrückten Roadtrip in Portugal war. Unter meinen Reisebegleitern befanden sich auch sein Sohn, ein ewiger Student der Betriebswirtschaft, sowie ein noch recht junger Professor für Raumfahrttechnik. Zu erklären, wie diese seltsame Konstellation zustande gekommen war, würde hier eindeutig zu weit führen. Wir übernachteten in schicken Hotels einer Kette, von welcher der Anwalt im Vorstand war. Seitdem weiß ich, wie Schwertfisch schmeckt. Aber mehr noch als der Schwertfisch sind mir die teilweise bizarren Erlebnisse in Erinnerung geblieben, die sich aus der seltsamen Beziehungstragik entwickelten, die zwischen den drei Männern herrschte. Der Anwalt, ein rundlicher Mann in seinen Siebzigern, trug stets Hosen mit Gürtel und Hosenträgern sowie eine Art Anglerweste mit unzähligen Taschen. Immer, wenn wir in einem Hotel ankamen, stopfte er sich als allererstes die Taschen seiner Westen voll mit Kugelschreibern und Postkarten, die sich in Drehständern an der Rezeption befanden, und griff beherzt in die Schüsseln mit bunten Bonbons, die dort ebenfalls standen, um sich seine Hosentaschen mit den Süßigkeiten zu befüllen. Seinem Sohn war das immer sichtlich peinlich, der Raumfahrttechniker lachte darüber, ich wunderte mich.
An den Abenden wurde immer gut gegessen und die Männer tranken viel, ich blieb nüchtern, nicht aus Anstand, sondern weil ich Alkohol damals einfach nicht besonders mochte. Die Abende endeten stets damit, dass einer der Männer noch mit mir an der Hotelbar saß und alkoholselig eine Art Beichte ablegte. Bei einer dieser Gelegenheiten fragte ich den Anwalt, warum er eigentlich immer Kugelschreiber und Postkarten horte, woraufhin er peinlich berührt lachte und mit etwas weinerlicher Stimme sagte: „Ich fühle mich immer noch arm, weißt du. In meinen Gedanken bin ich noch ein armer, kleiner Junge. Ich weiß es ja, dass es nicht so ist. Aber irgendwie glaube ich es immer noch nicht, dass ich jetzt ein reicher, alter Mann bin. Und das Verrückte ist, ich glaube immer noch, ich tue meinen Eltern etwas an, wenn ich aufhöre, der arme kleine Junge zu sein. Die hatten doch nichts. Ich verdanke ihnen doch alles und jetzt habe ich so viel und sie hatten nichts. Man sollte doch nie vergessen, wo man herkommt. Das ist doch wie Verrat. Schwachsinnige Gedanken, ich weiß. Aber so ist es nun einmal. Ich habe viele solcher schwachsinnigen Gedanken, aber ich werde sie einfach nicht los.“
An einem der anderen Abende saß sein Sohn mit mir zusammen an der Bar und klagte mir sein Leid. „Ich bin eine große Enttäuschung für meinen Vater. Er hält mir ständig vor, wie schwer er es hatte und wie undankbar ich bin. Ich bin es so satt. Ich mache nichts richtig, nie ist er zufrieden. Ich wollte nie Betriebswirtschaft studieren, alles daran kotzt mich an. Aber wenn ich es nicht durchziehe, bin ich ja endgültig ein Versager.“
Schließlich eröffnete mir der Raumfahrttechniker: „Meine Mutter ist eine Glucke, sie behandelt mich noch immer wie ein Kind. Meinem Vater bin ich völlig egal. Der Anwalt (hier nannte er natürlich seinen Namen) ist für mich mehr Vater, als meiner es je war. Ich fühle mich ihm näher als meinen eigenen Eltern. Ich habe aber immer dieses schlechte Gewissen, vor allem meiner Mutter gegenüber. Sie meint es ja nur gut. Aber sie macht mich wahnsinnig.“
Ich war damals etwas verliebt in den Raumfahrttechniker und hätte ihn gerne geküsst, aber ich dachte, dass er von jemandem wie mir sicher nicht geküsst werden möchte. Heute denke ich: Das war ein schwachsinniger Gedanke, ich hätte es einfach ausprobieren sollen.
Aber warum erzähle ich diese Geschichte? Weil sie zeigt, wie mächtig die Geschichten sind, die unsere Familien uns mitgeben, selbst, wenn wir schon längst in unseren eigenen Geschichten leben könnten. Wie schwer es ist, wirklich wir selbst zu sein zwischen all den Geschichten in unserem Kopf, in denen wir die uns vorgegebenen Rollen spielen und die uns die Sicht auf uns selbst verstellen. Sie kleben an uns wie Pech und ziehen uns wie Strudel an einen Ort, an dem wir gar nicht mehr sein wollen. Und mehr noch, sie katapultieren uns aus der Wirklichkeit heraus und lassen uns einfach nicht erwachsen werden
1. Das ewige Kind
Der 2018 verstorbene US-amerikanische Autor Philipp Roth schrieb 1991 den autobiographischen Roman „Mein Leben als Sohn“, in dem er schildert, wie er die letzten gemeinsamen Lebensmonate mit seinem schwerkranken, immer mehr dahinschwindenden Vater verbrachte und in dieser Zeit selbst einen lebensbedrohlichen Herzinfarkt erlitt, was er seinem Vater aber verschwieg, um diesen nicht zu beunruhigen. In dem Buch ist viel von Pflicht die Rede, von den Qualen der Erkenntnis, dass alles Leben endlich ist und der Verfall vor Niemandem Halt macht, egal, wie stark man auch in der Blüte seines Lebens gewesen sein mag.
Dieses Buch – und das offensichtlich gemeinsame Interesse an Literatur – stellte eine der wenigen positiven Verbindungen zwischen dem Rechtsanwalt und seinem Sohn dar. Sie schienen beide aus unterschiedlichen Gründen von dem Buch begeistert zu sein, was sie aber nicht daran hinderte, sich auch hierüber leidenschaftlich zu streiten. Ich las dieses Buch damals, weil ich verstehen wollte, was die beiden darüber so in Wallung brachte. Es gefiel mir nicht besonders, aber ich bekam eine Ahnung davon, warum es Vater und Sohn auf so unterschiedliche und doch sehr ähnliche Weise berührt hatte. Interessant dabei fand ich vor allem, dass beide Männer sich selbst ausschließlich mit der Perspektive des Sohnes identifizierten, sich beide durch den Roman in Kindheitserinnerungen und Gefühle aus vergangenen Zeiten versetzt fühlten, die vor allem mit dem Vater als unerreichbare, sich stets an einem fernen Horizont aufhaltende Figur verbunden waren. Daraus ergab sich offenbar auch die Unmöglichkeit von Vater und Sohn, im Gespräch tatsächlich zueinander zu finden. Beide Männer waren nicht in der Lage, sich von der Position zu lösen, die sie eigentlich schon lange nicht mehr innehatten und machten es sich so unmöglich, sich als die erwachsenen Männer zu begegnen, die sie inzwischen waren. Sie erschienen mir gefangen in der Rolle, die ihnen durch den familiären „Rang“ zugeschrieben worden war, der eine der Vater, der sich – wie Roths Vater auch – aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hatte und doch innerlich der arme Junge geblieben war und den ständige Schuldgefühle plagten, der andere das Kind, des so ganz anders war als der Vater, darum der ewig zu korrigierende, zu erziehende und stets hinter den Erwartungen zurückbleibende Sohn, der sich nie als genügend empfand. Beide wollten vom jeweils anderen als das gesehen werden, als das sie sich innerlich fühlten, nämlich als Kinder, die ihr Bestes versuchten und doch immer wieder in dem Gefühl der Unzulänglichkeit landeten, und gleichzeitig bemühten sie sich angestrengt darum, genau dieses Gesehenwerden um jeden Preis zu verhindern, um Verletzungen zu vermeiden. Ihr jeweiliges „Leben als Sohn“ stand wie eine Mauer zwischen ihnen. Ein unglaublich anstrengendes Unterfangen, das jedes Mal in einem dramatischen Abzug des Vaters endete. Einmal, als wir uns gerade in der alten Universitätsstadt Coimbra befanden, blieb der Rechtsanwalt sogar einen ganzen Tag lang verschwunden und wir suchten ihn, klapperten die Krankenhäuser ab und die Plätze, die wir zuvor besucht hatten, aus Sorge, ihm sei etwas passiert. Es war noch nicht die Zeit der Mobiltelefone. Am Abend marschierte er dann in die Lobby, als sei nichts geschehen und berichtete davon, er habe eine bezaubernde Japanerin im Park kennen gelernt, mit der er dann essen gegangen sei.
Andere Male wurde ich Zeugin von innigen Augenblicken zwischen Vater und Sohn, die nicht lange anhielten, aber mir eine Idee davon vermittelten, warum die „schönen Momente“, von denen heute viele meiner Patientinnen und Patienten sprechen, auch, wenn sie eine noch so grausame Kindheit hatten, so einen starken Klebstoff darstellen. Auf einer längeren Fahrtstrecke in die Algarve sangen Vater und Sohn alte Schlager und Lieder aus DEFA-Zeiten und sprachen ganze Dialoge aus Filmen nach, die Stimmung im Auto war gelöst und heiter, es wurde viel gelacht und die portugiesische Landschaft flog an uns vorbei wie die Kulisse aus einem der alten Filme. Damals dachte ich erstmalig über den Begriff „Vermächtnis“ nach, und wie ähnlich er dem des „Verhängnisses“ ist. Was den Raumfahrtingenieur angeht, so erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr an sehr vieles von dem, was er erzählte. Ich erinnere mich aber noch daran, dass ich mich mit ihm auch durch das Unbehagen, das wir angesichts der teilweise sehr lauten und verletzenden Streitereien von Vater und Sohn empfanden, verbunden fühlten. Und daran, dass auch ich mir als Tochter meiner Eltern damals selbst im Weg stand, die gelernt hatte, ihre eigene Wildheit radikal zu zähmen und auf dem Pfad der Anständigkeit zu bleiben, denn niemand mag wilde Mädchen. So dachte ich damals. Darum küsste ich ihn nicht.
Heute, dreißig Jahre später, höre ich in meiner psychologischen Praxis täglich Geschichten von Menschen, deren Tragik darin besteht, ihre Verbundenheit zu den gegenwärtigen Menschen um sie herum dem Umstand zu opfern, ihr Leben lang geliebte Söhne und Töchter sein zu wollen, auch, wenn die eigenen Eltern schon längst verstorben sind oder die ersehnte Liebe und Annahme durch die Eltern sich trotz aller Bemühungen nie einstellte. In der Hoffnung auf die Erlösung und Rettung durch den heilenden Segensspruch „Ich liebe dich so, wie du bist, mein Kind!“ rackern sie sich ab, wüten gegen andere, geben sich selbst auf, misstrauen sich und der Welt und fallen in abgrundtiefe Erschöpfung, oft ohne zu wissen, warum. Es ist allerorts zu beobachten, dass die Anzahl psychisch stark belasteter Menschen stetig zunimmt, wir leben inzwischen in einer Gesellschaft der Erschöpften, so, wie es der südkoreanisch-deutsche Philosoph Byung-Chul Han in seinem Essay „Müdigkeitsgesellschaft“ (Verlag Matthes und Seitz, 2010) bereits treffend beschreibt
Da stellt sich die Frage: Wie kommt es, dass aus dem System Familie, das als Hort des Schutzes, der Nähe und Fürsorge gilt, eine Brutstätte für Menschen geworden ist, die sich fast durchweg als „Homo defectus“, als unvollständiges Mängelexemplar, empfinden, welches sich ein Leben lang seine Daseinsberechtigung beweisen muss und jegliches Vertrauen in seine innere Führung verloren hat? Das, um sich vermeintlich ganz zu fühlen, stets auf der Suche ist nach symbolischen Selbstergänzungen wie Eigentum, Schönheit, Erfolg und Sichtbarkeit, mit denen dieses Ziel jedoch bekanntermaßen nicht erreicht wird?
Es ist nicht verwunderlich, dass die Idee vom „inneren Kind“ so viele Anhänger hat, die dieses Konzept mit einem fast religiösen Eifer verteidigen, trifft es doch das Grundgefühl vieler Menschen, dass man doch eigentlich immer noch nicht so richtig für sich selbst stehen könne in dieser großen, bedrohlichen Welt, dass die Welt einem noch etwas schuldig sei an Liebe und Zuneigung, die man nie bekommen habe. Bis diese Schuldigkeit eingelöst sei, sei es eben nicht möglich, sich selbst und andere ausreichend zu lieben. Das Bild des „inneren Kindes“ trifft dieses Gefühl offensichtlich zielgenau, jedoch zementiert es die Problematik paradoxerweise durch den Blick, den wir immer noch auf Kinder und auch auf uns selbst haben, nämlich als defekte Wesen, die Erziehung von außen benötigten, und zwar durch einen Erwachsenen. So versucht ein traumatisierter Erwachsener ein traumatisiertes Kind zu heilen, und der Missbrauch geht im Grunde weiter. Denn das Kind existiert schon lange nicht mehr, es kann nicht mehr geheilt werden, es kann nichts wieder gut gemacht oder entschädigt werden, so, wie auch kein vergangenes Unheil zukünftig vermieden werden kann. Es kann nur die Ursache für das gegenwärtige Unheil erkannt und verstanden werden, der Versuch, vergangenes Unheil zu vermeiden, mündet häufig in genau der Wiederholung dessen, was man zu vermeiden sucht.
Es existiert schließlich nur noch der erwachsene Mensch, der in der radikalen Zuwendung zu seiner gegenwärtigen Lebenswirklichkeit, der äußeren sowie der inneren, herausfinden kann, wie das eigene Leben tatsächlich gelebt werden kann, jenseits der Geschichten, die von den Eltern und anderen Erziehungsinstanzen mitgegeben wurden, jenseits aller dazugehörigen Ideologien und Lügen und Erzählungen über Gut und Böse, Richtig und Falsch, Nützlich und Nutzlos. Es geht darum, herauszutreten aus der ewigen Suche nach dem vermeintlich trauten, sicheren Zuhause und zu begreifen, dass Hänsel und Gretel - anstatt zum missbräuchlichen Vater zurückzukehren – keine Angst mehr vor dem Wald zu haben brauchen und den Verlockungen eines Knusperhäuschen nicht mehr erliegen müssen. Der Wald war nur beängstigend, weil das Elternhaus beängstigend war, das Knusperhäuschen nur verlockend, weil man zuhause hungrig blieb. Wären Hänsel und Gretel gut ernährte, geliebte Kinder gewesen, sie hätten den Wald längst erforscht, sich darin gut ausgekannt und das Knusperhäuschen samt Hexe links liegen lassen, denn die Verlorenheit und die Angst entstehen aus den Versagungen und dem Mangel, vor allem dem Mangel an Vertrauen.
Das Märchen von Hänsel und Gretel zeigt auf perfide Weise auf, welches Bild von Welt oft durch Erziehung in unsere Köpfe eingepflanzt wird. Die Natur und das Fremde sowie die natürlichen Bedürfnisse und Gelüste werden als bedrohliche Gefahr dargestellt. In der Urfassung des Märchens war die „böse Stiefmutter“ – wie in vielen anderen „Kinder-und Hausmärchen“ der Gebrüder Grimm auch – die leibliche Mutter. Dieses wurde erst in einer der späteren Ausgaben von den Grimms geändert, da es ihnen zu drastisch erschien. Das Böse muss das Fremde sein, das, was im Außen lauert und Kinder aussetzt oder sie gar frisst. So wachsen wir als Kinder auf in der Angst vor Knusperhexen und dem finsteren Wald, denen man nur mit List und Lügen entkommen kann. Das Leben in einer zutiefst ungleichen Gesellschaft mit heillos überforderten Erwachsenen wird als tragisch, aber normal hingenommen. Dabei liegt dort der eigentliche Ursprung der Misere.
Der Rechtsanwalt stopfte sich seine Taschen deswegen voll, weil er sich immer noch wie das arme Kind fühlte, und er war nicht in der Lage, eine tiefere, echte Verbindung zu seinem Sohn aufzubauen, weil er immer noch im Wald herumirrte und den Weg nach Hause suchte, die Taschen voller Beute, so, wie Hänsel und Gretel die Schätze aus dem Haus der Hexe einsammeln, nachdem sie diese in den Ofen gestoßen haben, um damit zum lieblosen Elternhaus zurückzukehren.
In dieser Geschichte zeigt sich die problematische Agenda, die der Erziehung von Kindern unterliegt, die dazu führt, dass wir zeitlebens nicht erwachsen werden können und es auch oft nicht wollen.
Steffen Martus schreibt in seiner Biographie über die Gebrüder Grimm
„Die Grimms – beide bekennende Monarchisten und zeitlebens den „Democraten“ gegenüber skeptisch eingestellt – schätzten durchaus den „natürlichen Vorgesetzten“. „Gewöhnen“ wollten sie an diese Achtung jedoch auf eine revolutionäre Weise. Sie empfahlen dafür den Blick in die Märchen, Mythen und Sagen, in Gedichte und Epen, in die Sprache der Rechtsgeschichte, in jenes „seltsame Fortleben der Trümmerwelt“ (Richard Wagner), die sie wie niemand zuvor sonst vor ihnen durchwühlt haben.“ (Steffen Martus: Die Brüder Grimm: Eine Biographie. S.9, Rowohlt Berlin, 2010)
Erziehung ist damals wie heute immer noch ein Instrument der Gefügigmachung. Die meisten Bemühungen, die Eltern an ihren Kindern vornehmen, dienen dazu, aus Ihnen „glückliche und erfolgreiche Menschen“ zu machen, am Ende soll das Happy End wie im Märchen stehen, der Sohn oder die Tochter in einer glücklichen Beziehung und im materiellen Wohlstand. Auch, wenn es zumeist heißt, „Ich will nur, dass du glücklich bist“. Dieser Satz bedeutet allzu häufig nämlich „Jetzt befolge endlich unsere Anweisungen und sei damit glücklich, damit wir uns als gute Eltern fühlen können und keine Angst mehr zu haben brauchen.“ Das Bannen der eigenen Ängste durch die ritualhafte Wiederholung von Beschwörungen und Zaubersprüchen, wie „Sei vorsichtig“, „Mach deine Hausaufgaben“, „Streng dich mal mehr an“, „Du bist was ganz Besonderes.“, „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“ etc., etc. dient vorwiegend der Selbstberuhigung, die jedoch natürlich nicht eintritt, denn kein Mensch kommt auf diese Welt, damit ein anderer beruhigt sein kann.





























