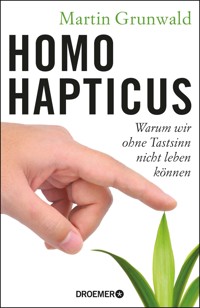
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wissenschaft zum Anfassen: "Fühlen und tasten ist viel wichtiger für unser Überleben als sehen, hören, riechen und schmecken", sagt Martin Grunwald. In seinem Sachbuch "Homo hapticus" - Gewinner des Wissenschaftsbuchpreises 2018 in der Kategorie Medizin/Biologie - beschreibt der experimentelle Psychologe erstmals für ein breites Publikum, welch überragenden Einfluss der lange Zeit unterschätzte Tastsinn auf alle menschlichen Lebensbereiche hat. Anschaulich und mit vielen Beispielen aus dem Alltag erzählt Grunwald, wie faszinierend die Millionen Berührungs- und Bewegungsmelder zusammenwirken, die unseren Tastsinn ausmachen. Mit Erkenntnissen aus Medizin, Biologie und Psychologie zeigt er, · welch große biologische und psychologische Bedeutung Berührungen für Menschen aller Altersstufen haben, · warum eine Umarmung mehr tröstet als tausend Worte, warum Massagen und Spaziergänge gegen Depression und Angst helfen, · wie die Haptikforschung in Medizin, Erziehung und Bildung genutzt wird und · warum wir mit warmen Händen bessere Chancen bei einem Bewerbungsgespräch haben. Schließlich macht Grunwald deutlich, wie raffiniert unser Urteil durch die Haptik von Produkten manipuliert werden kann - und er warnt vor einer Welt voller kalter, gefühlloser Touchscreens: "Ein Mensch kann taub, blind und stumm geboren werden, doch ohne Tastsinn können wir nicht überleben." Wer dieses Buch zur Hand nimmt, wird sein Leben und seine Umwelt neu be–greifen. »Fühlen ist viel wichtiger für unser Überleben als sehen, hören, riechen und schmecken.« Martin Grunwald
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Martin Grunwald
Homo hapticus
Warum wir ohne Tatssinn nicht leben können
Mit 19 Abbildungen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Fühlen und tasten ist viel wichtiger für unser Überleben als sehen, hören, riechen und schmecken«, sagt Martin Grunwald. In »Homo hapticus« beschreibt der experimentelle Psychologe erstmals für ein breites Publikum, welch überragenden Einfluss Tastsinn auf alle menschlichen Lebensbereiche hat. Der international renommierte Pionier der Haptik-Forschung erzählt anschaulich und mit vielen Beispielen aus dem Alltag, wie faszinierend die Millionen Berührungs- und Bewegungsmelder zusammenwirken, die unser Fühlen und Tasten ausmachen. Er zeigt, welch große biologische und psychologische Bedeutung Berührungen durch Hautkontakt für Menschen aller Altersstufen, vom Embryo bis zum Hochbetagten, haben. Er macht deutlich, wie raffiniert Produktdesigner mit unserer haptischen Wahrnehmung umgehen. Und er warnt vor einer Welt voller Touchscreens – denn mit ihnen lässt sich diese Welt nicht begreifen.
Inhaltsübersicht
Für Johanna und Emilie
Einleitung – eine Annäherung
Ein tastsensibles Kind …
… irritierte Psychologen …
… und skeptische Autobauer
1 Der Anfang von Innen und Außen
Der Tast- und Erfahrungsraum des Fötus
Eine haarige Entwicklung
Fötale Selbstberührungen
Muskelspiele – bewegende Emotionen
Wunderwerk Mund
Früh fühlt sich, was ein Mensch werden will
Gut gedeiht, wer Nähe spürt
Wer zu früh kommt, sitzt nicht in der ersten Reihe
2 Körperkontakt – ein Lebensmittel
Wenn der Startschuss ausbleibt
Körperkontakt – ein biologisches Kraftwerk
Stillen – ein biochemisches Großereignis
Die Uhr läuft mit!
Schlafen – ist da noch jemand?
Das richtige Maß finden
Hineintasten in die Welt
»Ich fühle meine Zunge, also kann ich deine sehen«
Materialforscher, Physiker oder nur Touchpad-User?
»Begriff« kommt von »begreifen«
Mit dem Körper wachsen
3 Reize und Rezeptoren
Haarige Gefühle
Konfettiregen auf der Haut
Reize, die unter die Haut gehen
GPS für den Körper
Heiße Herdplatten und kalte Füße
Kopf hoch!
Echte und unechte Schmerzen?
Hirnfunken
4 Vermessene Empfindungen
Wenn Simulatoren an ihre Grenzen stoßen
Rehabilitation nach einem Schlaganfall
Tasten und fühlen Frauen anders als Männer?
Mit der Schwerkraft leben
Hände im Gesicht?
Alltag heißt Berührung
Pflegebedürftige brauchen Berührung
Wie heißer Tee und weiche Stühle unsere Gedanken beeinflussen
Heiß oder kalt
Leicht oder schwer
Rau oder glatt
Hart oder weich
5 Erkrankungen und Störungen des Tastsinnessystems
Erkrankungen, die unter die Haut gehen
Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen
Wenn die Muskeln nicht mitspielen
Das Rätsel der verschwundenen Körperhälfte
Tastsinnesstörungen als frühe Anzeichen einer Demenz?
Der Super-GAU: Körperschemastörungen
Arme und Beine, die nicht zum Gehirn passen
Die qualvolle Illusion vom entstellten Körper
Hungern für den neuronalen Zerrspiegel
6 Der Mensch – das Maß der Dinge
Die Geburt des Haptik-Designs
Was soll und was kann Haptik-Design?
Manipulation oder Kundenvorteil?
Mundhaptik – Freude am Kauen
Haptik im Fokus von Werbung und Marketing
7 Offene Fragen und Forschungsprojekte
Körperstimulation von Frühgeborenen zur Verminderung von Apnoephasen und Entwicklungsstörungen
Physiologische und psychologische Effekte der Körperstimulation bei Schreibabys
Physiotherapeutische Körperstimulation bei chronisch und schwer kranken Patienten
Neoprenapplikation bei Magersucht
Körperstimulation bei Patienten mit Depressionen
Störungen des Körperschemas bei Übergewichtigen
Welche Wirkungen haben Körperstimulationen auf diejenigen, die sie ausführen?
Sind sogenannte sensible Menschen auch in den verschiedenen Dimensionen des Tastsinns besonders empfindlich?
Besteht ein Zusammenhang zwischen der Intelligenz und den Tastsinnesleistungen eines Menschen?
Entwicklung eines Haptik-Tracking-Systems
Papillarliniendynamik und Wahrnehmungsleistung
Was verbirgt sich hinter den »explorativen Stopps«?
Haptische Lernleistungen bei einzelligen Organismen
Wie viele tastsensible Rezeptoren gibt es im menschlichen Körper?
Bildteil
Dank
Glossar
Haptik-Forschungslabor am Paul-Flechsig-Institut für Hirnforschung Universität Leipzig
Für Johanna und Emilie
Einleitung – eine Annäherung
Bedeutung und Nützlichkeit des Tastsinns werden im Alltagsgebrauch – und nicht selten auch im akademischen Umfeld – auf die gängige Formel reduziert: Wir finden mit seiner Hilfe im Dunkeln unseren Wecker, den Lichtschalter oder den Partner beziehungsweise die Partnerin. Bei geringfügig höherer Differenzierungsfähigkeit wird zusätzlich registriert, dass die Fingerspitzen besonders tastsensibel sind, sodass wir etwa den Anfang eines Klebebands am besten finden, indem wir die Rolle tastend erkunden, denn das visuelle System kann hierbei nicht wirklich behilflich sein. Weiterhin können vermittels des Tastsinns heiße Herdplatten und Töpfe erkannt, glatte von rauen, weiche von harten Oberflächen, runde von geraden und schwere von leichten Gegenständen unterschieden werden. Zudem können wir dank seiner ohne Mühe den prägnanten Unterschied zwischen beschuhten Füßen und nackten Fußsohlen wahrnehmen. Und nicht zu vergessen: Das Tastsinnesvermögen spielt auch eine lustvolle Funktion in Liebe und Erotik.
Diese Aufzählung bildet einige der kurzen Momente ab, in denen uns das Alltagshandeln die Existenz eines Tastsinns überhaupt offenbart. Doch die Erkenntnisse, die dahinter aufblitzen, stellen unser Eigenbild auf den Kopf: Ohne Tastsinn könnten wir nicht leben. Eine Aussage, die überrascht und Fragen aufwirft: Wie kann ein Sinnessystem so wichtig sein, dass unser Leben davon abhängt? Immerhin kann ein Mensch blind und taub geboren werden und ist dennoch lebensfähig. Auch kann er den Geruchs- und den Geschmackssinn vollständig einbüßen, ohne dass dadurch sein Leben auf dem Spiel stünde. Doch für den Tastsinn – genauer: das Tastsinnessystem – gilt dieser biologische Gleichmut nicht.
Ohne dieses Sinnessystem wüssten wir nicht einmal, dass wir existieren. Denn eine seiner hervorragenden Leistungen besteht darin, dass wir uns jederzeit unserer körperlichen Existenz bewusst sein können. Wir denken uns nicht selbst, sondern wir fühlen uns. Mit geschlossenen Augen, im Supermarkt, nach dem Aufwachen oder während wir spazieren gehen. In jeder Millisekunde eines Tages können wir unser körperliches Dasein mit Gewissheit empfinden. Unser Tastsinnessystem hält im Hintergrund den Geist unseres Körpers zusammen. Alle übrigen Sinne liefern für diese Gewissheit allenfalls entbehrliche Beiträge. Dieses Grundgesetz der Biologie gilt für alle Lebewesen auf dieser Erde, vom einzelligen Organismus bis hin zum Menschen.
Die lebenserhaltende und biologische Kraft des nach innen und außen gerichteten Tastsinnessystems beginnt beim Embryo und begleitet unser gesamtes Leben. Jede Berührung unseres Körpers wird biologisch und psychologisch verwertet, ohne dass wir uns zwingend dessen bewusst werden. Selbst wenn wir einfach nur sitzen oder liegen, analysiert und steuert das Tastsinnessystem unseren körperlichen Status. Jederzeit. Wir können tastend Oberflächenunterschiede erkennen, die so klein sind, dass wir sie ohne Hilfsmittel nicht sehen können. Eine kurze Umarmung kann positive Emotionen auslösen, die viele Stunden oder gar Tage andauern. Kindliches Wachstum und psychische Stabilität sind ebenso abhängig von ausreichenden Körperberührungen wie das gute Miteinander von Liebes- und Lebenspartnern. Jeder Lebensbereich eines jeden Menschen wird täglich durch das stille Wirken des Tastsinnessystems geprägt. Es ist das biologisch größte und einflussreichste Sinnessystem, eine Meisterleistung der Natur – und zugleich eine Selbstverständlichkeit, die wir kaum würdigen, wie die folgenden Beispiele zeigen.
Ein tastsensibles Kind …
Am Schnuller nuckeln ist eine schöne Sache. Und weil die jüngste Tochter – Emilie – nicht um dieses Vergnügen kommen sollte, wurden ihr nach der Geburt allerlei Schnuller aus unbedenklichem Naturmaterial angeboten. Wenn einer benötigt wurde, genügten geübte Suchblicke oder Suchgriffe, und schon war mindestens eines der Zauberdinger verfügbar.
Doch eines Tages, die Abendstunden näherten sich, dauerte die Schnullersuche länger als gewohnt, und nach einiger Zeit beteiligten sich alle Familienangehörigen daran. Es war wie verhext. Johanna, die ältere Schwester, fand dann einen an einer – hier nicht näher zu beschreibenden – Stelle, und alle waren erleichtert. Der Schnuller wurde gereinigt und mit der üblichen Erwartung dem Nachwuchs präsentiert. Aber kaum war der Schnuller im Mund, landete er schon in hohem Bogen auf dem Boden. Auch nachdem er noch einmal und besonders gründlich abgewaschen worden war, spuckte Emilie ihn wieder aus. Die Untersuchung des Schnullers ergab keine Hinweise, welche die strikte Ablehnung hätten erklären können. Es half nichts, es musste weitergesucht werden. Der Garten und sogar das Auto wurden durchforstet, wobei im Letzteren zwei wunderschöne Exemplare auftauchten. Beide wurden sorgsam gereinigt, und alle warteten nun gespannt, ob die kleine Kronprinzessin die Fundstücke mit der erhofften Aufmerksamkeit annehmen würde. Beim ersten machte es sofort wieder flup! – in weniger als einer Sekunde war der Schnuller abgewählt. Beim zweiten aber entspannte sich das Gesicht der Kleinen, und ein kräftiges und genüssliches Nuckeln begann. Endlich konnte das abendliche Standardprogramm aus Vorlesen und Vorsingen seinen Lauf nehmen. Erleichterung, aber auch Fragen machten sich breit. Wieso wurde von drei – offenbar schon in Gebrauch gewesenen – Schnullern nur einer angenommen? Alle drei hatten dieselbe Form und waren aus dem gleichen Material. So schien es jedenfalls. Eine genaue Untersuchung am nächsten Morgen ergab, dass die drei Schnuller zwar in Länge und Breite identisch waren, es jedoch winzig kleine Unterschiede in der räumlichen Struktur gab: Die Form variierte um einen halben Millimeter. Offenbar war das Kleinstkind mühelos und sehr schnell in der Lage, diese Unterschiede durch aktive Tastexploration des Mundes festzustellen und als bekannt und angenehm oder als unbekannt und abscheulich zu beurteilen. Die Bevorzugung bestimmter haptischer Eigenschaften – auf hohem sensorischen Niveau – ist demnach eine Leistung, zu der nicht erst Erwachsene fähig sind. Diese Erfahrungen wirken bis heute bei den Eltern nach: In zeitlosen Werkzeugkisten, Koffern, Schubladen und sonstigen Behältern lungern noch heute – nach Emilies Abitur – einige Schnullerexemplare dieser einen und wahrhaftigen Sorte.
… irritierte Psychologen …
Es ist das Jahr 1993. In der elektromagnetisch abgeschirmten EEG-Kabine des neurophysiologischen Instituts in Jena sitzt die Versuchsperson Nr. 25 und ertastet mit ihren Händen blind ein Tiefenrelief. Ein junger Wissenschaftler im Nebenraum beobachtet die Handbewegungen durch ein Sichtfenster und die flackernden EEG-Kurven auf dem Bildschirm. Mit jeder mikroskopisch kleinen Bewegung der Finger über das Tiefenrelief feuern Millionen Sensoren in Muskeln, Sehnen, Gelenken, Haaren und Haut riesige Signalströme an das Gehirn der Probandin, das all diese Einzelinformationen zu einem Ganzen, einem Wahrnehmungsresultat zusammensetzt. So entsteht letztlich eine präzise Vorstellung von dem, was die Hände während der haptischen Exploration ertasten. Ist die Versuchsperson an diesem Punkt angelangt, beendet sie das Abtasten. Das Relief wird entfernt, und die Versuchsperson fertigt – nun mit offenen Augen – eine Zeichnung davon an. In der Regel entspricht diese Zeichnung sehr genau der Reliefstruktur.
Bei Versuchsperson Nr. 25 ist alles etwas anders. Ungewöhnlich lange tastet sie das Relief ab. Der Versuchsleiter spürt ihre mentale Anspannung, und die EEG-Kurven auf dem Bildschirm zeigen an, dass sie sich überdurchschnittlich anstrengt. Aber noch verblüffender ist die Zeichnung, die sie schließlich anfertigt: Sie hat keine Ähnlichkeit mit dem Relief. Striche, Kreise, Bogen sind ohne Zusammenhang gezeichnet, selbst ein einfaches Dreieck hat die Probandin nicht erkannt. Was hat das zu bedeuten? Von 50 Teilnehmern – alles junge Studierende – zeigte kein anderer solche Wahrnehmungsergebnisse. Ein »typischer Ausreißer«, wie solche Fälle in den Lebenswissenschaften bezeichnet werden, doch so auffällig und ungewöhnlich, dass die pure Neugierde nach einer Erklärung verlangte. Ganz offensichtlich gelang es dem Wahrnehmungssystem dieser Versuchsperson nicht, die ertasteten Einzelinformationen zu einem Ganzen zusammenzufügen, lediglich einzelne Elemente des Reliefs waren erkennbar.
Was konnte die Ursache für dieses Phänomen sein? Versuchsperson Nr. 25 war eine erfolgreiche Studentin im fünften Semester in einem anspruchsvollen Studiengang, der hohe kognitive Anforderungen stellte. Einen Mangel an kognitiven Fähigkeiten konnte man daher ausschließen. Auch eine neurologische Erkrankung konnte auf der Basis der Plausibilität ausgeschlossen werden, denn neurologisch bedingte Störungen der Tastsinneswahrnehmung waren damals lediglich bei schweren Verletzungen oder Erkrankungen der rechten Gehirnhälfte nach einem Unfall oder einem Hirninfarkt bekannt. Und Hirnschädigungen dieser Art haben auch erhebliche Einschränkungen in vielen anderen sensorischen oder kognitiven Bereichen zur Folge, sodass Betroffene unter gar keinen Umständen universitäre Bildungsanforderungen bewältigen könnten. Am einfachsten wäre es gewesen, die Probandin nochmals zu testen oder zumindest mit ihr über die Ergebnisse zu sprechen, aber sie war weder dem einen noch dem anderen gegenüber aufgeschlossen. Der junge Wissenschaftler musste nehmen, was er hatte, und das war nicht viel.
Für die Studienakten, die jeweils in Vorbereitung auf die EEG-Messung angelegt wurden, wurden aktuelle oder in der Vergangenheit aufgetretene neurologische oder psychiatrische Erkrankungen abgefragt. Doch hierzu gab es keine Angaben, die nützlich gewesen wären. Körpergröße und Gewicht wurden damals nicht notiert. Dennoch enthielt die Akte einen wenn auch verwirrenden Hinweis: Es war vermerkt worden, dass die Probandin auffällig viele Härchen im Gesicht und an den Unterarmen hat und außerdem ihre Haut an den Armen grau und rau sei, als hätte sie sich nicht gut gewaschen. Eine bestimmte sehr schwere seelische Erkrankung wird unter anderem von vermehrtem Haarwuchs, der sogenannten Lanugobehaarung, und charakteristischen Veränderungen der Haut begleitet: Anorexia nervosa, volkstümlich als Magersucht bezeichnet. Ursache für das altersuntypische Lanugohaar (altersuntypisch, da es sich normalerweise bei einem Fötus zwischen der 13. und 16. Schwangerschaftswoche bildet und kurz vor der Geburt verschwindet) sind gravierende hormonelle Veränderungen infolge des fast völligen Verzichts auf Nahrungsmittel.
Aber welchen Zusammenhang sollte es zwischen permanentem Nahrungsmangel und beeinträchtigten Tastsinnesleistungen geben? Vergleichbare Untersuchungen an anorektischen Patienten waren in der wissenschaftlichen Literatur nicht zu finden. Und Untersuchungsbefunde zu anderen Sinneseinschränkungen bei dieser Patientengruppe gab es zum damaligen Zeitpunkt auch nicht. Erfahrene klinische Psychologen und Neuropsychologen schüttelten in der Regel den Kopf, wenn sie mit den Daten der Probandin Nr. 25 konfrontiert wurden. Anträge auf weiterführende Untersuchungen und die Suche nach Kooperationspartnern in verschiedenen Kliniken blieben zunächst erfolglos. Nicht nur, dass die Angefragten sehr wenig über das Tastsinnessystem wussten, ein möglicher Zusammenhang zwischen Magersucht und Störungen der Tastsinneswahrnehmung wurde als geradezu kuriose Annahme abgewiesen.
Doch das Rätsel der eigenartigen Tastsinnesstörung bei Probandin Nr. 25 ließ den jungen Wissenschaftler nicht los. Um es lösen zu können und herauszufinden, ob andere magersüchtige Patienten ebenfalls davon betroffen waren, folgten zehn Jahre intensiver Forschungen zu den Tastsinnesleistungen dieser und auch anderer Patientengruppen. Möglich wurden diese Studien durch die Aufgeschlossenheit der damaligen Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universität Leipzig, Frau Professor Ettrich, und ihrer Mitarbeiterinnen Bianka Assmann und Angelika Dähne. Teil für Teil eines Puzzles wurde über die Jahre zusammengetragen und schließlich ein plausibles und belegbares Erklärungskonzept für die beobachteten Phänomene entwickelt. Und nicht nur das: Am Ende dieser langwierigen Suche stand eine neue Behandlungsmethode. Von den Kollegen weltweit mit Interesse oder aber mit Kopfschütteln kommentiert, ist diese Methode heute in einigen spezialisierten Kliniken Bestandteil der körpertherapeutischen Behandlung und trägt mit dazu bei, den zum Teil tödlichen Verlauf der Magersucht aufzuhalten.
… und skeptische Autobauer
In dem großen und fensterlosen Besprechungsraum war es ganz still. Statt freundlichen Applauses herrschte Schweigen, und der junge Wissenschaftler sah in finstere Mienen. Es folgten beklemmende Sekunden. Deutsche Autobauer hatten ihn eingeladen – Mitte der 1990er-Jahre – und wollten wissen, ob der Tastsinn ein wichtiges oder eher unwichtiges Sinnessystem ist. Die Stille wurde endlich durch einen der Zuhörer unterbrochen, der mit energischen Bewegungen seine Papiere vom Tisch klaubte und sichtlich frustriert die Tür ansteuerte. Im Hinausgehen schüttelte er den Kopf und machte eine Geste, die überdeutlich signalisierte, dass er genug gehört hatte. Die Tür war noch nicht geschlossen, da packten auch schon zwei weitere Herren ihre Unterlagen zusammen und gingen wortlos davon. Der junge Wissenschaftler, Anfang 30, stand immer noch am Overheadprojektor und wartete auf Fragen. Aber niemand schien Notiz von ihm zu nehmen. Die verbliebenen Zuhörer waren völlig mit sich selbst beschäftigt. Leise redeten einige miteinander, jedoch nicht über den Tisch hinweg. Als sich dann die Ersten anzuschreien begannen, wurde offensichtlich, dass sich gegnerische Gruppen gegenübersaßen.
Die eine Seite vertrat die Auffassung, dass zum Design von Autos auch die Beachtung des Tastsinns gehört. Vertreter dieser Gruppe hatten den jungen Wissenschaftler offenbar eingeladen und sahen sich durch seinen Vortrag bestätigt. Die anderen fühlten sich offenkundig provoziert und argumentierten zunehmend verbalaggressiv. »Unsinn« und »Luxusprobleme« tobten sie. Die Befürworter einer haptischen Perspektive im Autobau griffen die positiven Beispiele aus dem Vortrag – technische Lösungen konkurrierender Autobauer oder aus anderen Industriebereichen – auf und hielten sie ihren Kontrahenten buchstäblich unter die Nase, doch diese nutzten sie nicht zum sachlichen Vergleich, sondern empfanden sie als pure Kritik.
Hinreichend undiplomatisch hatte der junge Wissenschaftler Türgriffe, Schalter und sonstige Bedienelemente verschiedener Autobauer verglichen und deren haptische Stärken und Schwächen hervorgehoben. Im Grundsatz folgte er der Devise, dass die Dinge speziell im Auto nicht gut sind, wenn sie nur gut aussehen. Rein optisch getriebenes Design, das die Bedürfnisse des menschlichen Tastsinns nicht berücksichtigt – so die zentrale Botschaft des Vortrags –, wird zukünftig nicht erfolgreich sein können. Denn die Mitbewerber stehen in den Startlöchern, und wer weiterhin nur der üblichen visuell dominierten Gestaltungslogik folgt und auf die verschiedenen haptischen Bedürfnisse der Nutzer nicht eingeht, wird auf dem weltweiten Markt Verluste hinnehmen müssen. Das war für einige der Zuhörer zu viel gewesen. Man könne nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Und überhaupt sei ja gar nicht erwiesen, dass es sich hierbei um einen übergreifenden Trend handle. In den einschlägigen Automobilzeitungen sei davon noch nichts zu lesen, und was die Konkurrenz mache, sei die eine, was man selbst mache, die andere Sache. Für solche Spinnereien werde man wohl auch in Zukunft kein unnötiges Geld ausgeben. Es folgten dann doch noch ein paar höfliche Fragen an den Vortragenden. Als die Rede jedoch auf notwendige Forschungen zur Beantwortung sehr spezifischer und anwendungsorientierter Fragen kam, wurden die Mienen der Gegenseite noch finsterer, als sie es ohnehin schon waren. Wenige Jahre später gründete genau dieses Unternehmen eine eigene Forschungsgruppe Haptik, die noch heute und sehr erfolgreich für diesen Autobauer tätig ist.
Allen diesen Geschichten ist gemeinsam, dass im Zentrum das Tastsinnessystem des Menschen steht und dass die beteiligten Protagonisten eher schlecht als recht verstehen, warum und wieso dieser Sinn von Bedeutung sein soll. Die Autobauer geraten fast körperlich aneinander, nur weil Ansprüche des Tastsinns an die Innenausstattung zukünftig in Erwägung gezogen werden sollen. Klinische Psychologen haben hinreichend Mühe, einen biopsychologischen Zusammenhang zwischen Magersucht und Einschränkungen der Tastsinnesleistungen für möglich zu halten. Die jungen Eltern schließlich ahnen nicht, dass fast schon mikroskopische Unterschiede zwischen verschiedenen Schnullern von einem acht Monate alten Kleinstkind registriert und bewertet werden können.
Die Zögerlichkeit der Protagonisten ist, wenn auch hinderlich in der Sache, so doch verständlich. Im Alltag gibt es höchst selten Anlässe, über das Vorhandensein und die Leistungen des Tastsinnessystems nachzudenken, und weder in der Schule noch während des Studiums wird man diesbezüglich sonderlich belehrt. Und wer mit dem visuellen Bilderrausch der Neuzeit stetig und ohne Unterlass darüber unterrichtet wird, dass – angeblich – achtzig Prozent aller Informationen über das visuelle System verarbeitet werden, der wird keinen Gedanken auf die Bedeutung des Tastsinnessystems verschwenden. Die Fähigkeit, mit unseren Fingern, mit unserem Körper die verschiedensten Eigenschaften der äußeren Welt und unseres eigenen Körpers tastend zu erkunden, ist für uns so normal, wie wir sehen, hören, riechen und schmecken können. »Bei Sinnen zu sein« ist der eigentliche Grundzustand unserer menschlichen Existenz. Von Ausnahmen abgesehen. Es gibt demnach keine prinzipielle Notwendigkeit, unsere Tastsinnesfähigkeit im Alltag zu hinterfragen. So menschlich diese Haltung im Allgemeinen sein mag, so erklärungsbedürftig ist die Zurückhaltung in der wissenschaftlichen Forschung.
Der Tastsinn erfährt – wie auch der Geruchs- und der Geschmackssinn – eine gleichermaßen dezidierte wie kontinuierliche Nichtbeachtung und kultivierte Abwertung innerhalb der Psychologie und der Medizin – insbesondere in Relation zum Sehsinn. Die denkhistorischen Wurzeln dieses Verständnisses finden sich unter anderem in der griechischen Philosophie seit Platon und Aristoteles.1 Religionsphilosophische Beiträge des Mittelalters und späterhin auch medizinisch-naturwissenschaftliche Sichtweisen auf das Wahrnehmungsvermögen des Menschen haben nicht unwesentlich zu einer erkenntnistheoretischen und biologischen Abwertung des Tastsinnessystems beigetragen.
Selbst die vergleichsweise neue wissenschaftliche Disziplin der Psychologie, die sich Ende des 19. Jahrhunderts etablierte – und deren erstes akademisches Institut durch Wilhelm Wundt in Leipzig gegründet wurde –, trug weder in ihren institutionellen Anfängen noch heute zu einem substanziellen Perspektivenwechsel bei. Menschliches Erleben und Verhalten unterliegen auch nach moderner Lesart Kognitions-, Emotions-, Gedächtnis- und sonstigen Prozessen, wobei diese konsequent von der körperlichen Basis des menschlichen Organismus entkoppelt werden. So wird aktuell in den Lebenswissenschaften, ganz ähnlich der platonschen Position vom »göttlichen Sehsinn«, einvernehmlich die Ansicht vertreten, dass der visuellen Wahrnehmung ein unhinterfragbares Primat innewohnt und sie eine Superposition im individuellen Erkenntnisprozess einnimmt. Dagegen wird dem Tastsinnessystem eher eine untergeordnete, wenn überhaupt irgendeine erkenntnisrelevante Position zugeordnet.
Weltweit forschen nur wenige Hundert Wissenschaftler zu den grundlagen- und anwendungsbezogenen Aspekten der menschlichen Tastsinneswahrnehmung. Um ein Vielfaches größer ist die Anzahl der Wissenschaftler als auch der Institutionen weltweit, die sich mit der Erforschung der biologischen und der psychologischen Grundlagen des visuellen und auch des auditiven Systems beschäftigen. Wir wissen daher heute in erheblichem Umfang und aus verschiedenen Fachdisziplinen gespeist, wie diese beiden »wichtigsten« Sinnessysteme des Menschen funktionieren. Und offenkundig profitieren sowohl die Anwendungsforschung als auch die Medizin und andere Lebenswissenschaften vom Primat des Sehens und Hörens. So führte das stetig wachsende biologische Gesamtverständnis um die Funktionsweise biochemischer Teilelemente bis hin zu komplexen neuronalen Verarbeitungsmechanismen des visuellen und des auditiven Systems beispielsweise zur Entwicklung bioelektrischer Hilfsmittel, sodass es heute möglich ist, Seh- und Hörprothesen in den menschlichen Körper einzupflanzen. Auch die technische Nachbildung dieser Sinnesqualitäten in der Robotik oder in virtuellen Umwelten gelingt in beachtlicher Weise. Vor diesem sachlichen Hintergrund schließt sich der quasi-logische Kreis in sich selbst bestätigender Weise: Die Erfolge bestätigen rückwirkend das Vorgehen in der Vergangenheit. Je deutlicher die theoretischen und die praktischen Erfolge sichtbar und hörbar wurden, umso stärker wurde aber die forschende Aufmerksamkeit von den anderen Sinnessystemen abgelenkt.
Entgegen dieser Haltung kommt es, kaum beachtet von der breiten Öffentlichkeit, allmählich zu einem Perspektivenwechsel hinsichtlich der Bedeutung und der Funktion des Tastsinnessystems für den Menschen. Weltweit zunehmende Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet erbringen erstaunlich neue Einsichten und ein besseres Verständnis der Funktionsweise. Es drängen sich aber auch immer mehr grundsätzliche Fragen auf, die mit dem bisherigen Sinnesverständnis nicht in Einklang zu bringen sind. Einige dieser Fragen betreffen den biologischen – den phylogenetischen, also stammesgeschichtlichen – Ursprung unserer Tastsinnesfähigkeit. Andere die wundersame ontogenetische (individualgeschichtliche) Gebundenheit der menschlichen Existenz an die Erfahrungen einer körperlichen Interaktion und Stimulation. Anders formuliert: Ist menschliches oder jegliche Form von Leben überhaupt denkbar ohne das Vorhandensein und die Wirkung eines wie auch immer differenzierten Tastsinnessystems? Zugegeben: Grundsätzlicher können Fragen nach dem Sinn eines Sinnessystems kaum gestellt werden. Und dabei handelt es sich nicht um akademische Spielerei, vielmehr ergeben sich diese Fragen zwangsläufig aus dem, was wir bisher über die Funktion und die Bedeutung des Tastsinnessystems wissen. Gut möglich, dass die Beantwortung dieser Fragen zu einigen Verwerfungen und auch zu einem veränderten Menschenbild führt.
Es gibt viel zu tun, tasten wir uns voran!
1 Der Anfang von Innen und Außen
Die Sinnessysteme des Menschen entwickeln sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten und verschieden schnell, aber streng nach einem eigenständigen und hierarchisierten Ordnungsprinzip. Die zeitliche Ordnung folgt biologischen Naturgesetzen, und das Tastsinnessystem nimmt dabei eine herausragende Stellung ein. Dessen sehr frühe Entwicklungsschritte offenbaren ein biologisches Wunderwerk, das die wesentliche Grundlage für ein biologisches und psychologisches Verständnis der überlebenswichtigen Funktionen dieses Sinnessystems bildet.
Sachlich betrachtet, gibt es für den Menschen im Wesentlichen zwei Lebensphasen. Die Zeit vor der Geburt und die Zeit danach, bis zum Tod. Gemeinhin ist die Auffassung verbreitet, dass alle Sinnessysteme des Menschen erst nachgeburtlich vollständig ausreifen. Als Beispiel dafür wird – wie sollte es anders sein – gern die Entwicklung des visuellen Systems beschrieben. Kurz vor und nach der Geburt ist der Säugling lediglich in der Lage, hell und dunkel zu unterscheiden. Der neugeborene Mensch ist quasi blind. Erst die Ausreifungsprozesse verschiedener retinaler Zellgruppen unter der Einwirkung von Lichtreizen führen zu dem, was wir als visuelle Wahrnehmungsprozesse – oder als Sehen – bezeichnen. Mit dem zwölften Lebensmonat sind die wesentlichsten biologischen Elemente des visuellen Systems fast vollständig ausgebildet. Die Ausreifung der Fovea centralis – der Ort des schärfsten Sehens – ist jedoch erst im vierten Lebensjahr abgeschlossen.2
Eine Fehlentwicklung, die zu einer angeborenen oder erworbenen Blindheit führt, bedeutet nicht, dass der menschliche Organismus alle anderen Lebensfunktionen einstellt und der Tod eine gesetzmäßige Folge wäre. Dasselbe gilt für das Hörsystem, den Geruchs- und den Geschmackssinn. Selbst der Verlust oder die fehlende nachgeburtliche Ausreifung zweier Sinnessysteme, wie dies bei taubblinden Menschen der Fall ist, führt nicht zum biologischen Kollaps des gesamten Organismus. Das Leben geht weiter. Wenn auch eingeschränkt.
Die Wahrnehmungssysteme, die mit dem Hören, dem Sehen, dem Riechen und dem Schmecken verbunden sind, stellen im biologischen Sinn praktikable »Angebote« dar, die zur Interpretation von Umweltereignissen und Umwelteigenschaften genutzt werden können. Sie sind fakultative Hilfsmittel und erleichtern unseren individuellen Lern- und Anpassungsprozess an die uns umgebende dreidimensionale Umwelt. Sie sind überaus nützlich und dienen auch dem sozialen Austausch, aber sie stellen bei Verlust oder Schädigung – sofern wir in sozialen Umwelten leben, die diese sensorisch-analytischen Mängel kompensieren können – eben nicht das Überleben infrage.
In mehrfacher Hinsicht gelten diese Aussagen nicht für das Tastsinnessystem. Betrachtet man allein dessen Entwicklungsverlauf, so fällt auf, dass einer seiner Leistungsbereiche – nämlich Berührungsreize auf der Körperoberfläche registrieren zu können – schon wenige Wochen nach Befruchtung der Eizelle ausgebildet ist. Embryos reagieren bereits ab der siebten Schwangerschaftswoche auf Berührungsreize an den Lippen mit einem Zurückweichen des Kopfes sowie ganzkörperlichem Zucken.3 Daraus wird geschlussfolgert, dass das Tastsinnessystem des Embryos die sanfte Berührung der Körperhaut als einen äußeren Umweltreiz erkennt. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, dass das Zurückweichen eine Meidbewegung gegenüber diesem Reiz ist. Zu diesem Zeitpunkt ist der werdende Mensch lediglich neun bis 16 Millimeter groß, und keines der übrigen Sinnessysteme ist aktiv! (s. Abbildung 1 im Bildteil).
Das Verhalten von Embryos bei Berührungsreizen ist ein belastbarer und wichtiger Beleg dafür, dass die Basisleistungen des Tastsinnessystems schon in der ontogenetischen Frühphase des Menschen ausgereift sind. Das bedeutet: Noch vor Ausbildung aller inneren Organe (diese ist in der Regel mit der neunten Schwangerschaftswoche abgeschlossen; ab diesem Zeitpunkt wird der werdende Mensch als Fötus bezeichnet) ist das sich entwickelnde Tastsinnessystem in der Lage, physische Einwirkungen auf den Körper zu registrieren und ganzkörperliche Reaktionen auszulösen. Diese Fähigkeit ist einerseits ein Beweis dafür, dass sich das Tastsinnessystem als erstes Wahrnehmungssystem vor allen anderen Sinnessystemen entwickelt. Andererseits wird offenkundig, wie frühzeitig das sensorische und das motorische System miteinander verbunden sind, denn für die als Meidbewegung bezeichnete Reaktion müssen zunächst die Ergebnisse einer elementaren Reizverarbeitung des Tastsinnessystems an die motorischen Regelzentren beziehungsweise Motoneurone weitergeleitet werden. Dass es sich hierbei nicht um willentliche Akte eines Lebewesens handelt, kann sicher angenommen werden. Vielmehr muss vermutet werden, dass die biologischen Grundlagen Reflexreaktionen sind, die von den gerade erwähnten Motoneuronen gesteuert werden, die bereits ab dem 33. Tag im Rückenmark eines Embryos nachweisbar sind.
Es liegt der Verdacht nahe, dass die sehr frühzeitig angelegte Ausbildung einer elementaren Tastsensibilität zum Schutz des Embryos etabliert wurde. Das kann jedoch berechtigt angezweifelt werden, denn der Embryo beziehungsweise Fötus wächst – soweit wir wissen – schon seit ein paar Millionen Jahren in der schützenden Hülle eines weiblichen Organismus heran. Gut verpackt in akustisch und mechanisch dämpfende Gewebestrukturen, ist er praktisch von der Außenwelt und ihren potenziell gefährlichen Einflüssen abgeschirmt. Zudem verfügt die werdende Mutter in der Regel über ausreichende kognitive und motorische Fähigkeiten, um sich selbst und damit auch ihr Ungeborenes zu schützen. Es erscheint somit wenig plausibel, dass ein an sich hervorragend geschütztes biologisches System wie das des Embryos zusätzlich mit einer eigenen sensiblen Schutzhülle versehen werden müsste. Und selbst wenn es das Ziel der Natur gewesen wäre, einen zusätzlichen Schutz zu entwickeln, hätte es vollends genügt, diesen in einer relativ späten vorgeburtlichen Phase, vielleicht sogar erst nachgeburtlich ausreifen zu lassen. Es bleibt somit die Frage, zu welchem inneren biologischen Zweck die Natur bereits in der embryonalen Entwicklungsphase eine körperliche Sensibilität etabliert, die Schutz- und Vermeidungsreaktionen ermöglicht.
Eine mögliche Antwort auf diese Frage ergibt sich, wenn wir den Embryo weniger als zukünftigen Menschen betrachten, sondern vielmehr als biologisch sinnvolle Anordnung von Zellgruppen. Im Unterschied zu einzelligen Organismen (etwa Amöben) besteht der embryonale Organismus aus Millionen Zellen, die spezialisierte Aufgaben und Funktionen erfüllen. Einige bilden zum Beispiel Blut-, Muskel- und Knochenzellen, andere werden zu Neuronen und Nervenfasern. Jeder Quadratmikrometer eines Embryos enthält Zellgruppen in einer definierten räumlichen Anordnung, die wir in ihrer Gesamtheit als den körperlichen Anfang eines menschlichen Wesens interpretieren können. Damit die räumliche und die funktionale Ordnung zwischen den verschiedenen Zellgruppen entstehen kann, herrscht innerhalb und zwischen den Zellen eine rege Kommunikation auf biochemischer und biomechanischer Basis. Eine der wesentlichsten Informationen, die jede Zelle verarbeiten muss, um die Ordnungsbildung und die Ausreifung des gesamten Organismus zu gewährleisten, ist die über den physischen Kontakt zu den Nachbarzellen und alle anderen physischen Gegebenheiten (Druck, Vibration, Wärme, Kälte), die auf sie einwirken können. So wissen wir heute, dass jede Zelle in der Lage ist, physikalische Veränderungen der eigenen Oberfläche zu registrieren und sich in gewissen Grenzen durch Eigenbewegungen an diese Veränderungen anzupassen. Diese Fähigkeit kann man sich als einfachste Form der Berührungs- und Kontaktsensibilität vorstellen. Die Reaktionen einer Zelle auf die physische Veränderung ihrer Zellwand werden über biochemische Signalketten wiederum an die benachbarten Zellen weitergegeben, wobei die Geschwindigkeit der zellulären Sensorik vom Zelltyp und von der Qualität der einwirkenden Kräfte abhängt. Durch diesen sehr grundlegenden Mechanismus ist es möglich, dass das gesamte Zellensemble mit einer motorischen Reaktion auf den Druckreiz auf die Lippen des Embryos antwortet.
Was wir als Schutzreaktion eines Embryos interpretieren, ist demnach letztlich die Wirkung eines Naturgesetzes, das ich als Kontaktgesetz bezeichnet habe: Jedes biologische Lebenssystem – vom Einzeller bis hin zum Mehrzeller – verfügt über eine Kontaktsensibilität und -reaktibilität, weil es über diese grundlegenden biologischen Mechanismen verfügen muss.4
Der Tast- und Erfahrungsraum des Fötus
Ist die embryonale Tastsensibilität gegenüber externen Berührungsreizen in der siebten Schwangerschaftswoche noch auf den Bereich der Lippen beschränkt, reagiert der Embryo in den darauffolgenden Wochen auch auf Berührungen des Kopfes, der Arme und des Rückens. Bis zur 14. Schwangerschaftswoche wird sich die passive Berührungssensibilität auf alle Körperregionen ausdehnen und für taktile Reize empfänglich werden.
Taktil oder haptisch?
Weil es aus neurophysiologischer Sicht ein wichtiger Unterschied ist, ob wir uns bei Berührungen unseres Körpers selbst bewegen oder unbewegt und passiv sind, unterscheidet man auch sprachlich zwischen diesen beiden Wahrnehmungsqualitäten. Taktile Wahrnehmungen entstehen, wenn unser Körper durch physikalische Reize verformt oder berührt wird, zum Beispiel, wenn wir von einem Masseur durchgeknetet werden. Sind wir hingegen selbst der Masseur, generiert unser neuronales System haptische Wahrnehmungen. Auch Selbstberührungen führen zu haptischen Wahrnehmungen. Da wir den größten Teil unseres Alltags als aktiv Handelnde gestalten, ist ein Großteil unserer Tastsinneswahrnehmungen haptisch und nur ein geringer Teil taktil.
Zeitgleich mit der sensorischen Entwicklung erfolgt die motorische: Kann der Embryo bis zur achten Schwangerschaftswoche nur leicht den Kopf anheben, indem der Rumpf gestreckt wird, und lediglich mit dem gesamten Körper unkoordinierte, zuckende Bewegungen ausführen, sind ab der neunten Schwangerschaftswoche isolierte Bewegungen der Arme, Beine und des Kopfes beobachtbar. Das bedeutet, nicht mehr der komplexe Zellverband als Ganzes nimmt Lage- und Positionsveränderungen vor, sondern die einzelnen Körperteile können jetzt zunehmend unabhängig voneinander motorische Impulse in Bewegungen umsetzen. Die biologische Funktion dieser Parallelität besteht darin, dass alle Bewegungsprozesse sensorisch überwacht und gesteuert werden müssen, um koordiniert ablaufen zu können. Jede Bewegung, auch schon im fötalen Stadium, erfordert ein zeitlich perfektes Zusammenspiel der tastsensiblen Rezeptoren der Haut und der sensiblen Strukturen innerhalb der Muskulatur, der Sehnen, des Bindegewebes sowie der Gelenke. Die Sensibilität der Muskeln, Sehnen und Gelenke ist nicht auf äußere Reize gerichtet, sondern bildet einen nach innen gerichteten Teil des Tastsinnessystems. Weil winzige Sensoren in den Muskeln, Gelenken und Sehnenkapseln sowohl in Ruhelagen als auch bei Bewegung ständig elektrische Signale aussenden, wird der Organismus in jeder Millisekunde über die Spannung seiner Muskeln und Sehnen sowie die Stellung der Gelenke informiert. Auch die Impulse aus der Haut, die durch Eigenbewegungen oder durch externe Reize entstehen, tragen zur internen Positions- und Lagebestimmung der einzelnen Körperglieder bei. Aus den Millionen Einzelinformationen der verschiedenen Sensoren ist es dem neuronalen System schließlich möglich, die räumliche Lage und die Position der Körperglieder in Relation zum gesamten Organismus zu ermitteln. Diese Teilleistung des Tastsinnessystems wird als Propriozeption bezeichnet.
Ohne Propriozeption wären zielgerichtete Bewegungen nicht möglich. Weder vor noch nach der Geburt. Die propriozeptiven Prozesse sind gleichsam Überwacher und Begleiter jeder Bewegung. Das Wirken dieser Tastsinnesleistungen ist in etwa vergleichbar mit der Überprüfung des Kontostands, bevor man eine Überweisung tätigt, um festzustellen, in welchem Ausmaß das Konto gefüllt ist. Je nach Ergebnis dieser Prüfprozedur kann der entsprechende Betrag entnommen werden oder eben nicht.
Je präziser und zielgerichteter eine Bewegung ausgeführt werden soll – vorgeburtlich wie nachgeburtlich –, umso genauer müssen die biologischen Angaben über die aktuelle Lage und Position des Körpers sowie der Körperglieder unmittelbar vor und während der Bewegung sein. Diese wichtigen propriozeptiven Informationen müssen fortlaufend durch das neuronale System verarbeitet werden. Weil das Gleichgewichtsorgan wesentliche Informationen über die Lage und die Position von Kopf und Körper im Raum bereitstellt, kann dieses spezialisierte Sinnessystem als Teil der Propriozeption betrachtet werden.
Der Fötus und sein sich entwickelndes neuronales System lernen in den ersten Lebenswochen die grundlegenden Lektionen über die räumliche Beschaffenheit des Körperbaus und die Bewegungen, die mit diesem Körper möglich sind. Die nach außen gerichtete Berührungssensitivität (Exterozeption), die sich allmählich über den gesamten Körper ausbreitet, hilft dem Fötus dabei ebenso wie die nach innen gerichtete propriozeptive Sensibilität. Die parallele Entwicklung beider Sensibilitätsebenen ist unbedingte Voraussetzung für die Streckbewegungen des Fötus sowie erste Eigenberührungen des Gesichts, die ab der zehnten Schwangerschaftswoche beobachtet werden können. Die aktive Berührung des Gesichts beziehungsweise des Kopfes stimuliert nicht nur diese beiden Körperbereiche, sondern stößt auch die Entwicklung eines wichtigen emotionalen und kognitiven Regelkreises an, den wir noch als Erwachsene nutzen (s. Kapitel 4).
Im Fortgang dieser Entwicklungsprozesse kann der Fötus ab der zwölften Schwangerschaftswoche – zu diesem Zeitpunkt arbeitet immer noch kein anderes Sinnessystem! – sogar einzelne Finger bewegen sowie die Hände öffnen und schließen. Bereits ab der 15. Schwangerschaftswoche kann das vollständige Bewegungsrepertoire eines Fötus entwickelt sein. Er berührt aktiv seinen Körper, vor allem sein Gesicht, und untersucht die räumliche Umgebung, in der er sich befindet.5 Zu diesem Zeitpunkt beginnt er auch mit Saugbewegungen am Daumen! Um diesen Aspekt noch einmal hervorzuheben: Ohne dass visuelle Informationen hilfreich zur Verfügung stünden, gelingt es dem Fötus, seinen Daumen in den Mund zu führen, um auf diese Weise den Saugreflex zu stimulieren und zu trainieren. Die bereits hochsensible Hautoberfläche des Gesichtsbereichs und die zunehmende Sensibilität der Finger fördern den Ablauf dieser Bewegung. Das Training des Saugreflexes ist im Übrigen kein oraler Zeitvertreib eines unterforderten Fötus, sondern die lebensnotwendige Voraussetzung für die spätere Nahrungsaufnahme. Wer nicht saugen kann, hat unter natürlichen Bedingungen nach der Geburt keine Überlebenschance. Das Zusammenwirken des nach innen und nach außen gerichteten Tastsinnessystems und des Bewegungssystems ist die biologische Basis dieser vorgeburtlichen Leistung. Eine der ersten sinnvollen menschlichen Handlungen – das Daumennuckeln – ist so bereits nach einer relativ kurzen vorgeburtlichen Entwicklungsperiode möglich, und das ohne die funktionelle Beteiligung der übrigen Sinnessysteme.
Eine haarige Entwicklung
Betrachtet man die Lebens- und die Umgebungsbedingungen des Fötus in der 17. Schwangerschaftswoche, so fällt die relative Reizarmut in dieser Lebensphase auf. Der Fötus kann nichts hören, der Lebensraum ist warm, aber dunkel, und geschmackliche oder Geruchssensationen können auch noch nicht verarbeitet werden, weil die hierzu nötigen sensorischen Systeme noch nicht entwickelt sind. Wäre ein erwachsener Mensch in solch einer Umgebung, würden wir von Folter infolge sensorischer Deprivation sprechen. Der gerade erst etwa 13 Zentimeter große Fötus schwebt förmlich im uteralen Weltraum. Er ist berührungsempfindlich, aber es ist in dieser Lebensphase und an diesem Ort nichts in der Nähe, was ihn körperlich stimulieren könnte (es sei denn, ein Zwilling wächst mit heran, der für zufällige Berührungsreize sorgt).
Lediglich seine Eigenberührungen und die körperlichen Reize, die durch die Bewegungen der Mutter ausgelöst werden, unterbrechen die reizarme Lebenswelt. Doch es ist ein Gesetz der Natur, dass alles, was wachsen soll, nicht nur ernährt, sondern auch ausreichend körperlich stimuliert werden muss. Die glatte Haut des Fötus ist umgeben von Fruchtwasser, und die weichen uteralen Kontaktreize sind nur eingeschränkt zur Hautstimulation geeignet. Genau in dieser Phase wachsen dem Fötus am ganzen Körper (außer an den Handflächen und den Fußsohlen) ca. fünf bis sieben Millimeter lange Härchen: das Lanugohaar. Jedes der Härchen ist in der Haut mit Sensoren verbunden, und selbst die kleinste Krümmung eines Härchens stimuliert diese Sensoren, die ihrerseits permanent Impulssalven an das Gehirn weiterleiten. Aufgrund ihrer Länge und ihrer Kopplung an die Hautsensoren wirken die Lanugohärchen wie Tastantennen, die sogar kleinste Schwankungen des Fruchtwassers registrieren und verstärken können.
Dank der Lanugobehaarung ist jetzt für den Fötus eine permanente körperliche Stimulationsumgebung entstanden, die sowohl in Ruhelagen als auch bei Fremd- und Eigenbewegungen für eine Anregung des Tastsinnessystems und damit auch für eine neuronale Stimulation sorgt. Durch diesen sensorischen Trick gelingt es der Natur, eine Sensibilitätssteigerung zu erzeugen, die für das weitere Wachstum des Fötus von entscheidender Bedeutung ist. Denn nach Ansicht verschiedener Wissenschaftler ist das fötale Wachstum direkt an die Stimulation durch die Bewegungen der Lanugohärchen gebunden.6 Sie vermuten, dass die Impulssalven aus den Haarsensoren wichtige Hirnregionen (Hypothalamus, Inselkortex) erreichen und das parasympathische Nervensystem aktivieren. Diese neuronale Erregungskette im Gehirn löst die Ausschüttung des Wachstumshormons Oxytocin aus, das ab der 16. Schwangerschaftswoche im Hypothalamus von Föten nachgewiesen werden kann. Gleichzeitig führt die Erregung des Inselkortex wahrscheinlich zu ersten positiven Körperempfindungen des Fötus. Sowohl das Oxytocin als auch der Inselkortex spielen nachgeburtlich eine zentrale Rolle für alle sozialen und kognitiven sowie körperlichen Entwicklungsprozesse des Säuglings.
Vermutlich befördert die Lanugobehaarung – genauer: die Zunahme der tastsensiblen Stimulationen über die Rezeptoren der Lanugohärchen und die hierdurch ausgelösten positiven emotionalen Effekte – auch die zunehmende Bewegungsaktivität des Fötus ab der 18. Schwangerschaftswoche. Damit etabliert sich im Fötus ein Regelkreis, der auch nachgeburtlich eine der wichtigen Grundlagen für motorische Lernprozesse und die emotionale Verbindung zwischen Bewegungs- und Berührungsstimulation ist. Dass die Lanugobehaarung offensichtlich nicht der zarte Rest einer evolutionär bedingten Fellbehaarung ist, zeigt sich daran, dass sich dieses feine Haarkleid ab der 33. Schwangerschaftswoche zurückbildet.
Zwischen der 15. und der 20. Schwangerschaftswoche konzentrieren sich die sensorischen Entwicklungsprozesse auf die Ausreifung der Tast- und Bewegungssensibilität sowie der Bewegungsfähigkeit des Fötus. Kopf, Hände, Füße, Rumpf und die Gesichtsmuskeln können dann einzeln und relativ koordiniert im engen Raum des Uterus bewegt werden. Eine Meisterleistung der Natur: Innerhalb von nur 20 Wochen hat sich eine der zentralen Lebensgrundlagen eines jeden Organismus – die Bewegungsfähigkeit im Verbund mit der inneren und der äußeren Empfindungsfähigkeit – ohne willentliches Zutun einer kontrollierenden Instanz, wie von Zauberhand gelenkt, entwickelt. Der Fötus ist jetzt ca. 16 Zentimeter groß, und die Hälfte der Zeit bis zum regulären Geburtstermin ist verstrichen.
Bis zu diesem Zeitpunkt vollziehen sich die Entwicklungs- und Reifungsschritte unkommentiert und ungestört von Einflüssen der übrigen Sinnessysteme (s. Abbildung 2). Im Hintergrund reifen deren Rezeptoren und neuronale Verbindungen, aber noch sind sie nicht so weit entwickelt, dass sie Umweltreize verarbeiten könnten. Noch kann der Fötus seine geräuschvolle Umgebung nicht hören. Er erschrickt noch nicht, falls ein lautes Geräusch zu ihm durchdringt. Auch der Singsang der mütterlichen Stimme oder die sich ständig ändernden mütterlichen Körpergeräusche können noch nicht verarbeitet werden. Erst ab der 24. Schwangerschaftswoche sind die für das Hören zuständigen Rezeptoren und neuronalen Systeme so weit ausgereift, dass ein breites Frequenzspektrum an Schalldruckwellen wahrgenommen und verarbeitet werden kann. Entscheidend für das, was wir als Hören bezeichnen, ist die Ausreifung der mikroskopisch kleinen Haarzellen innerhalb des Cortischen Organs in der Basilarmembran des Ohres und der von dort zum Gehirn führenden Nervenfasern. Diese Haarzellen sind umgeben von einer Flüssigkeit, die bei der Einwirkung von Schallwellen in Bewegung versetzt wird. Die Bewegung verbiegt die Haarzellen, und über viele biochemische und bioelektrische Zwischenschritte wird ein Höreindruck möglich. Offensichtlich hat die Natur das Grundprinzip der Tastsinneswahrnehmung bei der Etablierung des Hörsystems zum Vorbild genommen. Hören ist letztlich die Fähigkeit, wechselnde (Luft-)Druckereignisse (auch Vibrationen genannt) unterschiedlicher Frequenz durch geeignete Rezeptoren zu erfassen und durch das neuronale System zu verarbeiten. Vor diesem Hintergrund ist das Hören eine spezialisierte und auf eine bestimmte Körperregion begrenzte Form der Tastsinneswahrnehmung.
Die enge biologische Kopplung zwischen dem Tastsinnes- und dem Hörsystem macht verständlich, warum uns Musik oder eine schöne Stimmlage im Gespräch buchstäblich »unter die Haut« gehen kann. Wenn wir hören, dann ist dies metaphorisch betrachtet eine besondere und spezialisierte Art der körperlichen Berührung; die Haarzellen unseres Innenohrs ertasten gleichsam die physikalischen Druckschwankungen aus der äußeren Welt. Hautberührungen und die Erregung der Haarzellen in unserem Innenohr können wir mit hoher Präzision wahrnehmen, weil die sensorischen Grundlagen demselben biologischen Bauprinzip und einer biologischen Notwendigkeit folgen. Diese besteht darin, dass jeder Organismus in einer dreidimensionalen Umwelt möglichst ein breites Spektrum physikalischer Krafteinwirkungen auf den Körper registrieren sollte. Diese Sensibilität schützt den Organismus nicht nur, sondern bietet ihm darüber hinaus Anpassungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Vereinfacht formuliert: Ein Organismus, der auf vielfältige Weise fühlen kann, ist ganz klar im Vorteil auf dieser Welt. Und nichts Lebendiges auf unserer Welt existiert, was nicht über diese Fähigkeit verfügen würde.
Zur gleichen Zeit und auch am anatomisch gleichen Ort – dem Innenohr – entwickelt sich noch eine andere sensible Struktur. Diese wird im Zusammenspiel mit dem Tastsinnessystem dafür sorgen, dass wir stets sicher empfinden können, in welcher Position sich unser Kopf in Bezug zum gesamten Körper befindet. Auch wird sie dafür verantwortlich sein, festzustellen, wie und ob unser Körper gedreht, beschleunigt oder etwa fallen gelassen wird. Die Rede ist vom Gleichgewichtsorgan mit seinen drei Bogengängen und zwei Vorhofsäckchen. Im Inneren dieser Struktur befinden sich ebenfalls mikroskopisch kleine Haarsensoren. Deren elektrophysiologische Erregung erfolgt durch Dehnung und Stauchung, wenn die Flüssigkeiten und gallertigen Substanzen in den Bogengängen und den Vorhofsäcken in Bewegung geraten. Dieses Sinnessystem registriert ab der 25. Schwangerschaftswoche Lageveränderungen des Kopfes und somit auch Drehbewegungen des gesamten Körpers. Es wird angenommen, dass mittels dieses Sinnessystems der Fötus seine Position im Mutterleib wahrnehmen und durch aktive Eigenbewegungen seine Lage für den späteren Geburtsvorgang optimieren kann. Warum sich der Fötus jedoch in die richtige Lage für eine Geburt bringt (oder auch nicht), ist wissenschaftlich noch nicht geklärt. Es wird vermutet, dass die Schallübertragung der Mutterstimme in deren Beckenbereich am besten ist und der Fötus das Bestreben hat, eine für ihn optimale akustische Position im Mutterbauch zu finden.7
Fötale Selbstberührungen
Sobald der Fötus seine Arme und Beine isoliert voneinander bewegen kann, führt er in den Wachphasen sehr komplexe und auch zielgerichtete Bewegungen aus. Deren Anzahl und Komplexität stehen in Zusammenhang mit der neuronalen Ausreifung des fötalen Gehirns und mit dem psychischen Zustand der Mutter.8 Das vorgeburtliche Bewegungsrepertoire ist je nach Entwicklungsstadium – wie bereits angedeutet – ausgesprochen vielfältig. Ein Großteil der Arm- und Handbewegungen ist dabei auf den eigenen Körper gerichtet. Der Fötus berührt sowohl mit der linken als auch mit der rechten Hand seinen Oberkörper, seine Beine und Füße sowie seinen Kopf. Bislang ist noch nicht abschließend geklärt, weshalb er das tut und welche Funktionen derartige Bewegungen für ihn haben. Besonders die sehr häufig auftretenden Explorationen des Kopfes und vor allem des Gesichts sind in ihrer Funktion für den Fötus weitgehend ungeklärt.





























