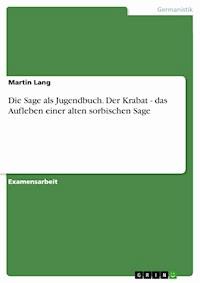49,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haug Fachbuch
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Kinder erfolgreich homöopathisch therapieren Auf die wesentlichen Grundlagen konzentriert und an die Praxissituation des pädiatrisch tätigen Therapeuten angepasst, bietet Ihnen dieses Nachschlagewerk eine rasche und direkte Hilfestellung zur homöopathischen Behandlung - auch unter Zeitdruck Die wichtigsten Arzneimittelbilder sind anhand der Leitsymptome kurz und prägnant dargestellt. Damit festigen Sie Ihre Arzneimittelkenntnisse. Mind-Maps ermöglichen einen schnellen Überblick über bewährte pädiatrische Indikationen und die infrage kommenden Arzneimittel. Die homöopathischen Arzneien sind einheitlich und fundiert beschrieben und den häufigsten Krankheitsbildern in der Pädiatrie zugeordnet. So bekommen Sie in kurzer Zeit eine zuverlässige Orientierungshilfe und erhöhen die Erfolgsrate Ihrer homöopathischen Behandlung. Homöopathie einfach und zeitsparend integrieren!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Martin Lang, Wilhelm Rauh
Homöopathische Behandlung von Kindern
70 Abbildungen
Vorwort
„Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, um Hilfe zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und die Arbeit einzuteilen, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem weiten Meer.“ (Antoine de Saint-Exupéry)
Wir haben dieses Buch über die Anwendung der Homöopathie im Kindesalter geschrieben, weil sie den Arbeitsalltag in der täglichen Praxis unendlich bereichert. Durch die Methode lernen wir enorm viel über die Individualität jedes Einzelnen kennen, der Kontakt zu Eltern und Kindern wird intensiviert und damit die Arzt-Patienten-Bindung gestärkt. Durch das genaue Achten auf die individuellen Symptome einer Erkrankung steigert sich die Menschenkenntnis und wir haben in vielen Situationen eine größere Behandlungsoption – alles Faktoren, die die Zufriedenheit in der Praxis deutlich steigern.
Oft ist in einer gut gehenden Praxis leider der Faktor Zeit limitierend für die homöopathische Therapie. Akut kann keine konstitutionelle Therapie über ein bis zwei Stunden durchgeführt werden, da andere Patienten bereits auf eine Behandlung warten. Deswegen ist es von Nutzen, bei einigen Erkrankungen auf sogenannte „Bewährte Indikationen“ zurückgreifen zu können. Meist ist es aber möglich, gut informierte und entsprechend in der Beobachtung geschulte Eltern so zu befragen, dass sich ein „vollständiges Symptom“ (Kap. ▶ 1.1) ergibt. Damit lässt sich in vielen Fällen eine ausgezeichnete homöopathische Therapie einleiten.
Und genau hier setzt dieses Buch an: „Praxiswissen kompakt“ kann zwar nie ein Ersatz für intensives Studium einer Methodik sein, aber es kann als Orientierungshilfe bei Erkrankungen dienen, die einer raschen Behandlung bedürfen.
Im orangen Teil des Buches werden wenige unverzichtbare Grundlagen der Homöopathie erörtert, ein Kapitel, das bewusst sehr knapp gehalten wurde, um den Rahmen nicht zu sprengen.
Im grünen Teil werden die wichtigsten Arzneimittelbilder anhand der Leitsymptome dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf der Herkunft der einzelnen Arzneien und deren Essenz liegt. Dadurch kann der Therapeut seine Arzneimittelkenntnisse festigen und eine Art Feinfühligkeit für das entsprechende Heilmittel entwickeln.
Im blauen Teil, dem umfangreichsten Abschnitt des Buches, werden die häufigsten pädiatrischen Akutkrankheitsbilder und deren homöopathische Therapeutika dargestellt. Damit sollte der Großteil der täglichen Behandlungen möglich sein. Um eine rasche und bessere Orientierung bezüglich der infrage kommenden Heilmittel zu ermöglichen, stellten wir jedem Krankheitsbild eine sogenannte Mind-Map voran.
Der rote Teil rundet das Buch ab, indem er sozialmedizinisch bedeutende Krankheitsbilder erörtert. Hier ist uns klar, dass wir nur die häufigsten Therapeutika darstellen konnten, denn es handelt sich meist um chronische Krankheitsbilder, die einer ausführlichen Anamnese bedürfen und somit so individuell sind wie die Kinder und Jugendlichen, die daran leiden.
Teilaspekte vieler Arzneimittelbilder werden an diversen Stellen im Buch beschrieben, sodass es im Sinne der Ganzheitlichkeit Sinn macht, wenn der Leser die folgende Tabelle heranzieht, um sich einen umfassenden Gesamteindruck des Heilmittels zu verschaffen.
Tab. no.1
Beschriebene Arzneimittelbilder.
Arzneimittel
Abkürzung
Seitenzahl
Aconitum napellus
Acon.
▶ Aconitum napellus
Antimonium tartaricum
Ant-t.
▶ Antimonium tartaricum (Tartarus stibiatus)
Apis mellifica
Apis
▶ Apis mellifica
Argentum nitricum
Arg-n.
▶ Argentum nitricum
Arnica montana
Arn.
▶ Arnica montana
Arsenicum album
Ars.
▶ Arsenicum album
Belladonna
Bell.
▶ Belladonna
Berberis vulgaris
Berb.
▶ Berberis vulgaris
Borax veneta
Bor.
▶ Borax veneta
Bryonia alba
Bry.
▶ Bryonia alba
Calcium carbonicum
Calc-c.
▶ Calcium carbonicum
Calcium phosphoricum
Calc-p.
▶ Calcium phosphoricum
Cantharis vesicatoria
Canth.
▶ Cantharis vesicatoria
Carbo vegetabilis
Carb-v.
▶ Carbo vegetabilis
Carcinosinum
Carc.
▶ Carcinosinum
Causticum Hahnemanni
Caust.
▶ Causticum Hahnemanni
Chamomilla
Cham.
▶ Chamomilla
China officinalis
Chin.
▶ China officinalis
Colocynthis
Coloc.
▶ Colocynthis
Cuprum metallicum
Cupr.
▶ Cuprum metallicum
Drosera rotundifolia
Dros.
▶ Drosera rotundifolia
Eupatorium perfoliatum
Eup-per.
▶ Eupatorium perfoliatum
Euphrasia officinalis
Euphr.
▶ Euphrasia officinalis
Ferrum phosphoricum
Ferr-p.
▶ Ferrum phosphoricum
Gelsemium sempervirens
Gels.
▶ Gelsemium sempervirens
Graphites naturalis
Graph.
▶ Graphites naturalis
Hepar sulfuris
Hep.
▶ Hepar sulfuris
Hyoscyamus niger
Hyos.
▶ Hyoscyamus niger
Hypericum perforatum
Hyper.
▶ Hypericum perforatum
Ignatia amara
Ign.
▶ Ignatia amara
Ipecacuanha
Ip.
▶ Ipecacuanha
Kalium bichromicum
Kali-bi.
▶ Kalium bichromicum
Kalium carbonicum
Kali-c.
▶ Kalium carbonicum
Lachesis muta
Lach.
▶ Lachesis muta
Lycopodium clavatum
Lyc.
▶ Lycopodium clavatum
Magnesium carbonicum
Mag-c.
▶ Magnesium carbonicum
Medorrhinum
Med.
▶ Medorrhinum
Mercurius solubilis
Merc.
▶ Mercurius solubilis
Natrium muriaticum
Nat-m.
▶ Natrium muriaticum
Nux vomica
Nux-v.
▶ Nux vomica
Phosphoricum acidum
Ph-ac.
▶ Phosphoricum acidum
Phosphorus
Phos.
▶ Phosphorus
Psorinum
Psor.
▶ Psorinum
Pulsatilla pratensis
Puls.
▶ Pulsatilla pratensis
Rhus toxicodendron
Rhus-t.
▶ Rhus toxicodendron
Sepia succus
Sep.
▶ Sepia succus
Silicea terra
Sil.
▶ Silicea terra
Staphisagria
Staph.
▶ Staphisagria
Stramonium
Stram.
▶ Stramonium
Sulfur
Sulf.
▶ Sulfur
Thuja occidentalis
Thuj.
▶ Thuja occidentalis
Tuberculinum
Tub.
▶ Tuberculinum
Veratrum album
Verat.
▶ Veratrum album
Zincum metallicum
Zinc.
▶ Zincum metallicum
Viel Erfolg wünschen wir allen Anwendern des Buches „Praxiswissen kompakt“ zum Nutzen ihrer Patienten.
Augsburg und Kempten im Mai 2013
Dr. Martin Lang, Dr. Wilhelm Rauh
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Teil I Grundlagen der Homöopathie
1 Vom Simile zum Simillimum
1.1 Das Erfassen des vollständigen Symptoms
1.2 Das Hierarchisieren
1.3 Die richtige Dosis
1.3.1 Die Potenzierung
1.3.2 Die Auswahl der Potenz
1.3.3 Die Art und Häufigkeit der Verabreichung
1.4 Was ist ein Arzneimittelbild?
1.5 Die homöopathische Fallaufnahme
1.5.1 Die Technik der Anamneseerhebung
1.5.2 Besonderheiten im Kindesalter
Teil II Arzneimittelbilder
2 Polychreste
2.1 Die großen Arzneien
2.2 Aconitum napellus
2.2.1 Herkunft/Toxikologie
2.2.2 Arzneiwesen/Essenz
2.2.3 Leitsymptome
2.3 Apis mellifica
2.3.1 Herkunft/Toxikologie
2.3.2 Arzneiwesen/Essenz
2.3.3 Leitsymptome
2.4 Arsenicum album
2.4.1 Herkunft/Toxikologie
2.4.2 Arzneiwesen/Essenz
2.4.3 Leitsymptome
2.5 Belladonna
2.5.1 Herkunft
2.5.2 Arzneiwesen/Essenz
2.5.3 Leitsymptome
2.6 Bryonia alba
2.6.1 Herkunft
2.6.2 Arzneiwesen/Essenz
2.6.3 Leitsymptome
2.7 Calcium carbonicum
2.7.1 Herkunft
2.7.2 Arzneiwesen/Essenz
2.7.3 Leitsymptome
2.8 Carcinosinum
2.8.1 Herkunft
2.8.2 Arzneiwesen/Essenz
2.8.3 Leitsymptome
2.9 Causticum Hahnemanni
2.9.1 Herkunft/Toxikologie
2.9.2 Arzneiwesen/Essenz
2.9.3 Leitsymptome
2.10 Chamomilla
2.10.1 Herkunft/Toxikologie
2.10.2 Arzneiwesen/Essenz
2.10.3 Leitsymptome
2.11 Ferrum phosphoricum
2.11.1 Herkunft/Toxikologie
2.11.2 Arzneiwesen/Essenz
2.11.3 Leitsymptome
2.12 Gelsemium sempervirens
2.12.1 Herkunft/Toxikologie
2.12.2 Arzneiwesen/Essenz
2.12.3 Leitsymptome
2.13 Graphites naturalis
2.13.1 Herkunft/Toxikologie
2.13.2 Arzneiwesen/Essenz
2.13.3 Leitsymptome
2.14 Hepar sulfuris
2.14.1 Herkunft/Toxikologie
2.14.2 Arzneiwesen/Essenz
2.14.3 Leitsymptome
2.15 Ignatia amara
2.15.1 Herkunft/Toxikologie
2.15.2 Arzneiwesen/Essenz
2.15.3 Leitsymptome
2.16 Ipecacuanha
2.16.1 Herkunft/Toxikologie
2.16.2 Arzneiwesen/Essenz
2.16.3 Leitsymptome
2.17 Kalium carbonicum
2.17.1 Herkunft/Toxikologie
2.17.2 Arzneiwesen/Essenz
2.17.3 Leitsymptome
2.18 Lachesis muta
2.18.1 Herkunft/Toxikologie
2.18.2 Arzneiwesen/Essenz
2.18.3 Leitsymptome
2.19 Lycopodium clavatum
2.19.1 Herkunft/Toxikologie
2.19.2 Arzneiwesen/Essenz
2.19.3 Leitsymptome
2.20 Mercurius solubilis
2.20.1 Herkunft/Toxikologie
2.20.2 Arzneiwesen/Essenz
2.20.3 Leitsymptome
2.21 Natrium muriaticum
2.21.1 Herkunft/Toxikologie
2.21.2 Arzneiwesen/Essenz
2.21.3 Leitsymptome
2.22 Nux vomica
2.22.1 Herkunft/Toxikologie
2.22.2 Arzneiwesen/Essenz
2.22.3 Leitsymptome
2.23 Phosphorus
2.23.1 Herkunft/Toxikologie
2.23.2 Arzneiwesen/Essenz
2.23.3 Leitsymptome
2.24 Pulsatilla pratensis
2.24.1 Herkunft
2.24.2 Arzneiwesen/Essenz
2.24.3 Leitsymptome
2.25 Rhus toxicodendron
2.25.1 Herkunft/Toxikologie
2.25.2 Arzneiwesen
2.25.3 Leitsymptome
2.26 Sepia succus
2.26.1 Herkunft/Toxikologie
2.26.2 Arzneiwesen/Essenz
2.26.3 Leitsymptome
2.27 Silicea terra
2.27.1 Herkunft/Toxikologie
2.27.2 Arzneiwesen/Essenz
2.27.3 Leitsymptome
2.28 Staphisagria
2.28.1 Herkunft/Toxikologie
2.28.2 Arzneiwesen/Essenz
2.28.3 Leitsymptome
2.29 Stramonium
2.29.1 Herkunft/Toxikologie
2.29.2 Arzneiwesen/Essenz
2.29.3 Leitsymptome
2.30 Sulfur
2.30.1 Herkunft/Toxikologie
2.30.2 Arzneiwesen/Essenz
2.30.3 Leitsymptome
2.31 Thuja occidentalis
2.31.1 Herkunft/Toxikologie
2.31.2 Arzneiwesen/Essenz
2.31.3 Leitsymptome
2.32 Tuberculinum
2.32.1 Herkunft/Toxikologie
2.32.2 Arzneiwesen/Essenz
2.32.3 Leitsymptome
2.33 Veratrum album
2.33.1 Herkunft/Toxikologie
2.33.2 Arzneiwesen/Essenz
2.33.3 Leitsymptome
3 Kleinere Arzneien
3.1 Allgemein
3.2 Antimonium tartaricum (Tartarus stibiatus)
3.2.1 Herkunft
3.2.2 Arzneiwesen/Essenz
3.2.3 Leitsymptome
3.3 Argentum nitricum
3.3.1 Herkunft/Toxikologie
3.3.2 Arzneiwesen/Essenz
3.3.3 Leitsymptome
3.4 Arnica montana
3.4.1 Herkunft
3.4.2 Arzneiwesen/Essenz
3.4.3 Leitsymptome
3.5 Berberis vulgaris
3.5.1 Herkunft/Toxikologie
3.5.2 Arzneiwesen/Essenz
3.5.3 Leitsymptome
3.6 Borax veneta
3.6.1 Herkunft/Toxikologie
3.6.2 Arzneiwesen/Essenz
3.6.3 Leitsymptome
3.7 Calcium phosphoricum
3.7.1 Herkunft
3.7.2 Arzneiwesen/Essenz
3.7.3 Leitsymptome
3.8 Cantharis vesicatoria
3.8.1 Herkunft/Toxikologie
3.8.2 Arzneiwesen/Essenz
3.8.3 Leitsymptome
3.9 Carbo vegetabilis
3.9.1 Herkunft/Toxikologie
3.9.2 Arzneiwesen/Essenz
3.9.3 Leitsymptome
3.10 China officinalis
3.10.1 Herkunft/Toxikologie
3.10.2 Arzneiwesen/Essenz
3.10.3 Leitsymptome
3.11 Colocynthis
3.11.1 Herkunft/Toxikologie
3.11.2 Arzneiwesen/Essenz
3.11.3 Leitsymptome
3.12 Cuprum metallicum
3.12.1 Herkunft/Toxikologie
3.12.2 Arzneiwesen/Essenz
3.12.3 Leitsymptome
3.13 Drosera rotundifolia
3.13.1 Herkunft/Toxikologie
3.13.2 Arzneiwesen/Essenz
3.13.3 Leitsymptome
3.14 Eupatorium perfoliatum
3.14.1 Herkunft/Toxikologie
3.14.2 Arzneiwesen/Essenz
3.14.3 Leitsymptome
3.15 Euphrasia officinalis
3.15.1 Herkunft/Toxikologie
3.15.2 Arzneiwesen/Essenz
3.15.3 Leitsymptome
3.16 Hyoscyamus niger
3.16.1 Herkunft/Toxikologie
3.16.2 Arzneiwesen/Essenz
3.16.3 Leitsymptome
3.17 Hypericum perforatum
3.17.1 Herkunft/Toxikologie
3.17.2 Arzneiwesen/Essenz
3.17.3 Leitsymptome
3.18 Kalium bichromicum
3.18.1 Herkunft/Toxikologie
3.18.2 Arzneiwesen/Essenz
3.18.3 Leitsymptome
3.19 Magnesium carbonicum
3.19.1 Herkunft/Toxikologie
3.19.2 Arzneiwesen/Essenz
3.19.3 Leitsymptome
3.20 Medorrhinum
3.20.1 Herkunft/Toxikologie
3.20.2 Arzneiwesen/Essenz
3.20.3 Leitsymptome
3.21 Phosphoricum acidum
3.21.1 Herkunft/Toxikologie
3.21.2 Arzneiwesen/Essenz
3.21.3 Leitsymptome
3.22 Psorinum
3.22.1 Herkunft
3.22.2 Arzneiwesen/Essenz
3.22.3 Leitsymptome
3.23 Zincum metallicum
3.23.1 Herkunft/Toxikologie
3.23.2 Arzneiwesen/Essenz
3.23.3 Leitsymptome
Teil III Krankheitsbilder in der homöopathischen Kinderpraxis
4 Bewährte Indikationen
4.1 Anpassungsstörungen im Neugeborenenalter
4.1.1 Gedeihstörung
4.1.2 Trinkstörung, Erbrechen
4.1.3 Blähkoliken durch unreife Verdauung
4.1.4 Überreizung
4.1.5 Trennungs-, Traumaerfahrung
4.2 Erkrankungen im Säuglingsalter
4.2.1 Gelbsucht
4.2.2 Zahnungsbeschwerden
4.2.3 Windeldermatitis/Windelsoor
4.2.4 Mundsoor
4.3 Fieber, grippale Infekte
4.3.1 Fieber mit Unruhe
4.3.2 Fieber mit einsetzender Schwäche
4.3.3 Fieber mit Durst
4.3.4 Fieber mit Durstlosigkeit
4.4 Kopfschmerzen
4.4.1 Kopfschmerz durch Überarbeitung/Schulkopfschmerz
4.4.2 Kopfschmerz bei Infekten/Fieber
4.4.3 Kopfschmerz bei Hitze/Wärmeunverträglichkeit
4.5 Augenerkrankungen
4.5.1 Konjunktivitis
4.5.2 Gerstenkorn/Hagelkorn
4.5.3 Tränengangstenose/Säuglingskonjunktivitis
4.6 Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen
4.6.1 Rhinitis
4.6.2 Pharyngitis, Angina tonsillaris
4.6.3 Adenoide, Tonsillenhypertrophie
4.6.4 Otitis media
4.6.5 Sinusitis
4.7 Atemwegserkrankungen
4.7.1 Husten/Bronchitis
4.7.2 Laryngotracheitis/Kruppsyndrom
4.7.3 Obstruktive Bronchitis/Asthma bronchiale
4.7.4 Pneumonie
4.8 Magen-Darm-Erkrankungen
4.8.1 Übelkeit/Erbrechen
4.8.2 Bauchschmerzen
4.8.3 Durchfall
4.8.4 Obstipation
4.9 Urogenitalerkrankungen
4.9.1 Blaseninfektion
4.9.2 Aufsteigende Harnwegsinfektion, Nephritis
4.9.3 Vulvovaginitis, Fluor vaginalis
4.10 Erkrankungen des Bewegungsapparates
4.10.1 Gelenkentzündung
4.10.2 Rheumatische Beschwerden
4.10.3 Wachstumsschmerzen
Teil IV Entwicklungs- und Verhaltensstörungen
5 Bewährte Indikationen
5.1 Schlafstörungen
5.1.1 Geringes Schlafbedürfnis
5.1.2 Innere Unruhe
5.1.3 Kummer, Sorgen
5.1.4 Angst
5.2 Enuresis
5.2.1 Reifungsverzögerung
5.2.2 Konflikt-Einnässen
5.3 Verhaltensstörungen
5.3.1 Nägelkauen
5.3.2 Tic-Störungen
5.3.3 Stottern
5.4 Aufmerksamkeitsdefizit
5.4.1 Hyperkinetisches Verhalten
5.4.2 Oppositionelles Verhalten
5.4.3 ZNS-Entwicklungsverzögerung, Konzentrationsschwäche
5.4.4 Träumerchen
Teil V Anhang
Literatur
Abbildungsnachweis
Autorenvorstellung
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum
Teil I Grundlagen der Homöopathie
1 Vom Simile zum Simillimum
1 Vom Simile zum Simillimum
Wir verdanken Samuel Hahnemann (1755–1843) und seinen engsten Mitstreitern die Prinzipien der Homöopathie. Angeregt durch einen Selbstversuch, in dem er Chinarinde einnahm und dadurch Symptome erfuhr, die einer Malaria glichen, formulierte Hahnemann die These, dass Krankheiten nur heilbar sind durch Arzneimittel, die beim Gesunden ähnliche Symptome wie die Krankheit selbst hervorrufen. In der Einleitung seines für alle Homöopathen grundlegenden Werkes Organon der Heilkunst formuliert er dies mit:
„Wähle, um sanft, schnell, gewiß und dauerhaft zu heilen, in jedem Krankheitsfalle eine Arznei, welche ein ähnliches Leiden für sich erregen kann, als sie heilen soll!“
oder:
„Similia similibus curentur.“ (Ähnliches wird mit Ähnlichem geheilt.)
Um diese These zu stützen, musste er viele Versuche unternehmen und zahlreiche Heilmittel erproben, was er letztendlich in § 50 des Organon zusammenfasst als „Natur-Heilgesetz“.
Nun ist es aber nicht so einfach, ein Arzneimittel zu finden, das einer Krankheit möglichst ähnliche Symptome hervorruft, wenn es eingenommen wird. Dazu bedarf es einer sehr guten Arzneimittelkenntnis und einer genauen Beobachtung bzw. Untersuchung des Kranken, um dessen individuelle Reaktionen auf die zu behandelnde Krankheit zu erkennen.
1.1 Das Erfassen des vollständigen Symptoms
Für den Homöopathen entscheidend ist die vorurteilsfreie Erfassung aller Symptome einer Krankheit, die den Einzelfall von anderen Krankengeschichten unterscheidet. Dies nennt man „Prinzip der Individualisierung“. Im Spontanbericht des Patienten am Beginn einer Behandlung werden wir viele Symptome erfahren, die eine Krankheit hervorgerufen hat. Die sogenannten pathognomonischen Symptome, also diejenigen, die typisch für die Erkrankung sind und von den meisten Patienten gleich erfahren werden, sind für die Arzneimittelwahl nur von geringem Wert. Entscheidend sind die für den einzelnen Patienten eigentümlichen, spezifischen Symptome, die den Krankheitsfall von anderen unterscheidet. Um dies herauszufinden, brauchen wir während der Sprechstunde stets unsere ganze Aufmerksamkeit, eine Herausforderung, die den Alltag spannend und bereichernd macht.
Allerdings wird der Spontanbericht des Patienten – bzw. bei uns meist der Eltern des betroffenen Kindes – nicht so ausführlich und genau sein, dass wir bereits jetzt ein treffendes Heilmittel wählen könnten.
Deswegen bedienen wir uns eines Fragenkomplexes, der die Anamnese vervollständigt:
Wo? Wo sind die Hauptbeschwerden?
Wie? Wie empfindet der Patient sein Leiden? Hier finden sich Empfindungen, oft auch Richtungen, Seitenbezüge und sogenannte „Als ob…“-Symptome.
Wann? Wann treten die Schmerzen oder Beschwerden auf? Gibt es eine bestimmte Zeit (Tages- oder Jahreszeit) oder andere Umstände, wodurch sich das Leiden bessert oder verschlechtert? Hier geht es um die sogenannten Modalitäten, auf die vor allem Bönninghausen, ein Zeitgenosse Hahnemanns, großen Wert gelegt hat. Durch diese wird der Einzelfall individualisiert und damit für den Homöopathen im Sinne der Mittelfindung wertvoll. Modalitäten sind meist bipolar, gefragt wird dabei nach dem Einfluss von Temperatur, Wetter, Wärme oder Kälte, Bewegung, Ruhe, Lage, Haltung, Berührung, Trost, Stimmungslage etc. Wert gewinnt eine Modalität vor allem dann, wenn sie der medizinischen Erfahrung widerspricht, wenn sich beispielsweise eine Jugendlichenakne durch Essen von Süßigkeiten oder Schokolade bessert oder sich Zahnschmerzen bessern durch Essen fester Nahrung.
Womit? Womit geht das Hauptsymptom einher? Diese Begleitsymptome können wegweisenden Charakter haben, wenn sie nicht in kausalem Zusammenhang mit der Hauptbeschwerde stehen, wenn sie also außergewöhnlich (im Sinne des § 153 des Organon) sind. Wenn ein Kind über rezidivierende Kopfschmerzen klagt und dabei stets auch Schmerzen in den Waden auftreten, so wäre dies ein ungewöhnliches Zusammentreffen zweier kausal voneinander unabhängiger Symptome. Dies beschrieb Hahnemann in § 153 als „auffallende, sonderliche, ungewöhnliche und eigenheitliche (charakteristische) Zeichen und Symptome“. Wenn aber im Zusammenhang mit Kopfschmerzen das (zu erwartende) Bedürfnis nach Ruhe, Abgeschiedenheit und einem kalten Waschlappen auf die Stirn auftreten, so ist diesen Zeichen anfangs keine große Bedeutung beizumessen, da es sich um pathognomonische Symptome handelt, die den Fall nur unzureichend individualisieren.
Warum? Warum treten die Symptome auf? Gibt es eine spezifische Ursache, einen Auslöser, eine Ätiologie der Erkrankung? Eine eindeutige Kausalität wäre für die Mittelfindung von großer Bedeutung.
Durch den Spontanbericht und diese ergänzenden fünf Fragen erfassen wir das sogenannte vollständige Symptom, wodurch in der Regel eine treffende Arzneimittelwahl im Akutfall erfolgen kann.
1.2 Das Hierarchisieren
Werden nun aber alle Symptome, die der Patient berichtet bzw. die durch die körperliche Untersuchung gefunden werden, nur gesammelt und repertorisiert, so wird dies vor allem in chronischen Krankheitsfällen nicht zielführend sein, da selten ein Arzneimittel alle Symptome beinhalten wird. Deswegen müssen die Symptome unterschiedlich gewichtet werden. Dabei wird den für den Patienten und seine Erkrankung individuellsten Symptomen das meiste Gewicht gegeben und den für die Krankheit pathognomonischen Symptomen nur untergeordnete Bedeutung beigemessen.
Bewährt hat sich dafür folgendes, auf Kent und Künzli zurückgehendes Hierarchisierungsschema:
Auffallende, sonderliche, charakteristische Zeichen und Symptome: Wie oben beschrieben, je größer die Abweichung von der erwarteten, „normalen“ Reaktion, umso individueller und wertvoller ist das Symptom. Hier finden sich unerwartete Begleitreaktionen, Modalitäten, Zeiten, Periodizitäten und außergewöhnliche Lokalisationen.
Geistes- und Gemütssymptome: Sie sollten gut beobachtbar sein und den derzeitigen Gemütszustand des Patienten betreffen.
Allgemeinsymptome: Diese sind gut beobachtbar und erfassbar durch den Körperbau, die Physiognomie, allgemeine Wesensmerkmale des Patienten, Abneigungen und Verlangen, Essensmodalitäten, insgesamt also Zeichen, die den gesamten Menschen betreffen.
Causa oder Ätiologie: Gibt es einen Grund der Erkrankung auf psychischem oder physischem Gebiet? Gibt es Umwelteinflüsse, Lebensumstände etc., die die Krankheit ausgelöst haben könnten?
Lokalsymptome: Oft sind sie der eigentliche Vorstellungsgrund für eine homöopathische Anamnese. Beispielsweise chronische Ekzeme, Asthma bronchiale, Bauchschmerzen, Tonsillitiden, Diarrhöe oder Obstipation.
Weitere Grundsätze sollten beachtet werden:
Die zuletzt aufgetretenen Symptome sollten bei der Repertorisation das höchste Gewicht erlangen, denn diese sollten auch als erstes verschwinden („Hering‘sche Regel“, s. u.).
Die Stärke eines Symptoms hat keinen Einfluss auf dessen Einordnung.
Nicht eindeutig geäußerte Symptome bzw. nur durch Interpretation gewonnene Erkenntnisse sollten bei der Repertorisation keine Verwendung finden.
Bei richtiger Therapie erfolgt die Heilung nach der sogenannten Hering‘schen Regel:
von oben nach unten
von innen nach außen
und in umgekehrter Reihenfolge des Auftretens
Wurde die Symptomgewichtung durchgeführt und erfolgte die Repertorisation der Symptome, so finden sich anschließend meist mehrere zur Wahl stehende Arzneimittel. Daraufhin ist es notwendig, ein gründliches Arzneimittelstudium durchzuführen, um das für den Patienten und seine Erkrankung ähnlichste Heilmittel – das Simillimum – zu finden.
1.3 Die richtige Dosis
Wie ganz am Anfang erwähnt, experimentierte Hahnemann zu Beginn der Homöopathie mit vielen Substanzen, um herauszufinden, ob Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen sei. Dabei benutzte er auch giftige Pflanzen, die er deswegen verdünnen musste, um keine Vergiftungserscheinungen bei sich selbst und den anderen Prüfern hervorzurufen. Diese Verdünnungsreihe führte er so lange durch, bis sich keine Arzneiwirkung mehr erzielen ließ.
Während seiner Experimente machte er die Entdeckung, dass zwar das reine Verdünnen die Wirkung der Arznei vermindert, jedoch das Verschütteln bzw. Schlagen der Verdünnung auf ein mit Leder eingebundenes Buch die Wirkung verstärkt. Und zwar je häufiger die Substanz verschüttelt oder verrieben wurde, umso stärker war seine Wirkung. Dies ist erstaunlich, denn rein physikalisch gesehen ist bei den hohen Verdünnungen nichts mehr von der Ursubstanz in der verschüttelten Lösung zu finden. Dieses Phänomen nannte Hahnemann deswegen auch „Dynamisation“ oder „Potenzierung“.
Dies ist bis heute für viele Kritiker der Homöopathie der Hauptansatzpunkt: „Wie kann sich eine arzneiliche Wirkung entfalten, wo sich doch keine Materie befindet?“ Diese Frage wird sich dem rein naturwissenschaftlich orientierten Therapeuten nicht erschließen, da die Wirkung nicht auf molekularer Ebene und deren Nachweis beruht, sondern vermutlich auf einer derzeit nicht nachweisbaren Veränderung des elektromagnetischen Feldes. Solange sich die Homöopathie dem messbaren Bereich entzieht, werden wir uns an der Heilung der Patienten orientieren. Kritik an der Homöopathie gab es seit Bestehen der Methode, und doch wird sie seit über 200 Jahren angewendet.
1.3.1 Die Potenzierung
Ausgegangen wird stets von einer Ursubstanz oder Urtinktur:
Bei pflanzlichen Stoffen wird ein Teil oder die ganze frische Pflanze in Weingeist oder Alkohol eingelegt und während mehrerer Wochen regelmäßig geschüttelt. Somit ist die Urtinktur ähnlich zur Ausgangssubstanz bei pflanzenheilkundlichen Therapien.
Tiere werden teils ganz, teils nur deren Absonderungen (z. B. das Bienengift bei Apisinum) verwendet.
Mineralien, chemische Elemente und deren Verbindungen werden feinsäuberlich pulverisiert und ebenfalls in Weingeist oder Alkohol eingelegt.
Menschliche und tierische Krankheitsprodukte werden Nosoden genannt. Diese werden vor der Verarbeitung sterilisiert.
Anschließend erfolgt die stufenweise Verdünnung und das Verschütteln flüssiger Substanzen bzw. Verreiben fester Ausgangsstoffe:
Beim Potenzierungsvorgang einer D-Potenz wird die Urtinktur im Verhältnis 1:10 mit einem Lösungsmittel 10-mal handverschüttelt. So ergibt sich eine D 1. Wird der Vorgang in gleichem Maße wiederholt, folgt eine D 2 usw.
In analoger Weise wird eine C 1-Potenz hergestellt: die Verdünnung der Urtinktur erfolgt im Verhältnis 1:100 und dann ein 10-maliges Verschütteln. Bis zu einer C 200 müssen also insgesamt 2000 Schüttelschläge durchgeführt werden.
Eine LM 1- oder Q 1-Potenz wird im Verhältnis 1:50 000 verdünnt und dann werden 100 Schüttelschläge durchgeführt.
Der Aufwand des Verschüttelns ist enorm für die Apotheken, deswegen werden die meisten Arzneien bis zu einer C 200 handverschüttelt, ab dann mittels Schüttelmaschine.
Stark giftige Substanzen, z. B. Pflanzen wie Aconitum napellus, Belladonna, Stramonium oder Chemikalien wie Arsenicum album oder Mercurius dürfen nicht unter einer D 12 bzw. C 6 verordnet werden, da sie noch potenziell toxisch wirken könnten.
1.3.2 Die Auswahl der Potenz
Diese Frage wird seit Langem und oft kontrovers diskutiert. Die Anwendung hängt sehr vom Erfahrungsschatz jedes einzelnen Homöopathen ab und deswegen werden dazu die unterschiedlichsten Empfehlungen abgegeben.
Grob kann gesagt werden, dass die sog. Niedrigpotenzen(D 6 bis D 8, C 3 bis C 6), in denen teils noch Moleküle der Urtinktur enthalten sind, vor allem für akute Erkrankungen verwendet werden. Sie wirken rasch, meist nur wenige Stunden, nicht sehr tief und kaum im psychischen Bereich.
Mittlere Potenzen(D 12 bis D 15, C 6 bis C 15) haben eine deutliche Wirkung bei akuten Erkrankungen, die Wirkdauer beträgt bis zu wenigen Tagen.
Die Hochpotenzen(ab C 30 aufwärts und alle LM- oder Q- Potenzen) werden bevorzugt bei sehr sicheren Verordnungen im körperlichen Bereich bzw. nach Konstitutionsanamnesen im psychischen und/oder körperlichen Bereich verordnet. Die Dauer reicht von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten.
Merke
Klare Regeln zur Wahl der Potenz gibt es nicht, denn entscheidend für den Behandungserfolg wird letztendlich nicht die Potenz des Homöopathikums sein, sondern die Auswahl des Simillimums.
Es ist jedem homöopathischen Anfänger zu empfehlen, zunächst mit wenigen Potenzen Erfahrungen zu sammeln, um letztendlich seinen eigenen Stil zu entwickeln.
1.3.3 Die Art und Häufigkeit der Verabreichung
Die häufigste Verordnung von Homöopathika erfolgt in Form von Globuli bzw. Streukügelchen. Diese bestehen aus Saccharose und werden gleichmäßig durch eine Dilution befeuchtet und schonend getrocknet. Da es möglich wäre, dass die Dilution nicht alle Globuli gleichmäßig befeuchtet, wird meist empfohlen, bei einer Gabe 3 oder 5 Globuli desselben Arzneimittels einzunehmen. Vertraut man dem Hersteller vollkommen, so ist es durchaus möglich, auch nur 1 oder 2 Globuli zu verordnen.
Die zweithäufigste Verordnungsweise ist die Gabe einer Dilution, also einer alkoholischen Lösung. Gebräuchlich ist diese Applikationsart vor allem im LM- bzw. Q-Potenz-Bereich, da sich dadurch eine sehr schonende Therapieeinleitung durchführen lässt und Erstreaktionen bzw. Erstverschlimmerungen nur selten auftreten. Nachteilig wäre der Alkoholgehalt vor allem für kleine Kinder, was sich umgehen lässt durch „Verkleppern“. Dazu wird ein Tropfen der Dilution in 100 ml Wasser gegeben und anschließend mit einem Plastiklöffel verrührt. Von dieser Lösung wiederum erhält der Patient einen Schluck oder einen Teelöffel voll.
„Verkleppern“ ist auch eine Art der Potenzierung, die der Patient selbst zu Hause durchführen kann. Dies kann auch mit Globuli erfolgen, die auf dieselbe Weise in Wasser aufgelöst und eingenommen werden.
Die Häufigkeit und Art der Anwendung einer Arznei hängt von verschiedenen Faktoren ab, und zwar von
der Art bzw. Schwere der Erkrankung: Je akuter die Krankheit ist, umso eher wird die Mittelgabe wiederholt bzw. sogar intensiviert durch „Verkleppern“ der Arznei. Eine chronische Erkrankung dagegen erfordert oft das geduldige Abwarten der Reaktion ohne frühzeitige Mittelwiederholung.
der Wahl der Arznei: Es gibt sog. hochreaktive Arzneien, die sehr schnell ansprechen und deren Wirkung oft nur kurz anhalten. Bei einem akuten hochfieberhaften Infekt, der Belladonna benötigt, wird eine C 30-Gabe, die über 3 Stunden zu einer Fiebersenkung führte, im Fieberanstieg wiederholt oder es wird sogar zum „Verkleppern“ geraten.
der Reaktionsfähigkeit des Patienten: Handelt es sich um einen reaktionsarmen Patienten, der schwer krank ist, wäre eine wiederholte Gabe einer C 200-Arznei sehr erschöpfend für den Patienten und deswegen nicht ratsam.
die Sicherheit der Verschreibung: Erfolgte eine ausführliche Anamnese mit wahrscheinlicher Wahl des Simillimums, so wird meist zu einer einmaligen Gabe einer C 30 oder C 200 geraten. Tritt eine gute Arzneiwirkung ein, so rät man zum Wiederholen des Mittels, falls sich eine leichte, aber erkenntliche Verschlechterung des krankhaften Zustandes (meist erst nach Wochen bis Monaten) ergibt.
der Höhe der Potenz: Die Gabe einer D 6/12 bei einer Akuterkrankung wird wesentlich schneller wiederholt, im Akutfall auch mehrmals täglich, während eine C 200 seltener, evtl. erst nach 6–8 Wochen wiederholt wird, falls es überhaupt einer Wiederholung bedarf.
Grundsätzlich gilt, dass auf jede Gabe abgewartet werden sollte:
Tritt eine Besserung ein, so wird das Mittel erst wiederholt bei wieder eintretender Verschlechterung.
Stellt sich keine rasche Verbesserung auf eine hochakute Erkrankung ein, so sollte die Mittelgabe einmalig wiederholt oder die Frage gestellt werden, ob die Mittelwahl zutreffend ist.
Bei einer chronischen Erkrankung, die bereits über Jahre anhält, wird zum Abwarten der Wirkung über mindestens 6 Wochen geraten.
1.4 Was ist ein Arzneimittelbild?
Das Arzneimittelbild ist die Gesamtheit aller Symptome, die das Mittel beim Gesunden (durch Vergiftung und Prüfung) hervorrufen und beim Kranken heilen kann. (Aus Weiterbildung Homöopathie, Band A▶ [3])
Um dem Simile-Prinzip zu entsprechen, werden in der Homöopathie Arzneien und deren Symptome untersucht, die sie beim Gesunden hervorrufen können. Dazu werden sog. Arzneimittelprüfungen an gesunden Probanden durchgeführt. Oftmals sind dies Therapeuten, die sich in Ausbildung zum Homöopathen befinden. Als Voraussetzungen einer Arzneimittelprüfung (AMP) gelten:
Die Ausgangssubstanz muss genau bekannt und rein sein.
Die Probanden müssen gesund, d. h. frei von Krankheitssymptomen sein und dürfen sich keiner Therapie unterziehen.
Die Probanden müssen sich während der AMP zuverlässig beobachten und einen geregelten Lebensablauf haben.
Die Prüfsubstanz ist nur dem Prüfungsleiter bekannt.
Der Prüfungsleiter sollte die Probanden möglichst täglich nach deren Symptomen fragen oder diese sollten ihre Symptome schriftlich aufzeichnen.
Aus den Ergebnissen der Probanden, den sog. Prüfsymptomen, aus toxikologischen Experimenten und aus klinischen Fällen, in denen die Heilung von Patienten dokumentiert wurde, ergibt sich dann das jeweils typische Arzneimittelbild.
Eine Sammlung homöopathischer Arzneimittelbilder nennt sich Materia medica. Die erste Materia medica stammte von Hahnemann selbst, das 1811 erschienene Buch Reine Arzneimittellehre. Dabei werden bereits über 300 von ihm selbst geprüfte Arzneien ausführlich beschrieben. Weitere bekannte Materiae medicae stammen von Allen, Boericke, Clarke, Hering, Kent, Mezger, Phatak oder Vermeulen.
Für den klinischen Akutfall in der Praxis sind die Materiae medicae oftmals zu ausführlich und unhandlich, weswegen es seit Langem das Bestreben gibt, sogenannte Leitsymptome oder Essenzen der einzelnen Arzneien zu erfassen. Dabei sollen die wesentlichen Kriterien eines Heilmittels herausgearbeitet, die unwesentlichen, für das Mittel wenig charakteristischen Symptome also wegelassen werden. Im Bereich der Kinderheilkunde setzte diese Idee als erstes Douglas Borland um, gefolgt von Frans Vermeulen mit seinem Buch Kindertypen in der Homöopathie▶ [46]. Auch wir haben versucht, in den folgenden Kapiteln dieses Buches nur die für Kinder und Jugendliche wesentlichen Symptome und Essenzen herauszufiltern und darzustellen.
1.5 Die homöopathische Fallaufnahme
Die homöopathische Anamnese bei einer chronischen Erkrankung unterscheidet sich deutlich von der Anamnese eines schulmedizinisch behandelten Patienten. Der zu Behandelnde wird in seiner Ganzheit betrachtet, es interessieren nicht nur die Krankheitssymptome an und für sich, sondern auch deren Einflussfaktoren (die sog. Modalitäten), die vermutete Ursache und eventuelle Begleitumstände. Außerdem werden die Lebensumstände, die Vorlieben und Abneigungen, der Gemütszustand, die Ängste und Träume, bisherige Erkrankungen etc. erfragt.
1.5.1 Die Technik der Anamneseerhebung
Die genaue Beschreibung, wie die Anamnese durchzuführen ist, haben wir Hahnemann zu verdanken, der im Organon in den §§ 83–104 sehr detailliert auf dieses Thema eingeht.
Es wird die Unbefangenheit des Therapeuten gefordert, gesunde Sinne, Aufmerksamkeit im Beobachten und das genaue Aufzeichnen des Spontanberichts in den Worten des Patienten.
Natürlich ist es essenziell, dass diese Technik von erfahrenen Homöopathen erlernt wird, am besten während der Weiterbildungsphase mittels selbst durchgeführter und supervidierter Fallaufnahmen.
Den ersten Teil der Anamnese bildet der Spontanbericht des Patienten, in dem dieser von seinem Hauptanliegen, seinen Krankheitssymptomen und seinen Wünschen nach Veränderung berichten soll, ohne dass ihn der Therapeut unterbricht. Der Therapeut zeichnet die Worte lediglich auf und versucht den Patienten zu ermuntern, so detailliert wie nötig weiterzuerzählen.
Es ist die Aufgabe des Behandlers, nicht nur die Worte wahrheitsgetreu zu notieren, sondern auch die nonverbale Kommunikation mit all seinen Sinnen zu erfassen. Beispiele hierzu sind in Kapitel ▶ 1.5.2 („Besonderheiten im Kindesalter“) zu finden.
Im zweiten Teil der Anamnese, dem gelenkten Bericht, werden gezielte Nachfragen gestellt, um das zuvor Gesagte zu präzisieren. Dabei wird Wert gelegt auf das Erfassen von Modalitäten (z. B.: Wann und wo traten die Schmerzen auf, wodurch wurden sie gebessert oder verschlechtert? Trinkt das Kind besser oder schlechter während einer akuten Fieberphase? Gibt es eine Tageszeit, in der sich der Zustand verschlechtert oder bessert?). Jeder Zustand sollte so genau wie möglich beschrieben werden. Dazu ist es notwendig, offene und keine Suggestivfragen zu stellen.
Anschließend folgen die allgemeinen Fragen: Es wird das gesamte Organsystem und seine Funktionen von oben bis unten abgefragt, es kommt zur Anwendung des sog. Kopf-zu-Fuß-Schemas.
Die weiteren zu eruierenden Punkte sind:
Gemütsveränderungen, typische Charaktereigenschaften, Verhalten
Ernährungsgewohnheiten, Vorlieben und Abneigungen
Schwangerschafts- und Geburtsverlauf
Bisheriger Entwicklungsverlauf
Allergien, Unverträglichkeiten, bisherige Infektionskrankheiten
Impfungen und evtl. Nebenwirkungen
Reaktionen auf Trost, Spott, Kritik
Schlafverhalten, Schlafwandeln, Zähneknirschen, Schlaflage
Träume
Ängste, Sorgen und Kummer
Reaktionen auf äußere Einflüsse wie Wind, Sonne, Hitze, Kälte, Baden
Emotionale Reaktionen auf Musik, Tanz; Mitgefühl, Tierliebe
Familienanamnese
Den Schwerpunkt der Anamnese wird der Homöopath stets individuell legen, je nach Krankheitssymptomen und angepasst an die Antworten des Patienten oder der Eltern. Der zeitliche Aufwand der Anamnese ist ebenfalls individuell, beträgt aber bereits im Säuglingsalter in aller Regel eine Stunde und mehr.
Der vierte Teil der Fallaufnahme ist schließlich die körperliche Untersuchung, die nach allen Regeln der medizinischen Kunst durchgeführt wird.
1.5.2 Besonderheiten im Kindesalter
Kinderärzte sind es gewöhnt, dass stets ein Kind von einer erwachsenen Person begleitet wird, in den meisten Fällen von der Mutter. Somit haben wir es auch bei den homöopathischen Anamnesen meist mit mindestens zwei Personen zu tun. Je kleiner das Kind ist, umso mehr müssen wir verbal von den Eltern erfahren, wobei zu berücksichtigen ist, dass sich der Inhalt durchaus unterscheiden kann, wenn wir Vater und Mutter nach demselben Sachverhalt befragen. Um dies zu interpretieren, braucht es Erfahrung, Fingerspitzengefühl und Kenntnis der Familienstruktur des Kindes.
Bei der Anamnese ist das Alter des Kindes zu berücksichtigen:
Im Säuglings- und Kleinkindalter wird meist die Bezugsperson berichten und dadurch können wir keine subjektiv geschilderten Symptome erhalten.
Im Kleinkindalter sind beispielsweise noch keine verlässlichen Schmerz- oder Modalitätsangaben vom Kind zu erhalten. Einfache Fragen, z. B. nach Essensvorlieben, können aber oft bereits beantwortet werden.
Ab dem Alter von 5–8 Jahren kann, je nach Entwicklungsstand des Kindes, bereits nach Modalitäten gefragt werden, Schmerzangaben sind durchaus verlässlich.
Im frühen Schulalter äußern die Kinder Symptome evtl. nicht vollständig oder unwahr, um in den Augen der Eltern gut dazustehen.
Ab dem Alter von 8 Jahren kann ein großer Teil der Anamnese mit dem Kind durchgeführt werden. Dabei sollte beachtet werden, dass die Kinder nicht unbedingt wahrheitsgetreu antworten in Anwesenheit der Eltern, vor allem, wenn es sich um Fragen handelt, die eine Erziehungskonsequenz nach sich ziehen könnten (z. B. Lügen, Stehlen, Zündeln, Onanieren).
Jugendliche distanzieren sich oftmals von ihren eigenen Gefühlen, um „cool“ zu wirken, oder sie sind durch Hormonschwankungen während der Pubertät sehr stimmungslabil (ohne dass dies gleich für Pulsatilla sprechen würde). Ob die Anamnese allein oder in Anwesenheit eines Elternteiles erfolgt, sollte von den Jugendlichen selbst entschieden werden dürfen. Bei der Erfragung der Sexualanamnese sollten die Eltern stets abwesend sein.
Individuell zu entscheiden ist, ob das Kind während der gesamten Anamnese anwesend ist. Bis ins Kleinkindalter wird sich die Frage noch nicht stellen, aber danach kommt es natürlich auf den Inhalt des Gesprochenen an, ob es Aussagen der Eltern gibt, die verletzend oder belastend für das Kind wären.
Sehr wichtig ist im gesamten Kindesalter das Erfassen der nonverbalen Kommunikation, da uns viele andere subjektiv geschilderte Informationen fehlen. Deswegen muss das Kind stets, zumindest am Beginn der Anamnese, anwesend sein und aufmerksam beobachtet werden. Dazu benötigen wir all unsere Sinne ab Beginn der Anamnese. Dies beginnt im Wartezimmer mit Beobachtung der Haltung des Kindes, dem Gangbild, der Aufgeschlossenheit gegenüber dem Therapeuten bei der Begrüßung, der Stimmungslage und dem evtl. Handschlag.
Visuell können wir unter anderem die Mimik, die Augenfarbe und -stellung, die Haut bezüglich Turgor, Tonus und Reinheit, die Haarfarbe und den Haarwuchs, die Kleidung, die Haltung und die Gestik beurteilen.
Akustisch sollten wir die Stimme, deren Tonfall, die Art des evtl. Schreiens, emotionale Ausdrücke wie Juchzen, Nörgeln, Meckern etc. beachten.
Olfaktorisch lässt sich der Geruch der Ausscheidungen, des Schweißes, evtl. des Stuhlgangs, des Urins beurteilen.
Während der Anamnese hat es sich bewährt, insbesondere bei zurückhaltenden Kindern, diese immer wieder anzusprechen, mit ihnen nonverbal in Kontakt zu treten, evtl. ein Spielzeug oder Malsachen anzubieten. Ansonsten kann das Kind rasch unruhig werden, wodurch das Gespräch nur verlängert und unproduktiv wird.
Teil II Arzneimittelbilder
2 Polychreste
3 Kleinere Arzneien
2 Polychreste
2.1 Die großen Arzneien
Zuerst werden die in der Kinder- und Jugendheilkunde am häufigsten verwendeten Arzneien beschrieben, die auch oft als Konstitutionsmittel Anwendung finden. Ein dafür häufig verwendeter Begriff ist auch "Polychrest" (aus dem Griechischen für "viel" oder "zahlreich").
Eine erfolgreiche Verschreibung beruht auf ärztlicher Intuition. Dabei geht es nicht nur um das Wissen der detaillierten Fakten eines Krankheitskomplexes.
Dieses Kapitel widmet sich der Charakteristik wichtiger Arzneimittel im Kindes- und Jugendalter. Dabei geht es hier nicht um eine vollständige Beschreibung des Arzneimittelbildes. Vielmehr wird auf die eigentümlichen Besonderheiten des jeweiligen Heilmittels Wert gelegt, wie sie in der Praxis am schnellsten über die sogenannten Leitsymptome festgestellt werden können.
Für eine erfolgreiche Verschreibung ist es wichtig, ein „Gefühl“ für das jeweilige Arzneimittel zu haben. Dafür ist es notwendig, die Herkunft und das „Wesen“ des Ausgangsstoffes zu kennen. Homöopathen finden darüber hinaus immer wieder Analogien zwischen dem arzneilichen Wesen der Ausgangssubstanz und dem Symptomenbild, respektive der Krankheitserscheinung bei ihren Patienten. Dies entspricht dem ganzheitlichen Denken und der Erfahrung der vielschichtigen Wirkungsweise arzneilicher Substanzen. Darüber hinaus hat es sich als sinnvolles didaktisches Werkzeug erwiesen. Durch die assoziative Verknüpfung bekommt die Homöopathie einen leichten, spielerischen Charakter, die differenzierten Wesensmerkmale der unterschiedlichen Arzneien bekommen ein einprägsames Bild und der Vorgang des rationalen Lernens wird bereichert durch eine Vorstellung der Komplexität des Wirkstoffes.
2.2 Aconitum napellus
Abb. 2.1 Aconitum napellus.
2.2.1 Herkunft/Toxikologie
Gebirgspflanze aus der Familie der Ranunculaceae (Hahnenfußgewächse), die in Mittel- und Südeuropa in einer Höhe von 1000 bis 3000 m heimisch ist (▶ Abb. 2.1). Die Pflanze kann die stattliche Höhe von 1,50 m erreichen; ihre Wurzel enthält Aconitin, das von alters her als das stärkste Pflanzengift im europäischen Raum bekannt ist. Bereits 2–4 g der frischen Wurzelknolle gelten als tödliche Dosis für den Menschen. Verwendet wird die gesamte Pflanze einschließlich der Wurzel.
2.2.2 Arzneiwesen/Essenz
Ihrer imposanten helmartigen blau-violetten Blütenkappe verdankt die Pflanze die Beinamen Eisenhut und Sturmhut. In der Mythologie und dem Volksmund findet man weitere zahlreiche Assoziationen der Gebirgspflanze mit Krieg, Todesgefahr und ritterlichem Kampf. Aconitum napellus erlangt ihre Kraft auf den saftigen Gebirgswiesen, in sonnenverwöhnten Hanglagen. Somit kann sie der Urgewalt in diesen lebensfeindlichen Regionen, wie schlagartig aufziehenden Schlechtwetterfronten oder heftig brausenden Winterstürmen, ohne besonderen Schutz widerstehen.
2.2.3 Leitsymptome
2.2.3.1 Gemüt/Verhaltensmerkmale
Es sind kraftstrotzende, plethorische Kinder, die urplötzlich heftige Krankheitssymptome oder eine gewaltsame Verletzung erleiden. Die schlagartige Wucht des Geschehens prägt das Erlebnis des bedrohlichen Schreckens, bis hin zur Todesfurcht nachhaltig ein. In der Krankheit oder in deren Folgezeit sind die Kinder ängstlich beunruhigt und hochgradig erregt. Aconitum-Krankheitszustände sind hochakut und von unerträglicher Heftigkeit.
2.2.3.2 Allgemeinbefinden/Modalitäten
Plötzliche intensive Bedrohung. Akutes Schockmittel, auch bei psychischen Folgezuständen nach einem traumatischen Erleben.
Auslöser: abrupte Wetterwechsel, besonders kalte, trockene (Ost-)Winde, aber auch große Hitze.
Beschwerden sind plötzlich, heftig und schmerzhaft.
Extreme Angst und Ruhelosigkeit. Panikzustände, Todesangst.
Ruhe/Beruhigung bessert.
Verschlimmerung nachts (Mitternacht). Schlaflosigkeit mit Unruhe durch Angstträume, Hitze.
Plötzliches Herzklopfen, rasender Puls, rotes gestautes Gesicht – im Wechsel mit Blässe.
Verschlimmerung durch Hitze, im stickigen Raum – Besserung durch Kälte, frische Luft.
Durst auf kaltes Wasser.
Bedeutendes Erstmittel bei grippalen Infekten, mit schlagartigem Beginn, heftigem Verlauf und der typischen Schreiunruhe.
Schock, Übererregbarkeit nach traumatischer Geburt.
2.2.3.3 Kopf
Rotes Gesicht, beim Aufsitzen jedoch blass (DD: Bell.).
Pulsierende, brennende Kopfschmerzen, Hitzegefühl.
Folge von Sonnenstich oder Kälteeinwirkung.
Hirnblutung des Neugeborenen.
2.2.3.4 HNO
Wichtiges Erstmittel bei akuten Infektionen der Hals-, Nasen-, Ohrenregion.
Die Beschwerden treten plötzlich auf, haben heftigen Charakter und werden von ängstlicher Unruhe begleitet.
2.2.3.5 Atemwege
Erstmittel bei plötzlich einsetzendem Infektkrupp mit Unruhe, Angst unter Atemnot.
Folge eines abrupten Witterungswechsels, insbesondere bei kaltem Ostwind.
Heftige, raue, schmerzende Hustenanfälle.
Verschlimmerung in den Mitternachtsstunden.
Anfangsmittel bei Pneumonie mit o. g. Leitsymptomen.
2.3 Apis mellifica
Abb. 2.2 Apis mellifica.
2.3.1 Herkunft/Toxikologie
Es wird der komplette Körper der Honigbiene, samt Stachel und gefüllter Giftblase verwendet. Zur Herstellung des Mittels dient eine Arbeiterin aus dem Bienenstock. Ihr Gift hat zellgewebsschädigende, hämolytische und neurotoxische Wirkung. Der Wirkeintritt geschieht abrupt, innerhalb weniger Minuten.
2.3.2 Arzneiwesen/Essenz
Das Wesen der Arbeitsbienen besticht durch ihren hohen Organisationsgrad und den sprichwörtlichen Fleiß, in Dienstbarkeit für das gesamte Volk. Ihr Leben ist streng geordnet und hierarchisiert. Zu Beginn steht die Tätigkeit als Fütterbiene, anschließend beteiligt sie sich am Bau und Erhalt des Bienenstocks, verbringt eine kurze Zeit als Wachbiene, um den Rest ihres Lebens zur Nektarbeschaffung auszuschwärmen (▶ Abb. 2.2). Ihren Giftstachel gebraucht sie zur Selbstverteidigung und der Verteidigung des Bienenstocks.
2.3.3 Leitsymptome
2.3.3.1 Gemüt/Verhaltensmerkmale
Die Kinder imponieren durch eine vitale Aktivität, die in ihrem Verlangen nach Bewegung bis hin zur Ruhelosigkeit zum Ausdruck kommt. Sie sind fleißig und haben einen ausgeprägten Familiensinn. Doch gibt es auch Phasen überschießender Geschäftigkeit (Hyperaktivität), es kommt zu Ungeschicklichkeiten und einem Mangel an Konzentrationsfähigkeit.
Im Allgemeinen besitzen sie ein ausgeglichenes Gemüt, sie sind geradlinig, selten in Rage, bedingt durch ein plötzlich aufkommendes Gefühl von Bedrohung oder Eifersucht.
2.3.3.2 Allgemeinbefinden/Modalitäten
Leitsymptomatik (wie bei einem Bienenstich):
stechender, brennender Schmerz
hochgradige, blassrot-ödematöse Schwellung
Röte
Arbeitseifer, Bewegungsdrang, (Hyper-)Aktivität, Ruhelosigkeit, Manie.
Besserung durch Bewegung / durch körperliche Betätigung.
Ruheloser Schlaf, den Kopf in das Kissen gebohrt, Schreianfälle, Ängste nachts.
Im Fieber: glühend heiße trockene Haut, berührungsempfindlich, exzitiert, durstlos.
Durstlosigkeit.
Meist „warmblütig“: Besserung durch Kälte, Verschlimmerung durch Hitze.
Schlechter durch Druck/Berührung.
Rechtsseitig betonte oder rechts beginnende Beschwerden.
2.3.3.3 Kopf/Augen
Ausgedehnte Schwellung der Augenlider, Augenöffnung nicht mehr möglich.
Gesichtsödem (z. B. Quincke-Ödem).
Hochgradige Kopfschmerzen: Gehirn ist wie geschwollen. Kopfbohren und schrilles Schreien bei Meningitis mit Hirnödem. → Delirium → Koma.
Hauptmittel bei Hydrozephalus.
2.3.3.4 HNO
Reizender, wund machender Fließschnupfen, der Naseneingang ist bis zur Oberlippe hinab gerötet.
Pharyngitis mit feuerrotem Rachenring, brennenden/stechenden Schmerzen und glasig geschwollenem Zäpfchen. Scharlach.
Otitis media mit stechenden Schmerzen.
Durstlosigkeit. Kalte Getränke bessern.
2.3.3.5 Atemwege
Glottisödem mit hochgradigem Erstickungsgefühl (Krupp-Syndrom).
Pleuritis/Pleuraerguss mit stechenden Thoraxschmerzen.
2.3.3.6 Urogenitalorgane
Nephritis / nephrotisches Syndrom mit generalisiertem Ödem und spärlicher Urinausscheidung.
Ovarialzyste (insbes. rechtsseitig).
Balanitis mit ausgeprägter ödematöser Vorhautschwellung.
2.3.3.7 Bewegungsapparat
Motorische Ungeschicklichkeit, Zappeligkeit, unbeholfene Koordination.
Arthritis mit Rötung/Schwellung.
2.3.3.8 Haut
Nesselsucht (Urtikaria) mit brennenden Schmerzen; prall gefüllte ödematöse Schwellung der Haut; Erysipel, Herpes zoster. Die Hauterscheinungen werden durch kalte Umschläge gelindert.
Bienenstiche, Insektenstiche, anaphylaktischer Schock. Masern.
2.4 Arsenicum album
Abb. 2.3 Arsenicum album.
2.4.1 Herkunft/Toxikologie
Das hochgiftige Arsentrioxid (As2O3), auch weißes Arsenik (▶ Abb. 2.3). genannt, kommt in der Natur in verschiedenen Mineralien und Erzen, aber auch in organischen Verbindungen, insbesondere in Fischen und Meeresfrüchten vor. Eine Arsenvergiftung löst anfangs Magenschmerzen, Diarrhöe und Schlaflosigkeit aus.
2.4.2 Arzneiwesen/Essenz
Entsprechend seiner Toxizität ist Arsenicum album eine tiefgreifende, destruktive Arznei. Ihre Hauptcharakteristika sind die archaisch verankerten Ängste, die Ruhelosigkeit, ein erheblicher Kräfteverfall in der Krankheit, ein Verlangen nach großer Wärme. Die Schmerzen sind von brennendem Charakter.
2.4.3 Leitsymptome
2.4.3.1 Gemüt/Verhaltensmerkmale
Die Kinder sind schlank, besitzen eine empfindliche Haut und feine Haare und sind auch emotional zart besaitet. Die Basis ihres Verhaltens ist eine tief sitzende Angst und Unsicherheit. Diese wird erst im Verlauf von Krankheiten offensichtlich. Meist gelingt es den Kindern von klein auf, ihre Unsicherheit erfolgreich zu kompensieren. Sie finden ihre Stabilität durch ein emotionales Sicherheitsnetz im Familien- und Freundeskreis. Sie erweisen sich als sehr ordentlich, reinlich, tüchtig und verlässlich, wodurch sie die beruhigende Anerkennung ihrer Umgebung gewinnen. Auch in der Schule bestechen sie durch Fleiß und geradezu pedantische Sorgfalt bei den Hausaufgaben. Doch obschon sie in der Regel gut vorbereitet sind, fühlen sie sich immer wieder durch nicht bezwingbare Prüfungsängste gehandicapt. Stabilität erlangen sie auch durch Festhalten an materiellen Errungenschaften, sie teilen ihre Spielsachen äußerst ungern. An eingespielten Rhythmen, wie dem gewohnten Tagesablauf, halten sie geradezu zwanghaft fest.
2.4.3.2 Allgemeinbefinden/Modalitäten
Arsenicum-album-Kinder sind kühl und frostig und haben ein Verlangen nach Hitze oder intensiver Wärme.
Obwohl die Schmerzen in der Regel brennen, bessern sie sich durch lokale Anwendung von Wärme (wärmende Umschläge, Getränke).
Es besteht großer Durst, sie trinken typischerweise in häufigen, kleinen Schlucken.
Eine ängstliche innere und äußere Ruhelosigkeit treibt die Kinder nachts aus dem Bett.
Die Krankheitsbeschwerden haben ihren Höhepunkt in den Mitternachts- und frühen Morgenstunden (0.00 bis 3.00 Uhr).
Sie neigen dazu, in periodischen Abständen wieder aufzutreten.
Die Körpersekrete sind in der Krankheit scharf und wund machend, häufig auch übel riechend.
Krankheiten haben einen ernsten, tiefgreifenden Charakter: Sie führen zu hochgradiger Schwäche und Kaltschweißigkeit.
2.4.3.3 Kopf
Kopfschmerzen mit heißem Kopf bei ansonsten kühlem Körper.
Kopfschmerzen werden als intensiv und brennend empfunden.
Unangenehmer nächtlicher Juckreiz der Kopfhaut.
Besserung akuter Kopfschmerzen durch kalte Anwendungen und kühle, frische Luft, während chronische Kopfschmerzen nach Wärme verlangen.
2.4.3.4 HNO
Es besteht ein dünner, beißender Fließschnupfen, der eine wunde, gerötete Nase und Niesreiz erzeugt.
Die Nasenschleimhäute brennen und können bluten.
Selbst die Tränenflüssigkeit ist scharf, die Lidränder brennen und schwellen im Krankheitsverlauf an.
2.4.3.5 Atemwege
Plötzliche nächtliche Erstickungsanfälle (0.00 bis 3.00 Uhr), im Rahmen eines Asthma bronchiale, typischerweise ausgelöst durch kalte Luft oder nasskaltes Wetter.
Beeindruckend ist die hochgradige Atemnot, einhergehend mit einer extremen Unruhe bis hin zu panischer Angst. Die Kinder müssen sich aufsetzen, wollen aus ihrem Bett heraus, auf den Schoß eines Elternteils.
Bei fortgeschrittenem Krankheitsverlauf kommt es zur völligen Erschöpfung.
2.4.3.6 Magen-Darm-Trakt
Brennender Schmerz in Speiseröhre oder Magen (Gastritis).
Zu Beginn einer Gastroenteritis/Nahrungsmittelvergiftung besteht ein unstillbarer Brechreiz, derweil werden in kurzen Abständen kleine Portionen aus dem Magen hervorgewürgt.
Auch der Durchfall ergießt sich in häufigen kleinen Mengen.
Die Absonderungen sind brennend-scharf und von üblem Geruch.
Es besteht Verlangen nach Wasser, in häufigen kleinen Schlucken.
Warme Getränke bessern.
2.4.3.7 Urogenitalorgane
Im Rahmen von Harnwegsinfektionen häufiger, oft unkontrollierbarer permanenter Harndrang in kleinen Portionen, dabei quälender Brennschmerz.
2.4.3.8 Extremitäten
Wichtige Arznei bei Raynaud-Syndrom.
2.4.3.9 Haut
Die Haut ist empfindlich, generell trocken, rau, phasenweise mit reichlicher Schuppenbildung.
Es kann ein erheblicher Juckreiz bestehen, besonders nachts, oder auch brennende, wund machende Ekzeme.
Scharfe, übel riechende Wundsekretion, oder die Kinder kratzen sich blutig.
2.5 Belladonna
Abb. 2.4 Belladonna.
2.5.1 Herkunft
Die Tollkirsche, Belladonna (▶ Abb. 2.4), zählt zu den Nachtschattengewächsen (Solanaceae). Sie ist in großen Teilen Europas in der halbschattigen Umgebung von Laubwäldern zu finden. Hauptinhaltsstoff ist das Hyoscyamin, das sich zu Atropin umwandelt, sowie Scopolamin. Bereits fünf Beeren können tödlich wirken. Verwendet werden sämtliche Pflanzenteile mit Ausnahme der Wurzel.
2.5.2 Arzneiwesen/Essenz
Die homöopathische Essenz von Belladonna ist ein Spiegelbild ihrer toxikologischen Wirkung. Bei einer Belladonna-Vergiftung sind zunächst das periphere Nervensystem, der Parasympathikus, das Herz-Kreislauf-System und im weiteren Verlauf das zentrale Nervensystem beeinträchtigt. Der Patient empfindet eine heftig brennende Hitze, Herzklopfen, pulsierende Kopfschmerzen als Ausdruck der Blutkongestion im Hals- und Kopfbereich. Die zentralnervöse Wirkung zeigt sich durch Krämpfe, furchterregende Halluzinationen und Delirien mit wilder Raserei.
Die Kinder haben wie das Nachtschattengewächs Belladonna ein besonderes Verhältnis zum Licht. Während sich die nächtlichen Ängste durch das Licht vertreiben lassen, nehmen die Kopfschmerzen durch Licht an Intensität zu.
2.5.3 Leitsymptome
2.5.3.1 Gemüt/Verhaltensmerkmale
Belladonna-Kinder sind temperamentvoll, aktiv, ihre roten Wangen und ihr aufmerksam leuchtender Blick verleihen ihnen ein robustes, gesundes Aussehen. Sie spielen lebhaft und geraten dabei schnell ins Schwitzen. Typisch ist der schlagartige und heftige Wechsel ihrer Gemütsverfassung. Aus heiterem Himmel übermannt sie eine blindwütige Raserei, mit Schlagen, Beißen, Spucken, Treten, Haareziehen. „Ein Teufel, wenn krank und ein Engel, wenn gesund“ (Vermeulen ▶ [47]).
2.5.3.2 Allgemeinbefinden/Modalitäten
Plötzlicher, stürmischer Krankheitseintritt oder unvermittelter, explosionsartiger Stimmungswechsel.
Temperaturveränderungen (insbesondere des Kopfes) als Krankheitsauslöser: Unterkühlung, aber auch Überhitzung.
Neigt zu Fieberzuständen mit heißem rotem Kopf und kühlen Extremitäten.
Intensive brennende Hitze, Hitzewallungen. Blutandrang zu Kopf und Gesicht.
Schwitzen an bedeckten Körperteilen, reichlich, auch nachts.
Durstlosigkeit.
Hämmernde, pulsierende Schmerzen. Besserung durch Druck.
Neigt zu lebhaften, furchterregenden Halluzinationen, Delirien.
Neigung zu Muskelkonvulsionen wie Zuckungen, Rucken, Tics, Zittern, Fieberkrämpfe, Zähneknirschen, Stottern.
Übererregbarkeit, Zuckungen, muskulärer Hypertonus, Überstreckung des Neugeborenen.
Schreiunruhe, Dreimonatskolik des Säuglings bei Überstimulation.
Häufig:weite Pupillen (DD: Acon.), leuchtend glänzende Augen.
Verschlimmerungszeit nachmittags gegen 15.00 Uhr, nachts 23.00 Uhr.
Verschlimmerung durch Bewegung/Erschütterung.
Verschlimmerung durch Überreizung, wie zu viel Lärm, Licht, Sonne, Berührung.
Rechtsseitige Betonung der Beschwerden.
2.5.3.3 Kopf
Schlagartig beginnende, intensive, innerlich pochende oder pulsierende Kopfschmerzen. Migräne oder Stauungskopfschmerzen.
Liegen im ruhigen, abgedunkelten Zimmer und kühle Umschläge, mit festem Druck bandagiert, bessern.
Temperaturveränderungen des Kopfes sind typische Krankheitsauslöser.
2.5.3.4 HNO
Sehr schmerzhafte, rechtsseitig betonte Mittelohrentzündung, pulsierender Schmerz, schlimmer nachts. Dabei hochrotes, vorgewölbtes Trommelfell, Tragus berührungsempfindlich.
Hochakute Pharyngitis/Tonsillitis mit tiefroter Verfärbung. Scharlach.
Rechtsseitig betonte Nasennebenhöhlenentzündung, berührungsempfindlich, durch Vorwärtsbeugen verschlimmert.
2.5.3.5 Magen-Darm-Trakt
Bauchkrämpfe und Schmerzen mit dem typischen Belladonna-Bild.
Appendizitis.
2.5.3.6 Urogenitalorgane
Quälende Dysmenorrhöe.
Verstärkte Menstruationsblutung mit großen roten Blutklumpen.
2.5.3.7 Haut
Neigung zu leuchtend roten Exanthemen, im Rahmen von Infektionskrankheiten, wie Scharlach oder Masern.
Erysipel, Sonnenbrand, brennende Windeldermatitis.
2.6 Bryonia alba
Abb. 2.5 Bryonia alba.
2.6.1 Herkunft
Schnellwüchsige Kletterpflanze (▶ Abb. 2.5) aus der Familie der Cucurbitaceae (Kürbisse). Sie ist im gesamten europäischen Raum zu finden, wo sie an Hecken, Zäunen und Mauern bis zu 4 m emporrankt. Verwendet wird der frische Saft des Wurzelstockes.
2.6.2 Arzneiwesen/Essenz
Bryonia sucht einen festen Halt. Diesen findet die Pflanze zum einen in der massiven, kiloschweren, kürbisartigen Wurzel, zum anderen in einem ausgeklügelten Halteapparat ihrer Kletterranken. Ein feines Tastsystem ermittelt die Haltepunkte, an denen sich die Triebe spiralförmig nach oben ziehen. Dabei verändert der Spross mehrfach die Drehrichtung seiner Haltespirale.
Bryonia steht für rasches Wachstum und Entwicklung auf der Basis von festem Halt und Sicherheit. Die wechselhaft drehenden Wachstumstriebe symbolisieren die launenhafte Reizbarkeit des Bryonia-Kindes („weiß nicht, was es will“).
2.6.3 Leitsymptome
2.6.3.1 Gemüt/Verhaltensmerkmale
Praktisch orientierte, bodenständige Kinder. Sie sind sicherheitsorientiert, weshalb sie eine Vorliebe für materielle Werte entwickeln (Geiz) und auch ernsthaft um ihr schulisches Fortkommen bemüht sind (Ehrgeiz). Ihre Errungenschaften tragen sie jedoch nicht zur Schau, sie genießen ihre Ruhe und fühlen sich am wohlsten daheim.
2.6.3.2 Allgemeinbefinden/Modalitäten
Trockenheit der Schleimhäute. Großer Durst auf kalte Getränke.
Heftige, stechende Schmerzen. Verschlimmerung bereits bei kleinsten Bewegungen.
Besserung durch Ruhe (will in Ruhe gelassen werden, will nach Hause).
Reizbarkeit, Launenhaftigkeit, Sorgen hinsichtlich seiner Zukunft.
Besserung durch mäßigen Druck (auf die erkrankte Stelle).
Verschlimmerung durch Hitze, warme Räume; Besserung durch kühle frische Luft.Cave: Gelenkbeschwerden bessern sich durch warme Auflagen.
Grippale Infekte mit starken Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, trocken-belegter Zunge und großem Durst.
Viele Beschwerden rechtsseitig betont – Kopfschmerzen hingegen besonders linksseitig.
2.6.3.3 Kopf
Stechende Kopfschmerzen, verschlimmert durch kleinste Bewegungen/Augenbewegungen.
Meningitis.
2.6.3.4 HNO
Schmutzig belegte, trockene Zunge.
2.6.3.5 Atemwege
Bronchitis/Pleuritis/Pneumonie mit trockenem, hartem, sehr schmerzhaftem Husten und schmerzhaften Atemzügen.
Besserung durch Aufsetzen und an der frischen Luft.
2.6.3.6 Magen-Darm-Trakt
Großer Durst zwischen längeren Trinkpausen.
Chronische Verstopfungsneigung durch trockene Stühle.
Akute Magenschmerzen, Magen-Darm-Infektionen mit stechenden Koliken, Aufstoßen und Erbrechen.
Appendizitis, Peritonitis. Neugeborenen-Gelbsucht. Pylorusstenose.
Dreimonatskoliken mit meteoristischem Bauch, übel riechenden Gasen.
2.6.3.7 Bewegungsapparat
Arthritis/Rheumatismus/Verletzung mit heftig stechenden Schmerzen
Schlimmer bei geringsten Bewegungen/Erschütterungen. Besserung durch warme Anwendungen.
2.7 Calcium carbonicum
Abb. 2.6 Calcium carbonicum.
2.7.1 Herkunft
Die Ursubstanz wird nach Vorschrift Hahnemanns aus der schneeweißen mürben Mittelschicht einer zerbrochenen Austernschale gewonnen (▶ Abb. 2.6). Bei dem so gewonnenen Austernschalenkalk handelt es sich nicht um reines Calcium carbonicum (CaCO3), sondern um eine Verbindung von kohlensaurem Kalk mit anderen organischen Beimischungen wie Mangan und Phosphor. Somit ist Calcium carbonicum Hahnemanni ein typischer Vertreter der Idee, die dynamisierte homöopathische Arznei repräsentiere die geistartige Kraft der gesamten organischen Ausgangssubstanz.
2.7.2 Arzneiwesen/Essenz
Die Auster ist eine Molluske, die ihr feucht-weiches, teigiges Fleisch mit einer harten Schale schützend umhüllt. Hat sie den geeigneten felsig-festen Untergrund im Meer gefunden, klammert sie sich mit ganzer Kraft daran fest. Im Gegensatz zu anderen Mollusken verlässt sie ihre Behausung niemals. Zur Nahrungsaufnahme öffnet sich der schützende Muschelpanzer gerade mal einen winzigen Spalt. Es gehört zu den einmaligen Qualitäten der Auster, dass sie, stimuliert durch ein feines Körnchen Sand, in gemächlicher, aber beharrlicher Aufbauarbeit letzten Endes eine wunderbare, wertvolle Perle hervorbringen kann.
2.7.3 Leitsymptome
2.7.3.1 Gemüt/Verhaltensmerkmale
Calcium carbonicum gilt als der Prototyp der Säuglingsarznei. Das äußerlich feuchte, innerlich noch aufgeschwemmte Neugeborene verlässt die schützende Höhle des mütterlichen Beckens und begibt sich auf den Weg in einen neuen Lebensraum. Dort muss es eigene Strukturen entfalten und zunehmend auf sich selbst gestellt für Sicherheit und Wohlergehen sorgen (Aufbau der Schale und der Perle).
Calcium-carbonicum-Kinder behalten über die Säuglingszeit hinaus ihren perlmuttfarbenen, blässlichen Teint, ihre Körpergestalt bleibt buddhahaft rundlich, ihr Körpergewebe pastös und teigig.
Kennzeichnend ist die innere Zufriedenheit, sie scheinen vollkommen in sich zu ruhen. Gerade mal ihr Hungerbedürfnis kündigen sie der Mutter eher milde klagend an. Sie gelten als wohltuend pflegeleicht. Ihre Schwerfälligkeit zeigt sich früh anhand der verzögerten Gesamtentwicklung. Drehen, Sitzen, Stehen, Laufen erfolgen spät, Zahnung und Fontanellenschluss ebenfalls; aber auch die Lernbereitschaft in der Schule und die erste Partnerschaft lassen lange auf sich warten.
Versucht man das Entwicklungstempo auf das ihrer Altersgenossen hin zu trimmen, so reagieren sie unflexibel trotzig oder mit kompletter Verweigerung. Calcium-carbonicum-Kinder haben ein sicheres Gespür für ihre Bedürfnisse, sie besitzen eine solide Willenskraft, die auch in Eigensinn und Dickköpfigkeit umschlagen kann.
Sicherheit und Struktur sind bedeutsame Themen in der weiteren Entwicklung des Kindes. Neuer Umgebung und fremden Menschen nähern sie sich nur vorsichtig und sehr schüchtern. Bereits früh interessieren sie sich für Sinnfragen des Lebens, Religion oder Metaphysik, da ihre Gedanken gerne um Zukunftsthemen schweifen. Finden sie in den Jugendjahren „ihr Sandkörnchen“ (Freundschaft, Heirat, Hobby, Beruf), so werden sie sich entschlossen und beharrlich dieser Lebensbestimmung stellen und daraus eine vollkommene Perle entwickeln.
2.7.3.2 Allgemeinbefinden/Modalitäten
Teigig-rundliche, pastöse, buddhahaft anmutende Kinder mit blässlichem Hautkolorit.
Seltener: magerer Typus mit faltiger, „welker“ Haut.
Schlaffe Muskulatur und Körperhaltung mit hervorquellendem Bauch (Froschbauch).
Gemächliche, verzögerte Entwicklung, späte Zahnung, spätes Sitzen, Stehen, Gehen.
Im Schulalter: zunächst kindisch, unreif; später zielstrebig und systematisch, bei langsamem Arbeitstempo.
Abneigung gegen Anstrengung. Körperliche und geistige Erschöpfbarkeit. Neigung zu Überarbeitung, Überanstrengung, Überforderung (Schule, Beruf, Sport).
Behäbigkeit: neigen zur Unpünktlichkeit, „weil sie es nicht rechtzeitig schaffen“.
Willensstärke: verantwortungsbewusst, solide und pragmatisch, aber auch unflexibel, eigensinnig.
Unabhängig: spielt zufrieden mit sich selbst, auch später unabhängig im Arbeitsleben.
Angst um die Sicherheit / die Zukunft (Gesundheit, Berufskarriere, Rente).
Ausgeprägte Schweißneigung schon bei geringster Anstrengung, säuerlicher Geruch; Nachtschweiß im Kopf-Nacken-Bereich.
Neigung zum Fettansatz, Adipositas.
Infektanfälligkeit: Dauerrotznase im Kleinkindesalter.
Sehr kälte- und nässeempfindlich. Alles verschlimmert sich durch Kälte.
2.7.3.3 Kopf
Großer, runder Kopf.
Nachtschweiß besonders im Hinterhaupts-, Nackenbereich.
Später Fontanellenschluss.
2.7.3.4 HNO
Im gesamten Kindesalter ausgeprägte Infektanfälligkeit: Dauerrotznase im Krabbel- und Vorschulalter. Neigung zu wiederkehrenden Mittelohrentzündungen. Chronischer Paukenerguss.
Lymphatismus: rezidivierend geschwollene Lymphknoten, hypertrophe Tonsillen und Adenoide.
Permanente Mundatmung.
2.7.3.5 Magen-Darm-Trakt
Verlangen nach weich gekochten Eiern und Süßigkeiten. Unverträglichkeit oder Ablehnung von Kuhmilch. Säuglingsspucken.
Schlaffer Muskeltonus, aufgetriebenes Abdomen.
Lehmartiger Stuhl; Verstopfung, ohne Drang, bei völligem Wohlbefinden; aber auch: Neigung zu sauren Durchfällen.
2.7.3.6 Bewegungsapparat
Neigung zu rachitogener Entwicklung.
Kühle, feuchte Hände und Füße. Im Bett nachts kalte Füße, die sich später erhitzen.
Bein- und Fußdeformitäten (X-/O-Beine, Senkfüße).
Kreuzschmerzen bei Haltungsschwäche des Rückens. Arthritis.
2.7.3.7 Haut
Milchschorf; empfindliche trockene Haut mit Ekzemneigung, schlechter im Winter → Neurodermitis.
Warzen an Fingern und Fußsohlen.
Kaltschweißige Hände und Füße.
2.8 Carcinosinum
Abb. 2.7 Carcinosinum.
2.8.1 Herkunft
Eine Krebsnosode (▶ Abb. 2.7). Verwendet wird kanzeröses Gewebe der weiblichen Brust.
2.8.2 Arzneiwesen/Essenz
Die Ursubstanz steht für eine erbarmungslose destruktive Kraft. Sie zerstört jegliche Einheit und Struktur des hochentwickelten menschlichen Zellgewebes. Im Falle des Mammakarzinoms geht es um die Vernichtung der „mütterlichen Geborgenheit“ und Ernährung, letzten Endes um die „Zerstörung der ganzen Mutter“ (Gawlik). Die Nosode wird bei erblicher Vorbelastung von Kanzerogenität, ansonsten vorwiegend bei Verhaltens- und Gemütssymptomen eingesetzt.
2.8.3 Leitsymptome
2.8.3.1 Gemüt/Verhaltensmerkmale
Das Grundthema dieser Kinder ist die Zerstörung der persönlichen Ich-Entwicklung, ein fundamentaler Mangel an eigener Identität. Häufig sind sie unter rigiden, autoritären Normen aufgewachsen, missachtet oder gar misshandelt worden, oder sie hatten den Verlust eines Elternteils zu erleiden. Dabei sind es sehr sensible, mitfühlende, leicht verletzliche Kinder, die dazu neigen, alle Schuld der Geschehnisse auf sich zu laden. Ihren Mangel an Selbstvertrauen kompensieren sie durch ein hohes Maß an Anpassungsbereitschaft und einer romantischen inneren Sehnsucht nach Zärtlichkeit (beispielsweise große Tierliebe). Struktur und Sicherheit finden Sie in einem ausgeprägten Pflichtgefühl, das sich meist bis zur Pedanterie steigert. Daher „hören diese Kinder früh auf, Kind zu sein“ (Vermeulen).
2.8.3.2 Allgemeinbefinden/Modalitäten
Extreme Anpassung (Vorzeigekinder), Schüchternheit, unterdrückte Emotionen, unverarbeitete Schuldgefühle.
Übertriebenes soziales Verantwortungsgefühl, ausgeprägte Hilfsbereitschaft. Gefahr der Selbstaufopferung.
Fleißig, pedantisch, perfektionistisch übergenau. Tendenz zur Prüfungsangst, Schulangst.
Überempfindlich gegen Kritik (weint sofort bei Tadel), leicht beleidigt, mag keinen Trost.
Leidenschaftliche Sehnsucht (Zärtlichkeiten, Berührung, Reiselust, Gewitter).
Sehr harmoniebedürftig, sentimental (Liebe zur Musik, Tanz, Kunst, zur Natur).
Großes Herz für Tiere.
Krebsleiden in der Familienanamnese.
Warmblütig; Hitze verschlechtert.
Liegen in Knie-Ellbogen-Stellung.
Schreiunruhe, Schlafstörungen des Säuglings. Impfreaktion.
2.8.3.3 Kopf
Bläuliche Skleren.
2.8.3.4 HNO/Atemwege
Folgesymptome einer Mononukleose.
Neigung zu rezidivierenden Tonsillitiden, Sinusitiden.
Allergische Diathese (Heuschnupfen, Asthma).
2.8.3.5 Magen-Darm-Trakt
Verlangen (oder Abneigung) nach Schokolade, Butter, Gewürztem. Obstipationsneigung.
2.8.3.6 Haut
Erdiges, milchkaffeefarbenes Hautkolorit.
Zahlreiche Leberflecke.
2.9 Causticum Hahnemanni
Abb. 2.8 Causticum Hahnemanni.
2.9.1 Herkunft/Toxikologie
Es handelt sich um ein nicht natürlich vorkommendes Mittel. Der Ausgangsstoff ist Marmor (▶ Abb. 2.8). Dieser wird gemahlen, dann durch Säurezugabe erhitzt (brennende Schmerzen). Dadurch entsteht frisch gebrannter Kalk, welcher durch Wasser gelöscht wird. Dieser Brei wird destilliert und daraus entsteht der Niederschlag Ätzkalk. Es handelt sich um eine schwache Lauge.
2.9.2 Arzneiwesen/Essenz
Sehr empfindlich für das Leiden anderer und ängstlich. Mitfühlende Kinder. Am Anfang des Lebens sind Causticum-Menschen sehr reaktiv, später reagieren sie wesentlich langsamer, sind sozusagen ausgebrannt wie der Ätzkalk, weshalb Causticum auch eine typische „Altersarznei“ ist.
2.9.3 Leitsymptome
2.9.3.1 Gemüt/Verhaltensmerkmale
Mitgefühl: Causticum-Kinder sind sensibel und beginnen leicht zu weinen, vor allem, wenn sie Ungerechtigkeiten erleben. Wie im Entstehungsprozess angedeutet, ist Causticum leicht erregbar. Daraus kann sich Zorn entwickeln, weswegen ihnen auch nachgesagt wird, sie seien "Revoluzzer". Dabei sind sie nicht destruktiv, sondern setzen sich für die eigene Gruppe ein. Jugendliche rebellieren oft und können Autoritäten – manchmal auch die Eltern – nicht akzeptieren und sind dabei idealistisch (Sankaran: „Einer für alle, alle für Einen“).
Sie haben zahlreiche Ängste (v. a. in der Dunkelheit, vor der Zukunft). Typisch sind Stottern, das späte Erlernen des Sprechens und Sprachfehler.
2.9.3.2 Allgemeinbefinden/Modalitäten
Verschlechterung durch Zugluft, trockenen und kalten Wind, Wetterwechsel, nachts, Alleinsein.
Besserung durch warmes Wetter und (langsame) Bewegung.
Äußere Erscheinung: oft dunkle Haare und Augen, kultiviert wirkend.
Gestörter Schlaf durch nächtliches Erwachen aus Angst oder Schreck.
2.9.3.3 Kopf
Hautausschläge im Gesicht, Warzen auf der Nase und den Augenlidern.
Neuralgische Kopf- und Gesichtsschmerzen.
2.9.3.4 Innerer Hals
Räusperzwang oder Räuspertick.
Heiserkeit: morgens meist schlimmer, gebessert durch Husten und Auswurf.
2.9.3.5 Magen-Darm-Trakt
Stuhlgangschwierigkeiten.
Verlangen nach Geräuchertem, Abneigung gegenüber Süßem.
2.9.3.6 Urogenitaltrakt
Enuresis, mit Schwierigkeiten aufzuwachen.
2.9.3.7 Extremitäten/Bewegungsapparat
Beschwerden der Gelenke und Muskeln, Besserung bei nassem Wetter.
Evtl. Wachstumsschmerzen.
Spätes Laufenlernen.
Hypotone Muskulatur.
Warzen an den Fingern, v. a. an den Nägeln.
2.10 Chamomilla
Abb. 2.9 Chamomilla.
2.10.1 Herkunft/Toxikologie
Die Echte Kamille aus dem Stamm der Compositae wächst in Gesamt-Europa und in Asien. Verwendet wird die vollständige, frische, blühende Pflanze (▶ Abb. 2.9). Das durch Kaltpressung gewonnene ätherische Öl hat eine entzündungshemmende und granulationsfördernde Wirkung, während das in den Blüten enthaltene Bitterstoffglykosid krampflösend wirkt.
2.10.2 Arzneiwesen/Essenz
Durch Chamomilla wird vor allem das Nervensystem beeinflusst. Betroffen sind das Sensorium mit Überempfindlichkeit des Geruchs, Gehörs und Gesichts und die sensiblen Nerven mit Unerträglichkeit von Schmerzen. Laut Stiegele löst Kamille Verkrampfungen in zweifacher Hinsicht: beim rein somatischen und beim seelischen Hypertonus.
Entsprechend zeichnet sich das Chamomilla-Kind durch extreme Reizbarkeit und eine Überempfindlichkeit gegenüber Sinneseindrücken und Schmerzen aus. Typisch ist die Verschlechterung während der Zahnungsphase, wobei häufig eine gerötete und überwärmte Wange auftritt. Das Kleinkind möchte getragen werden (wie Borax veneta), das Ablegen ins Bett führt sofort wieder zu Zornausbrüchen und Wut. Typischerweise treten die Schmerzen anfallsartig auf, was zu körperlicher und geistiger Unruhe führt.
2.10.3 Leitsymptome
2.10.3.1 Gemüt/Verhaltensmerkmale
Ärgerlichkeit, Reizbarkeit, Wut und Verzweiflung sind Hauptcharakteristika.
Unerträglichkeit der Schmerzen, Ungeduld.
Unbändiges, launisches und ängstliches Wesen. Die Kinder können sich oft selbst nicht leiden, sind unzufrieden und drücken dies auch aus, indem sie ihre Umgebung „nerven“ und ohrenbetäubend schreien.
Heftige Trotzanfälle mit Nach-hinten-Werfen des Kopfes, Füßestampfen und Kopf-auf-den-Boden-Schlagen. Die Kinder werden rasend, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen. Sie zeichnen sich dabei durch Hartnäckigkeit und Widerspenstigkeit aus.
Die Kinder wollen nicht angesprochen oder angerührt, nicht einmal angesehen werden.
Problematisches Einschlafen.
2.10.3.2 Allgemeinbefinden/Modalitäten
Wärme, abends/nachts verschlimmert, Besserung tritt meist nach Mitternacht auf.
Bei Jugendlichen ist zu beachten, dass sich durch den Genuss von Kaffee eine Verschlechterung des Gemütszustandes einstellen kann.
Reißende, ziehende Schmerzen.
2.10.3.3 Kopf
Hochroter Kopf, Kopfschweiß, Röte einer Wange (hier handelt es sich wiederum um eine Beziehung zum Nervensystem, hier dem Vegetativum).
Sehr oft wird Chamomilla eingesetzt bei Zahnungsbeschwerden von Kindern, assoziiert mit der o.g. Misslaunigkeit und dem Willen, umhergetragen zu werden. Besserung wird durch Kühlung der geröteten Wange erzielt.
2.10.3.4 HNO
Otitis media nach Kälteeinfluss mit raschem, schlagartigem Beginn. Verschlechterung im Freien. Wärme auf das betroffene Ohr bessert, ebenfalls Getragen- oder Gehaltenwerden.
Tonsillitis mit Ohrbeteiligung bei sehr reizbaren Kindern.
2.10.3.5 Atemwege
Charakteristisch sind Brustentzündungen mit trockenem, schmerzhaftem Husten. Wärme bessert auch hier.
Keuchhusten kann bei den zutreffenden Modalitäten durch Chamomilla geheilt werden.
2.10.3.6 Magen-Darm-Trakt
Blähungen, Meteorismus während der ersten drei Lebensmonate, verbunden mit den o.g. Gemütssymptomen.
Saure, grünliche Diarrhöe, oftmals unverdaut. Geruch nach verdorbenen Eiern.
2.11 Ferrum phosphoricum
Abb. 2.10 Ferrum phosphoricum.
2.11.1 Herkunft/Toxikologie
Eisenphosphat oder phosphorsaures Eisen (▶ Abb. 2.10) ist eine Mischung aus Ferrophosphat und Ferriphosphat.
Der größte Teil des im Körper enthaltenen Eisens befindet sich im Hämoglobin der Erythrozyten. Kommt es zu einer Mangelerscheinung, so resultiert eine Anämie mit konsekutivem Leistungsabfall, Wachstumsstörungen, trockener Haut, brüchigen und verformten Nägeln und weiteren trophischen Störungen der Gewebe, wie z. B. Mundwinkelrhagaden.
2.11.2 Arzneiwesen/Essenz
Entsprechend typisch für Ferrum phosphoricum ist die Schwäche und Energielosigkeit der Kinder und der verminderte Appetit, wodurch oftmals ein Gewichtsverlust einsetzt. Es besteht der Drang, sich hinzulegen und auszuruhen.
Vor allem wird es eingesetzt in den Anfangsstadien oder bei unspezifischen Symptomen einer fieberhaften Erkrankung. Dabei sind die Kinder meist durstig (auf große Mengen).
2.11.3 Leitsymptome
2.11.3.1 Gemüt/Verhaltensmerkmale
Heftiger Zorn bis hin zur Gewalttätigkeit, auch gegen sich selbst gerichtet aus Ärger wegen der eigenen Untätigkeit.
Abneigung gegen geistige Anstrengung.
Hämorrhagische Zustände (vgl. auch Ferr-m., Ph-ac., Phos.)
2.11.3.2 Allgemeinbefinden/Modalitäten
Verschlechterung nachts, durch Kälte, anstrengende Bewegung, Erschütterung und an der frischen Luft.
Beispielhafte Auslöser sind Kälte, Regen, Nässe.
Mangel an Lebenswärme (durch die verminderte periphere Durchblutung).
Besserung durch kalte Anwendungen, langsame Bewegung oder Umhergehen, durch Blutung oder Einsamkeit.
2.11.3.3 Kopf
Hauptmittel bei kindlichen Kopfschmerzen mit klopfendem Gefühl, gerötetem Gesicht und blutunterlaufenen Augen (Petrucci ▶ [36]).
Besserung der Schmerzen durch kalte Anwendungen, durch Nasenbluten und äußeren Druck.
2.11.3.4 HNO
Bei akuter Otitis media mit hellrotem Trommelfell oder Paukenerguss oftmals das Mittel der Wahl.
Nasenbluten mit hellrotem Blut, einhergehend mit Fieber, Husten oder Halsweh.
2.11.3.5 Atemwege
Rhinitis, Pneumonie, Pleuritis, Grippe sind typische Erkrankungen, bei denen Ferrum phosphoricum oftmals zur Anwendung kommt.
2.11.3.6 Urogenitalorgane
Harnverhalt mit Fieber.
Enuresis diurna mit schmerzhaftem Harndrang untertags und Beschwerdefreiheit in der Nacht.
2.11.3.7 Haut
Blässe, Anämie.
Nageldeformierungen mit Brüchigkeit, Rillenbildung, Hohl- oder Löffelnagel.