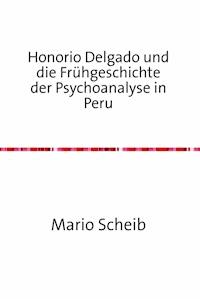
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Honorio Delgado war in den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts ein begeisterter Anhänger der Psychoanalyse. Er begann schon als Student einen Briefwechsel mit Freud und versuchte später an der psychiatrischen Klinik Limas dessen Konzepte in die praktische Arbeit umzusetzen. Auf zwei Europareisen suchte er die Nähe Freuds und begehrte die Aufnahme in die Psychoanalytische Gesellschaft. In der rennommierten peruanischen Tageszeitung "El Commercio" fand man, nach seinem zweiten Besuch in Europa, einen ersten Psychoanalysekritischen Artikel Delgados, in dem er sich selbst als Psychoanalytiker bezeichnet und von Ernest Jones in die Britische Psychoanalytische Gesellschaft aufgenommen worden sei. In der Zukunft distanzierte er sich zunehmend von der Psychoanalyse und machte, nachdem er zu grossem politischen und wissenschaftlichem Einfluss gekommen war, deren Verbreitung in Peru zu seinen Lebzeiten praktisch unmöglich. Er sympathisiserte mit dem Nationalsozialismus und machte jüdischen Immigranten in Peru das Leben unmöglich. Die Hintergründe der persönlichen Entwicklung Delgados und deren weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklung der Psychoanalyse in Südamerika untersucht dieses Buch anhand von unveröffentlichen Materialien und eigenen Recherchen. Es deckt dabei einige erstaunliche medizinhistorische Irrtümer auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mario Scheib
Honorio Delgado und die Frühgeschichte der Psychoanalyse in Perú
Das vorliegende Buch wurde von mir 1995 als Dissertation an der Johann- Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main eingereicht. Ich wurde mit „magna cum laude“ promoviert. Die erste Auflage bestand nur in der Mindestanzahl der für das Promotionsverfahren erforderlichen Exemplare.
Ich glaubte damals nicht, dass dieses Thema auf ein breiteres Interesse stoßen würde. Allerdings wurde ich in der Zukunft immer wieder darauf angesprochen, weshalb ich nun - siebzehn Jahre später - beschloss, dieses Buch einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Natürlich gab es in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse und ich würde heute sicher Einiges anders schreiben. Diese zweite Auflage wurde von mir nicht aktualisiert und erscheint unverändert so, wie sie 1995 geschrieben wurde.
Palma de Mallorca, im Dezember 2012
Dr. med. Mario Scheib
Gewidmet meiner Frau Tania und meiner Tochter Vanessa Antoinette
DANKSAGUNG
Zum Gelingen dieser Arbeit haben zahlreiche Personen auf unterschiedliche Weise beigetragen. An erster Stelle möchte ich Herrn Dr. Ramón León nennen, der mir in Lima viele Kontakte vermittelte und bei der Beschaffung von Material unentbehrlich war. Bei der Koordination von Treffen und der Unterstützung bei meinen Südamerikareisen waren meine Schwiegereltern, Justa Yepez de Ramos und Dr. Manuel Ramos, eine große Hilfe. Herr Luis Thayer Ojeda durchsuchte für mich wochenlang alte Krankenakten. Wichtige Informationen und Anregungen erhielt ich in Lima von Prof. Dr. Leopoldo Chiappo, Prof. Dr. Javier Mariátegui, Dr. Grover Mori, Dr. Álvaro Rey de Castro und Dr. Carlos Seguin, in Santiago de Chile von Dr. Nicolas Allende, Prof. Dr. Otto Dörr und Dr. Juan Pablo Jimenez. Herr Enrique Torteil half mir bei der Korrektur der Übersetzungen ins Deutsche. In Großbritannien wurde ich von Frau Perl King, Dr. Adam Limentani und den Mitarbeiterinnen der Archive der Internationalen und der Britischen Psychoanalytischen Vereinigung bei meiner Suche unterstützt, ebenso wie von Dr. Michael Molnar vom Freud Museum und Herrn Thomas Roberts von Sigmund Freud Copyrights, Colchester. Zahlreiche Anregungen erhielt ich aus Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen anläßlich des "Congress on History of Psychoanalysis" 1993 in London. Wichtige Hinweise oder Einsicht in schwer zugängliche Quellen oder Literatur erhielt ich auch von Dr. Kurt Adler, New York, Dr. Heinz Ansbacher, New York, Frau Dr. Almuth Bruder-Bezzel, Berlin, Dr. H. Jürgen Kagelmann, München, Dr. Alain de Mijolla, Paris, und Frau Dr. Daisy de Saugy, Genf. Herr Dr. Gerhard Wittenberger, Kassel, half bei der Suche in den Rundbriefen des "Geheimen Kommites" und stellte mir Kopien zur Verfügung. Meine Eltern, Hedi und Richard Scheib, halfen mir bei der Materialsuche in Aschersleben. Eine große Hilfe waren mir die kritischen Anregungen und Diskussionen mit meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Helmut Siefert aus Frankfurt, und mit Herrn Prof. Dr. Hannes Stubbe, Köln und Rio de Janeiro, die durch ihre hervorragende Betreuung das Entstehen der Arbeit in dieser Form ermöglichten. Zum Schluß möchte ich meine Frau erwähnen, die neben ihrer Mithilfe bei meinen Recherchen in Perú durch ihr Verständnis und ihre Geduld wesentlich zum Gelingen beitrug. Ihnen allen und den namentlich nicht genannten Helfern und Unterstützem möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank ausdrücken!
1. EINLEITUNG
Im Jahre 1908, dreizehn Jahre nach Freuds und Breuers erster entscheidender psychoanalytischer Veröffentlichung "Studien über Hysterie", begann die Psychoanalyse ihren Einzug in Südamerika. Eine wahrscheinlich erste Erwähnung erfolgte durch den Argentinier Juan A. Agrelo in seiner medizinischen Dissertation mit dem Titel "Psicoterapia".1 1910 schließlich hielt German Greve (1869-1954), ein deutschstämmiger chilenischer Arzt, auf einem Kongreß in Buenos Aires einen Vortrag, in dem er die wesentlichen Konzepte der Psychoanalyse vorstellte und propagierte.
In den folgenden Jahren gab es nur vereinzelte Publikationen, die sich des Themas annahmen, und erst am 1. Januar 1915 begann mit der Veröffentlichung des Aufsatzes "El psicoanálisis" in der Neujahrsnummer der renommierten peruanischen Tageszeitung "El Comercio" eine kontinuierliche Entwicklung, deren Vorreiter der Autor dieses Artikels, Honorio Delgado (1892-1969), werden sollte.
Delgado, damals noch Medizinstudent und gerade 23 Jahre alt, graduierte mit einer Examensarbeit zum gleichen Thema 1918 zum Arzt.2 Die gleiche Arbeit wurde ein Jahr später, ebenfalls unter dem Titel "El psicoanálisis"3 als Buch veröffentlicht und war damit die erste Monografie zum Thema Psychoanalyse in spanischer Sprache.4 Delgado unterhielt über viele Jahre Korrespondenz mit Freud und anderen Repräsentanten der Psychoanalyse und traf sich mit diesen in Europa. In Lima begründete er gemeinsam mit dem Psychiater Hermilio Valdizan (1885-1929) die erste psychiatrische Fachzeitschrift in Perú und versuchte sich in der Anwendung der psychoanalytischen Behandlungsmethode. Er publizierte viel, auch in psychoanalytischen Zeitschriften Europas, und es heißt, er sei 1927 von Emest Jones in die "British Psychoanalytical Society" aufgenommen und damit formal zum ersten Psychoanalytiker Lateinamerikas geworden.5
Jenem Delgado schrieb Freud am 20. Oktober 1919: "Es war eine außerordentliche Freude, Ihre Arbeiten zu erhalten, die soviel Verständnis und Wertschätzung vor Psychoanalyse beweisen ... ". Karl Abraham und Hanns Sachs beschrieben ihn in einem Rundbrief des geheimen Komitees am 16. Oktober 1922)6 als einen Mann, " ... der durchaus günstig wirkt und durchaus ernst zu nehmen ist...". Delgado gewann in Perú wie auch in ganz Lateinamerika zunehmend an Einfluß, zeigte jedoch von Beginn an Seiten, die von Freuds Lehre abwichen und die sich eher an Jung und Adler orientierten. Im weiteren Verlauf läßt sich bei Delgado eine zunehmende Abwendung von der Psychoanalyse beobachten, die in einer offensichtlichen Gegnerschaft endete, von der Álvaro Rey de Castro 1985 schreibt: "Von da an wußte jeder Sympathisant der psychoanalytischen Strömung, daß er der Feindschaft Delgados die Stim bieten mußte, welcher zur führenden Figur der peruanischen Psychiatrie und zu einer der intellektuellen Persönlichkeiten der Epoche geworden war."7 Emilio Mira y López, ein nach Südamerika emigrierter spanischer Psychologe, bezeichnete ihn gar als "Faschisten".8 Als offensichtliche Folge dieser Gegnerschaft entstand in Perú erst am 8. Januar 1970, zwei Monate nach dem Tod Delgados, eine psychoanalytische Studiengruppe9, die 1980 zur "Sociedad Perúana de Psicoanálisis" und zum Mitglied der "International Psychoanalytic Association" (IPA) wurde, mehrere Jahrzehnte nach anderen lateinamerikanischen Gesellschaften.
Diese hier kurz angerissene Entwicklung, in der ein einzelner Mann eine so bedeutende Rolle einnimmt, wirft in vielerlei Beziehung Fragen auf, mit denen sich in den letzten Jahren insbesondere peruanische Psychiater, Analytiker und Psychologen10 auseinandergesetzt haben. Mit unterschiedlichen Gewichtungen und teilweise konträren Schlußfolgerungen werden von diesen Autoren sowohl Ursachen in der Persönlichkeit Delgados, wie auch in den sozialen und fachlichen Rahmenbedingungen gesehen. In meiner Arbeit möchte ich, auf Ergebnissen der vorliegenden Studien aufbauend und unter Hinzuziehung der Ergebnisse eigener Recherchen, versuchen, eine weitere Annäherung an die Person Honorio Delgados und die Situation der Psychoanalyse in Perú während ihrer "Frühgeschichte" zu erzielen.
Dabei muß ich dieses Anliegen und mich selbst kritisch hinterfragen, inwieweit ein Ausländer und Außenstehender - der Verfasser arbeitet zwar als psychoanalytisch orientierter Psychotherapeut, ist aber nicht Mitglied einer der IPA zugehörigen psychoanalytischen Vereinigung - kompetent und berechtigt ist, sich aus der Distanz mit einem lateinamerikanischen Phänomen auseinanderzusetzen. Ist es nicht vielleicht arrogant, sich ein Verständnis und Urteil anzumaßen, wenn man nie wirklich in dieser Kultur gelebt hat und auch nicht alle Veröffentlichungen Delgados - es sind mindestens 362“ - gelesen hat? Andererseits bietet - bei Einhaltung der gebotenen Zurückhaltung und Vorsicht - vielleicht auch gerade diese Position die Möglichkeit, manches unter einem anderen Blickwinkel zu sehen. Als Folge kann dann die Diskussion durch neues Material bereichert werden. In dieser Auffassung bin ich sowohl bei meiner Teilnahme an der "IPA Conference on the History of Psychoanalysis" 1993 in London, als auch bei meinen Gesprächen mit Psychoanalytikern in Perú bestärkt worden. Dort sagte mir ein Kollege, der namentlich nicht genannt werden will, ganz offen: "Es gibt Dinge, die kann man in Perú nicht publizieren; dazu muß man Ausländer sein." Es wird sich im Verlauf dieser Arbeit zeigen, daß diese Einschätzung richtig war.
Ich möchte mich im folgenden darauf beschränken, die Ergebnisse meiner Recherchen und eigene Überlegungen aufzuzeigen und vielleicht neue Diskussionsanstöße zu geben, ohne hiermit eine abschließende Wertung zu diesem sehr umfangreichen und komplexen Thema geben zu können.
Unter "Frühgeschichte" fasse ich die Zeit von der ersten psychoanalytischen Veröffentlichung in Perú 1915 bis zur Gründung der ersten peruanischen Studiengruppe für Psychoanalyse 1979 zusammen. Im engeren Sinne handelt es sich um die Zeit bis Anfang der dreißiger Jahre, da durch die Gegnerschaft Delgados die Psychoanalyse dann von ihrer ursprünglichen Bedeutung verlor.
Zur Einführung in die Gesamtsituation stelle ich meinen Ausführungen einen kurzen Überblick über Erwähnungen der Psychoanalyse in Lateinamerika vor Delgados Zeitungsartikel 1915, sowie über die gesellschaftliche Situation und die Geschichte der Psychiatrie in Perú vor und bei Beginn der Verbreitung psychoanalytischer Ideen voran.
Die Fragestellungen, denen anschließend mein besonderes Interesse gilt, betreffen einerseits die Person Honorio Delgados und seinen Wandel vom Befürworter zum Gegner der Psychoanalyse, andererseits die Frage, wie Psychoanalyse damals in Perú praktiziert wurde. Daraus läßt sich dann direkt die Frage ableiten, ob und wie sich diese beiden Themen gegenseitig beeinflußt haben.
2. METHODISCHE VORBEMERKUNGEN
Die vorliegende Arbeit stützt sich im wesentlichen auf folgende Quellen:
1. Die Veröffentlichungen Honorio Delgados
Delgados Veröffentlichungen umfassen eine Fülle von Aufsätzen in Tageszeitungen, Zeitschriften unterschiedlicher Art und Monografien, die in verschiedenen Ländern erschienen. Dabei fiel mir auf, daß auch Delgados offizielle Bio-Bibliografie11 der Perúanischen Nationalbibliothek nicht vollständig ist. Ein wesentliches Problem stellte dabei die Verfügbarkeit der Arbeiten dar. Viele Arbeiten sind in Europa nicht erhältlich und auch in Lima nur als Nachdruck verfügbar. Die wichtigsten von mir benutzten Arbeiten Delgados befinden sich als Nachdruck in einem von der Universidad Perúana Cayetano Heredia herausgegebenen Sammelband.12 Herausgeber ist Javier Mariátegui, der den "Lehrstuhl Honorio Delgado" innehat, und Mit-Herausgeber der Delgado kritisch gegenüberstehende Álvaro Rey de Castro. Dies ist für mich ein Hinweis auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Nachdrucke, eine Meinung, die auch von dem peruanischen Psychologie-Historiker Ramón León geteilt wird.
2. Publikationen über Honorio Delgado und die Psychoanalyse
Die wichtigsten Arbeiten zu Delgado und der Psychoanalyse habe ich kritisch zusammengefaßt und kommentiert. Aus weiteren Arbeiten und Vorträgen werden Auszüge im jeweiligen Zusammenhang berücksichtigt und zitiert. Manche dieser Arbeiten wurden mir bei persönlichen Gesprächen mit den Autoren überlassen und sind über Bibliotheken nicht oder nur schwer zugänglich.
3. Delgado betreffende Briefwechsel und Dokumente
Leider war es auch mir - wie Rey de Castro vor mir - nicht möglich, Delgados Briefe an Freud aufzufinden. Wahrscheinlich blieben sie bei Freuds Flucht nach London in Wien und wurden vernichtet oder sind dort verschollen.
Eine weitere Informationsquelle sah ich in der Korrespondenz zwischen damaligen Analytikern, in denen Delgado möglicherweise Vorkommen konnte. Eine erste Spur fand ich bei "Sigmund Freud Copyrights", die mich schließlich zu den Rundbriefen des geheimen Komitees führte, in denen Delgado verschiedentlich erwähnt wird.
Weitere Briefe fand ich bei Durchsicht der Korrespondenz zwischen Sigmund Freud und Karl Abraham im Freud-Museum in London.
In London durchsuchte ich bei der "British Psycho-Analytical Society" die Protokolle der Mitgliederversammlungen und die Mitgliederverzeichnisse der relevanten Jahrgänge, um Hinweisen auf eine Aufnahme und Mitgliedschaft Delgados nachzugehen.
Nicht fündig wurde ich bezüglich der Korrespondenz zwischen Delgado und Alfred Adler und Carl Gustav Jung. In Lima vermutlich vorhandene Kopien einzelner Briefe wurden mir leider bis heute nicht zugänglich gemacht und werden möglicherweise demnächst von Herrn Dr.Grover Mori publiziert. Über einen Briefwechsel und dessen möglichen Verbleib ist beim C. G. Jung-Institut und dem Archiv der ETH Zürich sowie beim Sohn C. G. Jungs, Herrn Franz Jung, nichts bekannt. Auch beim Sohn Alfred Adlers, Herrn Dr. Kurt Adler, sowie bei Dr. Heinz Ansbacher und Dr. Almuth Bruder-Bezzel wußte man nichts von einer Korrespondenz mit Delgado.
Eine weitere Spur verfolgte ich über mögliche Angehörige der Witwe Delgados in Deutschland. Hierzu sah ich Dokumente des Evangelischen Kirchenamtes in Aschersleben ein und suchte über eine Zeitungsanzeige in der "Mitteldeutsche Zeitung" lebende Verwandte. Die Geschwister der Witwe sind inzwischen offenbar alle verstorben. Wesentliche Informationen konnte ich auch auf diesem Weg nicht erhalten.
4. Krankengeschichten von Patienten Delgados aus dem "Asilo Colonia Magdalena"
Die Krankengeschichten aus den zwanziger und dreißiger Jahren sind dort in einem Kellerraum, ohne erkennbares System übereinandergestapelt. Ein peruanischer Psychologiestudent, Herr Luis Thayer Ojeda, hat dort mehrere Wochen lang in meinem Auftrag nach Krankengeschichten von Patienten Delgados oder anderen Patienten, in denen sich Hinweise auf psychoanalytische Behandlungen befanden, gesucht und diese teilweise oder ganz kopiert.
5. Interviews mit Zeitzeugen, die Delgado persönlich kannten
Hierbei handelt es sich um Gespräche in Lima, die ich in Kapitel 7.1. beschreibe.
6. Briefe und Dokumente zur frühen lateinamerikanischen Psychoanalysegeschichte
Mein besonderes Interesse galt dabei dem Briefwechsel zwischen Delgado und Fernando Allende Navarro (1891-1981), dem ersten chilenischen Analytiker. Leider war dieser weder im Nachlaß Allendes in Santiago de Chile noch in Lima aufzufinden. Einzelne Briefe wurden von mir aus anderen Publikationen zitiert. Ein Brief von Freud an Allende wurde mir von dessen Sohn in Kopie überlassen.
Näheres über German Greve konnte ich in Gesprächen mit chilenischen Kollegen leider nicht in Erfahrung bringen.
Bei der Übersetzung der Texte aus dem Spanischen war ich um einen Mittelweg zwischen Lesbarkeit und Worttreue bemüht. Bei den Arbeiten Delgados war das aufgrund seines ausschweifenden Stiles und einer teilweise vagen Ausdrucksweise problematisch. Wichtige Textstellen habe ich deshalb immer zusätzlich als Anmerkung in der spanischen Originalform zitiert.
3 ANFÄNGE DER PSYCHOANALYSE IN LATEINAMERIKA
3.1. GERMAN GREVE
1910 referierte ein vermutlich deutschstämmiger chilenischer Arzt namens German Greve auf einem Kongreß in Buenos Aires einen Vortrag mit dem Titel "Über Psychologie und Psychotherapie bestimmter Angstzustände."13 1911 schreibt Freud im "Zentralblatt für Psychoanalyse" dazu: "Der Autor, der diesem Kongreß als Delegierter der Regierung von Chile beiwohnte, hat in besonders lichtvoller und von Mißverständnissen freier Weise den wesentlichen Inhalt der Verdrängungslehre und die ätiologische Bedeutung des sexuellen Moments für die Neurosen dargelegt." Freud hob in seiner Rezension besonders hervor, "welch gutes Verständnis der neurotischen Erkrankungen sich darin verrät, den Heilerfolg nicht in der Beseitigung einzelner Symptome, sondern in der Herstellung der Leistungsfähigkeit fürs Leben zu suchen". Seine Besprechung endet mit dem Satz: "Wir danken dem (wahrscheinlich deutschen) Kollegen im fernen Chile für die unparteiische Würdigung der Psychoanalyse und die unerwartete Bestätigung ihrer Heilwirkung in fremden Landen." In seiner Schrift "Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung" (1914) kommt Freud darauf zurück: "Ein (wahrscheinlich deutscher) Arzt aus Chile trat auf dem internationalen Kongreß in Buenos Aires 1910 für die Existenz der kindlichen Sexualität ein und lobte die Erfolge der psychoanalytischen Therapie bei Zwangssymptomen."14
Unklar ist, wie Freud in für damalige Verhältnisse so kurzer Zeit Kenntnis von Greves Vortrag Kenntnis erhielt; möglicherweise schickte ihn Greve direkt an Freud.15 In Südamerika ging dieser Vortrag zunächst verlorenen und wurde erst 1945 von Ludovico Rosenthal, "verloren zwischen anderen Broschüren", in Buenos Aires entdeckt.16 Bei seinen Nachforschungen fand Rosenthal keinerlei Hinweise auf den damaligen Kongreß und schreibt, daß der einzige internationale Kongreß dieses Jahres der "Congreso Cientffico Intemacional Americano del Centenario" vom 10. bis 25. Juli 1910 gewesen sei, in dessen Unterlagen er aber auch nicht fündig wurde. Hugo Vezzetti bezeichnet die Arbeit Greves als einen obligaten Bezugspunkt in der Geschichte der lateinamerikanischen Psychoanalyse.17 Casaula, Coloma und Jordán beschreiben in ihrem Rückblick auf die Geschichte der Psychoanalyse in Chile, daß Greves Vortrag neben einer großen konzeptuellen Klarheit und einem eleganten literarischen Stil eine genaue Kenntnis der Psychoanalyse zeige.18
Tatsächlich gab Greve in seinem Vortrag einen guten und damals aktuellen Überblick über das Konzept der Psychoanalyse: Er beschreibt die hohe Bedeutung der Sexualität bei der Entstehung von Neurosen. Dies sei auch der Grund, weshalb diese Theorie heftig angegriffen werde. Nach einer kurzen Gegenüberstellung zu Pierre Janets Neurosendefinition hebt Greve die Rolle seelischer Traumen in der Entstehung der Hysterie hervor und verweist auf Freuds Arbeit mit Breuer. Bewußtes wird vom Unbewußten bzw. Unterbewußten abgegrenzt, die kindliche Sexualität wird als polymorph pervers dargestellt und als Ursprung der sexuellen Phantasien der Erwachsenen, ebenso wie deren Sublimierung in soziales und ethisches Verhalten. Sexualität solle im weitesten Sinne verstanden werden, Libido im engeren Sinne. Zur Bi-Sexualität beschreibt Greve auch die weibliche Sexualität als zunächst männlich, wobei die Überwindung dieses Anteiles in der Pubertät der Ursprung für häufigere neurotische Erkrankungen bei Frauen sei. Beim Hysteriker bestünde eine anomale Sexualität mit verdrängten perversen Phantasien, wobei Hysterikerinnen häufig frigide seien. Die Ursprünge der Zwangsneurose werden in einer frühkindlichen Periode von Amoralität dargestellt, Zwangsgedanken als Kompromißbildungen zwischen Verdrängtem und Verdrängendem. Die Auslöser seien regelmäßig in der Pubertät auszumachen. Greve verweist auf Freuds Unterscheidung zwischen den überwiegend stoffwechselbedingten Aktualneurosen und den durch das Hinzukommen psychischer Affektionen entstehenden Psychoneurosen, wozu Grewe Zwangsneurose und Hysterie zählt.
Er weist auch darauf hin, daß in der Ätiologie der Neurosen immer neben der sexuellen Entwicklung und deren Störungen auch die Vererbung eine Rolle spiele. Weiter beschreibt er, daß bisher Theorie und Technik mehrfach modifiziert wurden und daß die Wirkung der psychoanalytischen Behandlung im Bewußtmachen von Verdrängtem zu sehen sei, dem sich ein Widerstand entgegenstelle, welcher in der Analyse überwunden werden müsse. Für die Interpretation von Träumen und Fehlleistungen gebe es keine feststehende Methode, sondern empirische Regeln, die sich aus den Krankengeschichten ableiten ließen. Freud würde sich in seinen Behandlungen aus verständlichen Gründen viel Zeit lassen, nämlich zwischen einem halben Jahr und drei Jahren. Er selbst gehe davon aus, daß sich diese Zeit deutlich verkürzen lasse. Aus seiner eigenen Erfahrung beschreibt er die Zwangsneurose als eine der psychoanalytischen Behandlung besonders gut zugängliche Neurose. Hierbei würden bereits oft unvollständige, verkürzte Behandlungen zum Erfolg führen. Greve fand bei seinen Zwangsneurotikern (alle weiblich, teils ledig, teils verheiratet und zwischen neunzehn und fünfundzwanzig Jahren alt) immer ein sexuelles Trauma in der Zeit der Pubertät, eine weitere Analyse bis in die Zeit der Kindheit führte er in der Regel nicht durch. Greve empfiehlt, den Freudschen Theorien große Aufmerksamkeit zu widmen und beklagt zum Schluß das Fehlen einer aktualisierten Gesamtdarstellung der Doktrin sowie die Verständnisprobleme, die sich durch Sprache, Form und Umfang des Freudschen Werkes ergeben.
Aus diesem Vortrag läßt sich entnehmen, daß Greve offenbar einige Zeit mit der psychoanalytischen Methode gearbeitet hatte. Außerdem handelte es sich dabei aber um die Aktivität eines Einzelnen. Greve bildete wohl auch keine Schüler aus. Es sind auch keine weitere Publikationen Greves bekannt.
Bei genauerer Betrachtung des oben kurz zusammengefaßten Textes erweist sich ein Phänomen als besonders merkwürdig: Greve beschreibt bezüglich seiner eigenen Therapien bereits nach wenigen Sitzungen hervorragende Erfolge bei der Behandlung von Zwangsneurosen. In einem Fall hätten bereits zwei Sitzungen von insgesamt weniger als einer Stunde Dauer zum Verschwinden bisher therapieresistenter Symptome ausgereicht. Betrachtet man andererseits Alter und Geschlecht der Patientinnen (alle weiblich, zwischen neunzehn und fünfundzwanzig Jahre alt), liegt zumindest der Verdacht nahe, daß hier wohl ein Diagnosefehler vorlag. Mir fallen hierbei Freuds Beschreibungen der Behandlungen Charcots ein sowie die alte Weisheit, nach der die Hysterie in der Lage ist, alle anderen Erkrankungen zu imitieren. Möglicherweise handelte es sich dabei nur um vorübergehende, auf Suggestion beruhende Symptombeseitigungen bei Konversionsneurosen.
Hier handelt es sich aber nicht um ein singuläres Problem, wie wir später im Zusammenhang mit den Behandlungserfolgen Delgados in Lima noch sehen werden. Eine geregelte psychiatrische Ausbildung gab es damals noch nicht. Psychiatrische Kenntnisse waren im wesentlichen angelesen; nur wenige iberoamerikanische Ärzte hatten die Gelegenheit und die Mittel, sich in Europa in Psychiatrie weiterzubilden. Auch die Irrenanstalten wurden erst ganz allmählich von Verwahranstalten zu Krankenhäusern mit ärztlicher Versorgung. Hinzu kommen Probleme der Vergleichbarkeit von klinischen Beispielen aus dem europäischen in den lateinamerikanischen Kulturkreis sowie, bei den wenigen ins Spanische oder Portugiesische übersetzten Arbeiten, teilweise erhebliche Übersetzungsfehler.19 Woher also sollten Diagnosen kommen, die sich in ihrer Aussagekraft mit denen eines mitteleuropäischen Kollegen der gleichen Zeit vergleichen ließen?
Ähnlich sieht es mit der Behandlungstechnik aus, worauf ich auch später noch detaillierter zurückkommen werde. Sicher gab es zu Beginn dieses Jahrhunderts viele an Psychoanalyse interessierte Ärzte und Laien die, einer früheren Anregung Freuds folgend, damit begannen, Gelesenes in die Praxis umzusetzen. Die Qualität dieser ersten Analysen war wohl dementsprechend sehr unterschiedlich. Immerhin bestand jedoch in Mitteleuropa die Möglichkeit einer intensiven Kommunikation, sowohl durch persönliche Kontakte als auch zumindest durch Briefe. In den Jahren vor dem Ausbruch des ersten Weltkrieges konnte Freud auf einen am Montag abgesandten Brief nach Berlin oder Zürich bereits am Mittwoch mit einer Antwort rechnen20, was sich allerdings in den folgenden Jahren aufgrund des Krieges deutlich schwieriger gestaltete. Dem gegenüber brauchte ein Linienschiff vor Eröffnung des Panamakanals 1914 von Callao (Perú) zwischen 65 und 72 Tage und von Valparaiso (Chile) 48 bis 55 Tage bis Hamburg, nach Änderung der Route durch die Kanalöffnung von Perú noch 41 bis 45 Tage von Chile dann 55 bis 58 Tage.21 Hinzu kamen dann für Briefe noch die I^andwege und die Wartezeit im jeweiligen Postkontor, die auch Wochen betragen konnten. Wenn man sich die daraus resultierenden Brieflaufzeiten zwischen Südamerika und Europa und die Schwundquote auf dem Postweg betrachtet, war die Möglichkeit einer intensiven Kommunikation über Behandlungen praktisch ausgeschlossen. Hätte ein chilenischer oder peruanischer Arzt damals Freud ein behandlungstechnisches Problem bei einer soeben begonnenen Analyse schildern wollen, wäre die Antwort vermutlich erst im letzten Abschnitt oder nach dem Ende der Analyse angekommen, auf jeden Fall aber zu einem Zeitpunkt, an dem der mögliche Rat vom Verlauf der Analyse bereits überholt war. Freud beklagte dieses Problem in seinem ersten Brief an Honorio Delgado, dessen Brief von Lima nach Wien fast drei Monate unterwegs war.22 Auch Kontakte innerhalb des Subkontinents waren unvergleichbar schwieriger als in Europa. Die ersten lateinamerikanischen Ärzte, die sich begeistert an die analytische Arbeit machten, waren demnach in der Umsetzung des Gelesenen, was erschwerend dazu nur in deutscher Sprache erhältlich war, ganz auf sich selbst gestellt.
3.2. ANDERE FRÜHE ERWÄHNUNGEN
Obwohl der Vortrag Greves vermutlich die einzige umfassende Darstellung der Psychoanalyse in Lateinamerika vor 1915 war, möchte ich der Vollständigkeit halber auch die übrigen frühen Erwähnungen der Psychoanalyse auf dem Subkontinent - soweit zugänglich - kurz darstellen.
Im gesamten spanischen Sprachraum gab es nach den mir vorliegenden Informationen offenbar kaum Veröffentlichungen zum Thema Psychoanalyse. Eine Ausnahme bildet die 1893, nur etwa zwei Monate nach dem Erscheinen im Wiener "Neurologischen Centralblatt", publizierte Übersetzung von Freuds und Breuers "Vorläufige Mitteilung".23 Sie erschien in der "Gaceta Médica" (Granada) und der "Revista de Ciencias Médicas" (Barcelona), ohne allerdings nachhaltige Resonanz zu finden.24
Der spanische Philosoph und Soziologe José Ortega y Gasset (1883-1955) publizierte dann 1911 in "La Lectura" den Aufsatz "Psicoanálisis, ciencia problemática", in dem er sich insbesondere auf Freuds "Zur Psychopathologie des Alltagslebens"25 bezieht und sich unter wissenschaftstheoretischen Gesichtspunkten mit der Psychoanalyse auseinandersetzt. 1917 erwarb der spanische Verleger Ruiz Castillo auf Empfehlung Ortegas die Übersetzungsrechte an Freuds Werken und beauftragte den Schriftsteller Luis López Ballesteros mit der Übersetzung. Aber erst 1932 erschien dann der erste Band der gesammelten Schriften in spanischer Sprache.26
Stubbe fand die erste Erwähnung der Psychoanalyse in Lateinamerika bei dem Argentinier Juan A. Agrelo, der 1908 in seiner medizinischen Dissertation mit dem Titel "Psicoterapia" Freud zitierte.27
Sebastian Lorente y Patron, der später eine wichtige Rolle in der Reform der peruanischen Psychiatrie spielen sollte, erwähnt in seiner im November 1914 vorgelegten Dissertation mit dem Titel "Las orientaciones de la psiquiatrfa" (Die Orientierungen der Psychiatrie) die Psychoanalyse als ein "experimentelles Vorgehen" in der modernen Psychiatrie. Lorente schreibt dazu:
"Die Psychoanalyse wendet keine der physischen Methoden an; sic verdankt ihren Ursprung Freud, der sic seinerseits aus einer von Breuer speziell zur Neurosebehandlung angewandten Methode abgeleitet hat.
Freud, der vom allgemeinen Determinismus des psychischen Lebens überzeugt ist, fordert seine Kranken auf, frei zu reden und all das zu sagen, was ihnen in den Sinn kommt, um auf diese Weise die Exegese der Einfälle des Individuums vornehmen zu können. Des weiteren ist diese Vorgehensweise auf registrierte Eindrücke von Kranken während des Traumes und auf die selbsttätige Interpretation ausgebreitet worden. Die Anhänger dieser Schule betrachten den Streit um diese Methode aus einer Perspektive, die zum Großteil dazu neigt, die ehemaligen Lehren der psychiatrischen Psychologie zu ersetzen.
Durch die Lehren von Freud in Wien, Jung in Zürich, Wundt in Deutschland und Janet in Frankreich hat die Psychoanalyse vollends Eingang in die psychiatrische Klinik gefunden und bildet inzwischen einen festen, wichtigen Bestandteil in der Erforschung des neuro-psychischen Mechanismus, der Phobien, Zwänge, homosexueller Neigungen, der Dementia praecox paralytischen Ursprungs und der deliranten Zustände."28
Lorentes Arbeit gibt einen Überblick über die psychiatrischen Schulen, die Behandlungsmöglichkeiten und die Organisation der psychiatrischen Versorgung, insbesondere in Europa. Er bemängelt schließlich das Fehlen einer adäquaten Ausbildung von Ärzten und die mangelhafte Versorgung der psychisch Kranken in Perú. Das Thema "Psychoanalyse" erscheint in der Dissertation nur am Rande, wobei der Autor die Bedeutung der Psychoanalyse wohl bei weitem überschätzt hat - ein Phänomen, welches wir bei Delgado wiederfinden werden.
Die nächste Erwähnung der Psychoanalyse erfolgte dann bereits 1915 durch Honorio Delgado, kurz darauf, ebenfalls 1915, gefolgt von Carlos Bambarén, der in seinem Bericht "Movimiento médico" in der Zeitschrift "La Crónica Médica" einen Abschnitt der Psychoanalyse widmet.29 Bambarén nimmt darin bereits ausrücklich Bezug auf den Artikel Delgados in "El Comercio" und stellt die Psychoanalyse als neue Theorie dar, die durch Freud vor mehr als zwanzig Jahren zum Verständnis der Psychoneurosen, insbesondere der Hysterie, eingeführt wurde. Besonders betont er dabei den ausschließlich erotischen Charakter der Träume und den Symbolgehalt bestimmter Traumbilder, wie Stock und geschlossene Schachtel für Penis und Vagina. Insgesamt handelt es sich um eine stark vereinfachte Darstellung einiger Aspekte der Psychoanalyse auf etwa eineinhalb Seiten, die mit einem Hinweis auf außermedizinische
Anwendungen der Psychoanalyse endet, im Gegensatz zur Arbeit Lorentes, die die Bedeutung der Psychoanalyse speziell zum Verständnis und der Therapie von psychiatrischen Krankheitsbildem beschreibt.
4. DIE SITUATION IN PERU ZU BEGINN DES 20. JAHRHUNDERTS
4.1. DIE POLITISCHE SITUATION IN PERU
"1886 war das Land cinfach ein Trümmerhaufen", so beschrieb 1915 Victor Maürtua, Professor an der Universidad Nacional de San Marcos in Lima, die Situation Perús nach der Niederlage im Pazifikkrieg von 1879 bis 1883 mit Chile30. Die politischen und kulturellen Institutionen seien praktisch alle nicht mehr funktionsfähig gewesen. 1885 hatten die Militärs unter der Führung von Andres Avelino Cäceres die Regierung übernommen und blieben bis März 1895 an der Macht, als sich die "Bürgerpartei" (Partido Civil) mit dem Freiheitskämpfer Nicoläs de Piérola verbündete und eine neue Epoche in der Geschichte des Landes anbrach.
Der "Partido Civil" war politischer Ausdruck einer großbürgerlichen Elite, die sich aufgrund des Wiederaufblühens von Handel, Landwirtschaft und Bergbau entwickelte. Es begann eine Epoche von Rekonstruktion und Erneuerung, wozu die Reorganisation des Militärs, die Einrichtung eines Entwicklungsministeriums (Ministerio de Formento) und die effiziente Erhebung von Steuern zählten. Piérola blieb dabei jedoch immer von den Bürgerlichen abhängig, da seine eigene Partei, die Demokraten, nicht die erforderliche Mehrheit hatte. Ab 1903 schließlich waren die Bürgerlichen so stark, daß sie keine Koalition mehr benötigten. Von 1899 bis 1919 - mit einer kurzen Unterbrechung 1912 - war das politische System in Perú demokratisch und alle Präsidenten gehörten dem Partido Civil an. Das System, das aus der Verbindung von Demokratie und herrschender Oberschicht entstand, bezeichnete der peruanische Historiker Jorge Basadre als "Republica Aristocrática". Es war politisch relativ stabil, brachte eine Modernisierung der Wirtschaft und eine Konsolidierung der bürgerlichen Elite.
Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts erlebte Perú einen steilen Wirtschaftsaufschwung, der bis zur Weltwirtschaftskrise 1929 anhielt. Zwischen 1890 und 1920 begann in großem Ausmaß die Ausbeutung von Rohstoffen wie Kupfer und Vanadium, sowie den Agrarprodukten Zucker, Baumwolle und Wolle durch einheimische, insbesondere aber auch britische und nordamerikanische Konzerne.
Einheimische Unternehmer befaßten sich dabei hauptsächlich mit dem Export von Agrarprodukten. Gigantische Zuckerrohrplantagen entstanden an der Nordküste, wohingegen der Baumwollanbau eher von kleinen oder mittleren Grundbesitzern betrieben wurde.
Zwischen der Volkszählung 1876 und einer Schätzung 1927 verdoppelte sich die Bevölkerung Perús von 2,1 auf über vier Millionen Einwohner, 1932 zählte man gar 6,1 Millionen. Die zunehmende Landflucht und die Konzentration der Bevölkerung in der Hauptstadt führte in Lima zu einem gewaltigen Zuwachs an Einwohnern: Während die Einwohnerzahl Limas zwischen 1857 und 1908 von etwa 94.000 auf 143.000 anwuchs, stieg sie in den kommenden Jahren in der Hälfte der Zeit auf mehr als das Doppelte an.
In diesem Umfeld entwickelte sich eine bürgerliche Elite, die bemüht war, die modernsten kulturellen und wissenschaftlichen Errungenschaften im Land zu verbreiten. Dabei wurden jedoch Errungenschaften der indigenen Kultur vernachlässigt und verdrängt. Wenn man dabei noch beachtet, daß die Mehrheit der Einwohner Perús zu dieser Zeit nicht spanisch, sondern die Inka-Sprachen Quechua oder Aymara sprachen und 1876 noch 81 Prozent der Perúaner Analphabeten waren, läßt sich verstehen, daß diese Neuerungen nur zu einer Vergrößerung der sozialen Unterschiede zwischen einer städtischen Elite Limas und dem Rest der Bevölkerung führten. Auch 1940 waren noch 60 % der Perúaner Analphabeten, wobei Lima eine Ausnahme darstellte: Dort gab es schon 1931 nur noch 13 Prozent Analphabeten.
Die Bevölkerung Perús läßt sich vereinfacht in drei große Gruppen zusammenfassen: 1. die indigene Bevölkerung mit Abstammung, Sprachen und Traditionen aus dem Inka-Reich oder den Indianerstämmen des Amazonasbeckens, 2. die weiße Bevölkerung als Nachfahren der europäischen Eroberer und Einwanderer und 3. die übrige nicht weiße Bevölkerung, die sich insbesondere aus der Vermischung der beiden ersten Gruppen, den Nachkommen von Negersklaven und asiatischen Einwanderern ergibt. Ein Großteil der Bevölkerung und insbesondere viele der Intellektuellen des beginnenden zwanzigsten Jahrhundert glaubten, daß von der indigenen Bevölkerung nichts zu lernen sei. Hierin sieht Marcos Cueto31 eine Widerspiegelung von Vorurteilen aus der Kolonialzeit, die als Mittel zur Unterwerfung gebraucht wurden. Die Unterdrückung der indigenen Kultur schrieb den Nichtweißen einen Platz am unteren Ende der sozialen Schichtung zu. Für die weiße Elite war alle Aufmerksamkeit nach Europa gerichtet, und erst in den letzten Jahren findet eine allmähliche Rückbesinnung statt, wobei allerdings auf Hautfarbe und Abstammung basierende Vorurteile auch heute noch weit verbreitet sind.
Die herrschende weiße Elite verband mit ihrem Interesse an europäischer Technologie und Wissenschaft auch den Wunsch einer Modernisierung des eigenen Landes. Dabei wurden auch die wichtigen kulturellen und sozialen Strömungen Europas assimiliert, wie insbesondere der Positivismus.
Positivismus und Evolutionismus, so schreibt Cueto, dienten den peruanischen Intellektuellen und Politikern als offizielle Ideologie, als Möglichkeit zur Einordnung von Geschichte und Gesellschaft in einem Rahmen des Fortschrittes. Diese Ideologie der Ordnung und des Fortschrittes im Sinne des französischen Positivismus verurteilte die vorangegangenen Militärregime dahingehend, daß sie nicht in der Lage gewesen wären, die für eine normale Entwicklung der Gesellschaft notwendige Stabilität errichtet zu haben. Somit stärkte diese Ideologie die Situation der ersten zivilen Regierungen als Vorreiter des nationalen Wiederaufbaus nach dem verlorenen Pazifikkrieg.
Die Geschichte des peruanischen Positivismus begann 1886, als an der "Universidad de San Marcos" ein Kurs über zeitgenössische Philosophie angeboten wurde. Zehn Jahre später war der Positivismus bereits fest in San Marcos etabliert und kurz vor Ende des Jahrhunderts errichtete die "Facultad de Letras" einen Lehrstuhl für Soziologie, die gemäß Auguste Comte (1798-1857), dem Begründer des Positivismus, die Krönung der Wissenschaften darstellt.
Einer breiteren Bekanntheit als Comte erfreute sich insbesondere auch das Werk Herbert Spencers (1820-1903). Der von Spencer begründete Sozialdarwinismus verband sich in Perú mit dem Positivismus. Er wendete den Evolutionismus auf soziale Fragestellungen an und bot damit der bürgerlichen Elite eine ideologische Stütze zur Rechtfertigung ihrer politischen Hegemonie und ihrer Wirtschaftspolitik.
Im Niedergang des Landes nach dem Pazifikkrieg sah man die Auswirkungen von einer mangelhaften Beziehung der Bevölkerung der Küste und des Gebirges, die es zu vereinen galt. Das Nichterkennen dieser nationalen Realitäten ging nach Cueto auf das Fortbestehen des literarischen Romantizismus und des kolonialen Erbes zurück, welche Spekulation, Religion und Metaphysik begünstigt hätten.
Die aus Europa kommenden Technologien und Kenntnisse wurden deshalb als essentiell für den nationalen Wiederaufbau angesehen und an der "Universidad de San Marcos" entstand eine Atmosphäre, welche Beobachtung und Forschung begünstigte. In der Einleitung zu seiner Examensarbeit schrieb Manuel A. Muñiz, der später als Psychiatriereformer bekannt werden sollte: "Nach dem Verlust des Autoritätsgedankens bildet heutzutage die wissenschaftliche Überprüfung und Auseinandersetzung, der nachvollziehbare Beweis dessen, was man behauptet, das einzige maßgebliche Kriterium."32
Gleichzeitig entwickelte sich auf breiter Basis eine antireligiöse Bewegung. Die "Gran Logia del Perú" gab zwischen 1896 und 1904 eine Zeitschrift "El Libre Pensamiento" (Der freie Gedanke) heraus, und zahlreiche prominente Intellektuelle bekannten sich zu dieser Gruppe. 1900 schrieb diese Zeitschrift: "... das Werk der theologischen Erlösung wurde durch das der wissenschaftlichen Erlösung ersetzt."33
Der Einfluß des Positivismus auf dem ganzen Subkontinent - "orden e progreso" (Ordnung und Fortschritt) steht auch im brasilianischen Staatswappen - bewirkte dabei vermehrte Kontakte zwischen peruanischen und ausländischen Wissenschaftlern aller Fachgebiete. Beispiel dafür sind die 1898 ins Leben gerufenen "Congresos Científicos Latinoamericaños" (später auch "Panamericaños"), von denen bis 1940 insgesamt sieben in verschiedenen Ländern ausgetragen wurden. Allerdings kritisierte José Carlos Mariátegui während des 1924 in Lima ausgetragenen Kongresses eine zunehmende Wandlung des Charakters von intellektuellen hin zu politischen Ereignissen; zu einer wirklichen wissenschaftliche Diskussion würden kleinere, fachspezifische Kongresse eher beitragen.
Insgesamt läßt sich laut Cueto die Epoche des Positivismus retrospektiv als für das Land nicht sonderlich ergiebig beurteilen: Es gab keine tiefergehenden Veränderungen in den Institutionen, die Hauptprotagonisten des Positivismus betrieben selbst nie viel empirische Forschung und nach einigen Jahren wurde der Positivismus von den gleichen intellektuellen Kreisen zurückgewiesen, die ihn früher befürwortet hatten.34





























