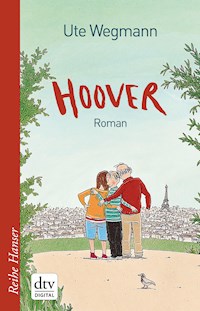
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Darf man etwas Verbotenes tun, wenn man etwas Gutes bezweckt? Hoover will seinem Großvater zum Geburtstag einen Herzenswunsch erfüllen und mit ihm nach Paris fahren. Aber wie soll das gehen? Die Eltern würden es nie erlauben. Und Geld hat Hoover auch nicht. Aber er hat Claudine. Mutig und auch noch Halbfranzösin. Und überhaupt findet Hoover sie toll. Tatsächlich hat Claudine gleich mehrere gute Ideen, eine ist sogar sehr gut, aber leider gefährlich. Hat Hoover den Mut, das alles mit Claudine heimlich durchzuziehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ute Wegmann
Hoover
Roman
für Lou
Am Anfang
Es gab Tage, an denen alles schieflief.
Hoover wusste das. An einem besonders schlimmen Tag tröstete ihn sein Vater und sagte: »Berühmte und wichtige Menschen hatten meistens eine schwere Kindheit.« Erleichterung. Hoover kannte niemanden, der eine schrecklichere Kindheit hatte als er. Der Satz seines Vaters versprach spätes Glück. Vielleicht wurde er ein berühmter Musiker oder ein wichtiger Arzt oder Meeresbiologe. Was auch immer! In diesem merkwürdigen, ereignislosen Herbst schien ein Ende der Schreckenszeit aber weit entfernt. Vor ihm lagen noch einige Schuljahre, Bartwuchs, erste Partys, erste heimliche Biere, erste Küsse.
Er blieb also noch eine Weile:
das jüngste von drei Geschwistern,
der Kleinste in der Familie und in der Klasse,
der mit dem Sommersprossengesicht,
der mit zwei toten Omas und einem toten Hamster,
der ohne Hund,
der Junge mit den langweiligsten Herbstferien.
Eine beachtliche Liste. Mit vielen Schrecklichkeiten.
Warum konnte er nicht ein älterer Bruder sein, ein Junge, groß und muskulös, mit Hund und ein toller Gitarrenspieler? Geduld. Dinge änderten sich. Täglich.
Hoover war zwölf.
Alles war noch möglich.
Ein Glas Marmelade
Hoover schlenderte über den Bürgersteig, vorbei an Vorgärten und geparkten Autos.
Unter seinen Turnschuhen knisterte das Herbstlaub, und die letzten Blätter an den Bäumen leuchteten im Sonnenlicht gelb und rot und mattgrün.
Die Hände tief in den Hosentaschen klimperte er mit Geldstücken. Er mochte den Herbst sehr. Den Geruch, die Farben, das Licht, die letzten warmen Tage. Er summte. Er strahlte. Er blieb stehen und beobachtete zwei Eichhörnchen. Er half einem alten Mann mit Rollator über die Straße. Gute Laune in seinen Augen. Gute Laune der ganze Hoover.
Als er die Hauptstraße überquerte und vor die Glastür des Supermarkts trat, schoben sich zwei Scheiben mit einem leichten Zischen nach links und rechts. Vor ihm lag sein Paradies. Er bog um die Ecke in den Gang mit den Marmeladen, Müslis und Knäckebroten, den er wie gewöhnlich als Abkürzung zur Kühltheke nahm. Da stand sie plötzlich vor ihm. Er erkannte sie an den abgeschnittenen Hosen, den Chucks und den Kopfhörern. Heute flatterte auch noch ein übergroßes Herrenhemd um sie herum, das ihr fast bis zu den Knien reichte.
Eine kleine, schnelle Bewegung, dann schaute sie ihn an. Hoover wusste, dass sie hoffte, er habe nichts bemerkt. Hatte er aber.
Er hatte genau gesehen, wie das Glas Marmelade hinter ihrem Rücken verschwand.
Das Hemd fiel weit von ihren Schultern, und der ganze Stoff umhüllte sie. Sie musste das Glas in den Hosenbund gesteckt haben. Nichts beulte sich da aus, nicht mal ihr Hintern. Hatte er das gerade wirklich gedacht?
Hoover bemühte sich um Gleichgültigkeit. Mit einem lässigen »Hallo« ging er an ihr vorbei. Was hätte er auch sagen sollen? »He, du, du hast da was gestohlen!« Das wusste sie ja. Oder: »Keine Sorge, ich verrate dich nicht.« Nein, das würde er nicht tun! Aber er hörte seine Großmutter: »Wer Äpfel stiehlt, klaut auch iPhones!« Konnte man Äpfel mit Marmelade vergleichen und Marmelade mit Handys?
Leichte Röte lag auf ihren Wangen, sie blinzelte ihn an, und als sie »Hi« sagte, klang ihre Stimme so tief und so schön, dass er beinahe nicht weitergehen konnte, sondern auf der Stelle Wurzeln schlagen wollte, weil er sich noch ein zweites oder drittes Wort von ihr gewünscht hätte.
Am Kühlregal angekommen, herrschte in Hoovers Kopf ein ziemliches Durcheinander. Milch sollte er kaufen und einen Vanillepudding mit Sahnehaube. Eine Tüte Chips wollte er für sich abzweigen, darauf hatte er sich den ganzen Weg gefreut. Jetzt hätte er Pudding und Chips beinah vergessen, als er mit der Milch zurück zur Kasse stürmte.
Ihr Hemd hob sich im Luftzug der Glastür. Sie ging über den Parkplatz. Hoover folgte ihr mit Abstand.
Akeleiweg – Holunderweg – Kastanienallee – durch den Park, Richtung Westen. Die untergehende Sonne blendete ihn.
Er dachte kurz an seine Mutter, die auf die Milch wartete. Das Mädchen schritt durch die Bahnunterführung. Neben den Gleisen stieg ein gepflasterter Weg steil an. Hoover kannte diese Gegend nicht. Das war Bahngelände, also verboten.
Brombeersträucher und kleine Büsche säumten den Pfad, und durch die Pflastersteine wucherte das Unkraut. Die Hecken und Büsche, vom Herbstwind schon ausgedünnt, boten ihm Schutz. Er schaute auf seine Uhr, auf die Milch, den Pudding und die Chips, und dann war das Mädchen plötzlich verschwunden.
Hoover schlich weiter an den Hecken entlang und erreichte den Scheitelpunkt des Weges. Überrascht blieb er stehen: Hinter Buchsbäumen ragte ein Schrebergartenhäuschen auf, ziemlich mitgenommen, der Putz blätterte ab, Dachpappe wellte sich an einer Ecke, die winzigen Fenster blind und zerkratzt, verblichen die karierten Gardinen, aber die Beete mit Kräutern und Herbstblumen sahen geharkt und gegossen aus. Die Schrebergartensiedlung, fünf weitere Gartenhäuser, wirkte verlassen.
Hoover hockte sich hinter den Stamm einer Platane und beobachtete die Laube.
Ein Zweig hing über der Tür, und vor dem Fenster stand eine Bank, die aus zwei Holzbohlen gezimmert war. Plötzlich hörte er Stimmen hinter den Fensterscheiben. Ein Lachen, ein Husten. Er duckte sich. Die Tür knarzte und öffnete sich und eine zarte, gebeugt gehende Frau mit hochgestecktem grauem Haar trat nach draußen, hinter ihr das Mädchen. Die Frau trug eine weiße Hose mit einer langen roten Bluse, bestickt mit feinen Goldfäden.
»Sag deiner Mutter vielen Dank, mein Kind.« Sie sprach sanft und liebevoll.
Das Mädchen umarmte die Frau, als wäre sie aus feinem Porzellan.
»Auf Wiedersehen, Frau Albertocchi. Und danke für den Tee!«
Sie winkten beide zum Abschied. Das Hemd hatte das Mädchen über die Schulter geworfen.
Hoover blieb in seinem Versteck, bis sie am Ende des Weges auf die Straße abbog.
Die Milch fühlt sich warm an, dachte er, und das war kein gutes Zeichen.
Er musste dringend zurück.
Als er die Haustür öffnete, wollte seine wütende Mutter wissen, warum ein kurzer Einkauf zwei Stunden dauern musste.
Hoover konnte nicht zugeben, dass er einem Mädchen aufs Bahngelände gefolgt war, und erst recht wollte er sie nicht verraten.
»Ich hab Jens getroffen. Er hat ein neues Skateboard und wollte mir Tricks zeigen.« Pause. »Entschuldige wegen der Milch!«
Die Mutter blickte konzentriert auf ihren Schreibtisch und schwieg.
»Dann eben keinen Milchreis heute!«, rief sie Hoover hinterher, und das sollte wie eine Strafe klingen. Hoover hatte sich zwar auf Milchreis mit Kirschen gefreut, aber wie unwichtig waren plötzlich Puddings und Chips und Essen überhaupt.
Er verschwand in sein Zimmer und dachte an das Mädchen, das er in letzter Zeit mehrmals in seiner Straße und manchmal in der Schule gesehen hatte. Sie war eine Stufe über ihm, in der siebten.
Stehlen ist verboten, ging es ihm durch den Kopf. Siebtes Gebot: Du sollst nicht stehlen! Hoover hatte noch nie etwas gestohlen. Aber wie schlimm war Stehlen, wenn man das Gestohlene verschenkte? Jemandem, der es vielleicht unbedingt brauchte?
Seine katholische Oma Elli hatte ihm mehr als einmal die Zehn Gebote erklärt. Das hielt sie für notwendig, denn er machte ständig Sachen, die – so behauptete sie – Gott nicht leiden konnte. Hoover versteckte wichtige Sachen seiner Geschwister, wenn sie ihn geärgert hatten. Er suchte im Internet nach nackten Frauen. (Das konnte Oma natürlich nicht wissen.) Er benutzte Notlügen, wenn ihm etwas Peinliches passiert war. Seine Tobsuchtsanfälle am Esstisch waren legendär. Er wollte als kleines Kind nicht das essen, was die Mutter ihm auf den Teller tat, er wollte sich selber nehmen, wie die Großen. Aber niemand verstand ihn.
»Du sollst Vater und Mutter ehren!« Wie oft hatte Oma Elli ihn zurechtgewiesen.
Hoover schaute auf den Rhein. Die Zehn Gebote konnte man befolgen, aber wie sagte sein Vater: »Es gibt immer Ausnahmen von der Regel.«
Vielleicht hatte er heute eine Ausnahme erlebt.
Opa
Hoover saß schon eine Weile auf der Fensterbank in seinem Zimmer und starrte hinaus. Was sollte er auch sonst machen? Seine Mutter war sauer und beschäftigt; und seine Geschwister hatten wie immer ein besseres Leben. Geschwister, drei Jahre älter als er, das war brutal, aber dass Theo und Kata ausgerechnet noch Zwillinge sein mussten, die immer zusammenhielten, gab es etwas Schlimmeres? Außerdem hatte er Eltern, die sich total liebten, solche sah man nicht mehr so häufig, und die immer alles zusammen machen wollten: auf dem Sofa nebeneinander sitzen, dasselbe im Fernsehen anschauen, dasselbe verbieten … endlos die Aufzählung.
In dieser Familie der Jüngste zu sein fühlte sich nicht nur an wie eine einzige Katastrophe.
Hoover lebte mit dem Drama bereits zwölf Jahre, aber manchmal hatte er Streit mit den Zwillingen oder mit den Eltern, und im schlechtesten Fall mit allen zur selben Zeit. Dann kam er sich vor wie das fünfte Rad am Wagen. Blöder Spruch, aber es stimmte: Es war ein Gefühl von Zuviel. Er war zu viel, er störte.
Wenn er sich so überflüssig fühlte, ging er zu seinem Großvater. Der war immer für ihn da, hörte ihm zu, tröstete ihn, versuchte ihn zu verstehen, auch damals, als Oma Elli noch lebte.
Für Hoover war der Großvater der Rettungsring in den Stromschnellen. Sein Lebensretter. Und Oma mit ihren Zehn Geboten war das Sprachrohr Gottes.
Am Abend hörte Hoover die Mutter in der Küche werkeln. Es roch nach Milchreis. Hoover grinste, sie war einfach nicht der Typ für Bestrafung. Da klingelte das Telefon, und über den Flur polterten die Satzfetzen seiner Mutter.
»UNI-Klinik? … auf dem Weg zur Toilette … ohnmächtig bist du geworden? Und jetzt? Ja … geht es dir gut? – Ja, ja, bis morgen! Gute Nacht, Vater!«
Sie legte den Hörer zur Seite und schaute zu ihrem Sohn, der blass am Türrahmen lehnte.
»Opa ist im Krankenhaus?«, fragte Hoover. Opa strotzte vor Kraft und Gesundheit. Opa ist nie krank, schoss es ihm durch den Kopf. Unmöglich!
»Mach dir keine Sorgen, ihm war es wohl ein bisschen schwindelig. Sie haben alles überprüft und behalten ihn dort. Zur Beobachtung. Da kann ihm nichts passieren.«
»Aber er hasst Krankenhäuser!«, flüsterte Hoover.
»Bringt mich bloß nie in ein Krankenhaus!«, so lauteten die Worte des Großvaters, als die Großmutter starb.
Hoover hatte damals Opas faltige Hand mit den schwarzen, struppigen Haaren fest gedrückt, die Lippen zusammengepresst und genickt wie bei einem Gelübde. Und das galt für ihn als unausgesprochenes Versprechen. Die Großmutter konnte sich nicht mehr um den Großvater kümmern, weil sie schließlich tot war. Er musste das übernehmen. Was sollte er tun? Es war schon spät.
»Opa ist okay. Er klang ein bisschen müde, aber fröhlich. Mach nicht so ein sorgenvolles Gesicht. Morgen Abend können wir ihn besuchen. Vielleicht entlassen sie ihn auch.«
»Hat er das gesagt?«
Die Mutter nickte und strich dem Sohn über den Kopf, dann schrie sie auf: »Der Milchreis!«
Der Geruch angebrannter Milch zog von der Küche in den Flur. Auf dem Herd hatte sich eine weiße Kruste gebildet, im Topf klebte schwarz der Reis.
Später im Bett dachte Hoover an Opa, der bestimmt in einem winzigen Zimmer mit weißen Wänden lag. Und ekliger Krankenhausgeruch kroch in Hoovers Nase. Oder roch so die angebrannte Milch? Jedenfalls konnte er lange nicht einschlafen.
Alles grau
Dunkle Wolkenberge ohne Ende, und das an einem Ferienmorgen. Hoover blickte in den grauen Himmel und dachte an den Großvater. Die Bettdecke drückte schwer auf Bauch und Rippen. Ob Opa heute entlassen wird, überlegte er.
Hoover musste plötzlich an Gott denken. Er wollte wohl an ihn glauben und vorsichtshalber auch beten, aber wie? Oma Ellis Einfluss hatte trotz der vielen Gespräche über die Zehn Gebote nicht ausgereicht, um ihn katholisch zu machen. Er wusste nicht, wie sich »Katholisch-Sein« anfühlte und wie man sich verhalten sollte.
Theo und Kata hatten sich vom Religionsunterricht abgemeldet. Sie machten ja immer alles gemeinsam. Also verloren sie auch zur selben Zeit den Glauben an Gott.
Er würde mit Opa über Gott und das siebte Gebot sprechen, und vielleicht, vielleicht würde er ihn fragen, ob Stehlen immer eine Sünde ist, auch wenn jemand dadurch Gutes tut.
Der Wecker zeigte erst sieben Uhr, als Hoover aus dem Bett sprang. Er setzte sich auf die Fensterbank. Alles war für ihn hier noch neu und fremd. Die Straße, der breite Strom, das Tuten der Schiffe, das Licht, die Geräusche aus dem Garten der Nachbarn, der Kiosk und die Geschäfte. Er kannte das Haus und die Gegend von Geburt an – irgendwie –, aber in einem Stadtteil jemanden zu besuchen oder selber dort zu leben machte einen Riesenunterschied.
Sie wohnten erst seit ein paar Monaten an der Uferpromenade in Opas Haus. Als die Oma gestorben war, besuchten die Grasshoffs den Großvater jedes Wochenende. Die Mutter backte Kuchen, die Zwillinge packten Backgammon ein, weil Opa das gern spielte, und Hoover klemmte neben ihm und wich nicht von seiner Seite. Meistens gingen die beiden nach dem Mittagessen zum Strand hinunter und kamen mit Hölzern und Muscheln zurück.
Eines Tages rief der Großvater alle an den großen Eichentisch im Wohnzimmer.
»Was soll ich alleine mit acht Zimmern?«, begann er. »Oma sitzt nur noch in dem einen Sessel! Ich möchte, dass ihr in unser Haus zieht. Die Kinder brauchen Platz.«
Alle hatten gelächelt über die Vorstellung, dass Oma im Sessel säße. Alle freuten sich über Opas Großzügigkeit. Er suchte sich eine Stadtwohnung, zwei Zimmer mit Balkon. Er wollte tagsüber in Cafés Zeitung lesen, abends ins Kino, er war ein großer Filmfan, oder in der Kneipe ein Bierchen »zischen« und jeden Morgen um sechs Uhr zum Hallenbad radeln. Schwimmen hielt ihn fit, und das Bad mit den 50-Meter-Bahnen konnte er von der neuen Wohnung aus mit dem Fahrrad gut erreichen. Der Großvater hatte Pläne geschmiedet. Ihm waren kurze Wege lieber als lange, und er mochte den Rummel der Großstadt.
»Ich hab lange genug auf den Rhein geschaut«, sagte er. »Ich möchte die letzten Jahre meines Lebens noch ein wenig Trubel. Und wenn mir Wasser und Ruhe und Seemöwen fehlen, besuche ich euch.«
Alles klang wohlüberlegt und richtig gut.
Für Hoover bedeutete der Umzug ein schöneres Zimmer und neue Wege.
»Ein neues, grünes Leben«, sagte seine Mutter, als sie auf die Rheinwiesen mit den hohen Büschen und dem breiten Sandstreifen schaute.
Hoover liebte den Fluss und das ganze Grün vor seinem Fenster. Er staunte jeden Tag über die immensen Frachtschiffe mit den vielen bunten Containern. Er hatte noch nie diese Wassermotorräder gesehen, die einen Höllenlärm verursachten. Er beobachtete Liebespaare in den Sandbuchten und Kinder, die auf der Ufermauer Fangen spielten. Auf die Mauer waren alle im Ort sehr stolz, sie schützte die Häuser der Promenade vor dem Hochwasser. Sein Opa hatte schon viele Überschwemmungen erlebt. Vollgelaufene Keller und überflutete Wohnungen, versunkene Autos und weggeschwemmte Fahrräder, Menschen, die mit Booten zum Einkaufen paddeln mussten. Jetzt konnte all das nicht mehr passieren, denn sobald der Rheinpegel stieg, wurden Metallwände auf die Schutzmauer geschraubt, die das Hochwasser abhielten.
Hoover hörte den Entsafter und das Brodeln des Wasserkochers. Sein Magen knurrte. Opa Kurt hatte jeden Morgen das Frühstück für Oma gemacht und sie wie eine Königin bedient. Fünfzig Jahre lang, so lange lebten die Großeltern zusammen und sie liebten sich sehr. Oma Elli nannte Opa einen »tollen Hecht«, wenn er den Teppich gesaugt hatte oder wenn er freiwillig im Garten die Johannisbeeren erntete. Dann beugte sie sich zu ihm hinunter und drückte ihm einen laut schmatzenden Kuss auf die Wange. Hoover konnte keine fünfzig Jahre zurückdenken. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Krieg in Deutschland geherrscht hatte, als der Opa geboren wurde. Ein Krieg mit Toten und Verletzten und Panzern und Schüssen, wie man es heute in den Nachrichten täglich sehen konnte. Ein Krieg, in dem es keinen Platz gab für Kinder.
Wo wohnte eigentlich das braunhaarige Mädchen mit den Shorts? Hin und wieder fuhr sie mit ihrem Skateboard am Haus vorbei, meistens war sie allein. Sie kam ihm vor wie ein Wind, der leicht die Blätter in den Bäumen streifte.
Als Hoover die Treppe herunterkam, war der Tisch in der Küche gedeckt: Pampelmusensaft, ein kaltes Spiegelei und ein Toast, der sich an allen vier Ecken nach oben bog. Er saß eine Weile vor dem trockenen Ei und dem trockenen Toast, dann tauchte seine Mutter in der Tür auf.
»Guten Morgen, mein Schatz. Wir sollen ihn nach der Abendvisite gegen sieben Uhr abholen.« Sie starrte betrübt auf den Hörer in ihrer Hand. »Das ist ein echter Engpass für mich, ein verfluchtes Pech.«
Wenn sie nervös war, wiederholte sie ihre Sätze mit anderen Worten.
Ein Tick!, stellten die Kinder fest.
»So ein verdammtes Unglück!«, fuhr sie fort. »Ich kann mich doch nicht um ihn kümmern. Ich muss doch lernen, damit ich die Prüfung schaffe.«
In einem rasanten Tempo flogen Gedanken durch Hoovers Kopf.
»Ich kümmere mich um Opa!«, hörte er plötzlich seine Stimme, die tiefer klang als sonst.
»Du? Wie willst du das denn machen?«
Hoover hatte den Satz zwar gesagt, aber er hatte vorher nicht darüber nachgedacht.
Überrascht stellte er fest, wie schnell man Entscheidungen treffen konnte, denn schon war der nächste Satz unterwegs, und er hörte dieselbe Stimme sagen: »Ich bleibe heute Nacht bei ihm, und morgen gehe ich mit ihm an den Rhein.«
Was da im Gesicht seiner Mutter ablief. Man nannte das wohl ein Mienenspiel. Aus einem verknautschten, düsteren Sofakissen wurde in Sekunden ein glattes weißes Leintuch. Sie lächelte, beugte sich zu Hoover hinunter und küsste ihn auf die Stirn.
»Ich liebe dich, mein Sohn!«, rief sie. »Dass du das machst, das ist so toll. Das ist wirklich großartig. Ein Knaller.«
Sie musste tatsächlich gestresst sein.
»Jetzt bin ich erleichtert.« Sie kreuzte die Arme vor der Brust und verbeugte sich. »Danke, Sohn, danke. Mach was Schönes, bis wir losfahren. Ich muss weiterlernen. Und wenn du Hunger hast, der Nudelsalat steht in der Speisekammer.«
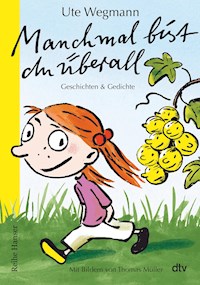

















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










