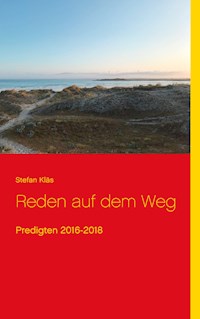Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Hörensagen" enthält Predigten von Stefan Kläs, die in den Jahren 2018 bis 2020 in Düsseldorf entstanden sind und gehalten wurden. Die Texte spiegeln das intensive Bemühen um ein aktualisierendes Verstehen der biblischen Texte wider und beziehen sich darum immer wieder auf Ereignisse des Zeitgeschehens. Sie wollen "Worte zur Zeit" sein. So hat auch die aufkommende Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlassen. Die Predigten sind auch ein Versuch, in immer neuen Anläufen dieses Ereignis theologisch zu bewältigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Den Hörerinnen und Hörern gewidmet, mit herzlichem Dank für ihre Resonanzen.
Die in dem vorliegenden Band gesammelten Predigten habe ich in den Kirchenjahren 2018/19 und 2019/20 in Düsseldorf gehalten. Die Auswahl der biblischen Texte folgt der neuen „Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder“, die seit dem 1. Advent 2018 gültig ist. Für die Zitate aus den biblischen Texten habe ich in der Regel auf die Übersetzung der Lutherbibel in ihrer letzten Fassung von 2017 zurückgegriffen.
In den Predigten spiegelt sich mehr oder weniger ausdrücklich Zeitgeschichte wider, wie ich sie erlebt habe. Zugleich kommt in den Texten zum Ausdruck, wie ich die Bibel in meinem geschichtlichen und sozialen Kontext verstanden und ausgelegt habe.
Einen besonderen Stellenwert hat dabei sicherlich die Corona-Pandemie, die Düsseldorf im März 2019 erreichte und deutliche Spuren in meinem Leben und Predigen hinterlassen hat. Ich habe diese Zeit als Krise und zugleich als Phase vertieften geistlichen Lebens in Erinnerung.
Ich widme dieses Buch allen Hörerinnen und Hörern meiner Predigten, insbesondere denen der Evangelischen Emmauskirchengemeinde in Düsseldorf.
4. Advent 2022
Stefan Kläs
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Anmerkungen
1
Ich wünsche Ihnen allen ein frohes neues Jahr!
Ja, es ist schon so weit. Heute, am 1. Advent, feiern wir den Beginn des neuen Kirchenjahres. Alle Jahre wieder, könnte man denken und zur gewohnten Routine der Advents- und Weihnachtszeit übergehen. Doch diesmal ändert sich wirklich etwas mit dem neuen Jahr.
Mit dem 1. Advent gilt eine neue Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder, die von der Liturgischen Konferenz für die Evangelische Kirche in Deutschland erarbeitet wurde. Und diese neue Ordnung beschert uns gleich beim heutigen Predigttext zwei zusätzliche Verse. Auf den ersten Blick keine gravierende Veränderung, aber wir werden sehen, zwei Verse mehr oder weniger machen einen kleinen, aber feinen Unterschied.
Ich lese den Predigttext für den 1. Advent. Er steht im Evangelium nach Matthäus und erzählt vom Einzug Jesu in Jerusalem:
Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los und führt sie zu mir! Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf dass erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht (Sacharja 9,9): »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.«
Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!
Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. (Matthäus 21,1–11)
Zwei Verse mehr als zuvor, die Verse 10 und 11, gehören also jetzt zum Predigttext. Sie machen einen Unterschied, genauer: sie zeigen die unterschiedlichen Reaktionen der Menschen auf Jesus. Das Volk jubelt ihm zu und kennt ihn. Die Jerusalemer hingegen fragen sich: Wer ist der? Der Evangelist Matthäus spielt hier mit dem Gegensatz von Land und Stadt. Die auf dem Land, von denen manche in der Stadt nicht allzu viel halten, haben schon etwas von Jesus verstanden, während die an Sensationen gewöhnte Stadtbevölkerung sich noch verwundert die Augen reibt und um Aufklärung bittet: Wer ist der?
Es ist der König, der da kommt.
So wie die Bundeskanzlerin dieser Tage mit dem Linienflugzeug zum G20-Gipfel nach Argentinien flog, so kommt auch Jesus mit einem ganz und gar unpassenden Gefährt, mit dem Esel.
Der Esel trägt eine besondere Last, den König, den Messias. Die Umstände, unter denen die Mission des Esels beginnt, verraten etwas über die königliche Würde seines Reiters. Der Esel wird kurzerhand von zwei Jesus-Jüngern requiriert. Sein Auftrag duldet keinen Aufschub. Es geht um die Erfüllung einer lang gehegten Erwartung in Jerusalem: „Siehe, dein König kommt zu dir.“
Doch was für ein König ist das?
Es kommt der ganz andere König. Jerusalem stand zur Zeit Jesu unter römischer Herrschaft. Die Römer verstanden sich als Friedensmacht. Doch welchen Frieden schufen sie? Einen waffenstarrenden Frieden, der in vieler Hinsicht einer Friedhofsruhe glich, der für einige wenige Vorteile, für viele jedoch Armut und Ausgrenzung bedeutete. Ein Frieden, der mehr schlecht als recht hielt, der immer wieder erschüttert und in Frage gestellt wurde, weil er kein gerechter Friede war.
In diesen vermeintlichen Frieden kommt der wahre Friedenskönig.
Der Prophet Sacharja hat die Erwartung dieses Königs geprägt: „ein Gerechter und ein Helfer“, der die Waffen zerbricht und den Völkern Frieden gebietet.
Der Evangelist Matthäus zitiert den Propheten Sacharja und fügt diesem König ein Merkmal hinzu, seine Sanftmut.
Sanftmut wird hier zum entscheidenden Merkmal des Königs. Jesus selbst hatte die Sanftmut in der Bergpredigt zur Voraussetzung der Königswürde gemacht, als er, in eigentümlicher Umkehrung realpolitischer Verhältnisse, erklärte:
„Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.“ (Matthäus 5,5)
Nun zieht dieser König in Jerusalem ein und wirft damit ein kritisches Licht auf all die anderen Könige und Herrscher seither. Die Gestalt auf dem Esel entlarvt mit ihrer Sanftmut die Anmaßung derjenigen Herrscher, die nichts anderes wollen, als sich selbst durchzusetzen.
Beispiele dafür gibt es mehr als genug. Wer Nachrichten schaut, kommt schnell zu dem Schluss: Macht- und Interessenpolitik beherrschen das politische Tagesgeschäft wie eh und je. Wenn du mein Gas nicht kaufst, ramme ich dir dein Schiff – so oder so ähnlich laufen die realpolitischen Spielchen. Und mit großer Risikobereitschaft wird immer wieder mit dem Krieg als Mittel der Politik gespielt.
Aber auch innenpolitisch hegen allzu viele Menschen in unserem Land inzwischen unverhohlene Sympathien für die Idee der unbedingten Selbstdurchsetzung. Dabei geht es ihnen vorgeblich um das Volk, bei Lichte besehen jedoch eher um sich selbst:
„Der Stärkere, also möglichst ich selbst, soll sich durchsetzen. Das, was herrischen Stillstand bedeutet, wird zum Naturgesetz erklärt. … Alles wird besser, wenn Ich, das Volk, das durchsetzen kann, was Ich, das Volk, für richtig halte … und da lassen wir uns von niemandem, schon gar nicht von Gerichten, Parlamenten oder dem Grundgesetz reinreden.“1
Der innere Zusammenhang dieser Beobachtungen besteht in einer im eigenen Ich befangenen Blickrichtung und darin, dass es vielen Menschen an einer Hoffnung für die Zukunft mangelt.
Wer will da ernsthaft noch von Sanftmut reden?
Es ist die Stimme des Königs auf dem Esel, die zu uns von Sanftmut redet; die Stimme Jesu, die um unser Vertrauen wirbt.
Vertrauenswürdig ist er, dieser König, weil er den Weg der Sanftmut selbst gegangen ist und mit seinem eigenen Leben beglaubigt hat, was er verkündigte.
Es ist die ohnmächtige Macht des Gekreuzigten, die Frieden gestiftet hat zwischen Gott und Mensch und die uns darum zu Friedensstiftern macht, wenn wir uns auf sie einlassen.
Gott ist zum Freund des Menschen geworden, darum können wir zu Freunden werden, zu Gottes Kindern, die das Erdreich besitzen, ohne dass sie Machtansprüche gegeneinander verteidigen müssen.
Ich wünsche Ihnen allen ein frohes neues Jahr!
Am Beginn dieses Kirchenjahres stehen wie üblich gute Vorsätze. Mein guter Vorsatz für dieses Kirchenjahr ist, das Befremden der Städter in Jerusalem ernst zu nehmen und wie sie zu fragen: Wer ist der?
Die Menschen an den Rändern verehren ihn als Heiler und Helfer. Darum rufen sie ihn: Hosianna, hilf doch! Und nun kommt er auch zu uns, kündigt sich an und ich möchte fragen: Wie soll ich dich empfangen?
Vielleicht wie die Kinder, von denen einige Verse nach dem Predigttext erzählt wird, dass sie lärmten und die Erwachsenen störten, weil sie ihre Rufe nachahmten: „Hosianna dem Sohn Davids!“, riefen sie, freuten sich ihres Lebens und sprangen umher, als ob alles gut wäre.
Ich möchte dieses neue Kirchenjahr beginnen wie diese Kinder: jubelnd und sorglos – trotz allem, weil er kommt.
2
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel, durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er’s stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. (Jesaja 9,1–6) Nun ist also der Abend da, von dem wir sagen, er sei heilig. Der Abend, an dem Weihnachten beginnt. Der Abend, auf den wir gewartet haben, den wir vorbereitet haben, auf den wir uns in den letzten Tagen und Wochen eingestimmt haben.
Und mit diesem Abend steht auch die Frage im Raum: Wie wird es werden – dieses Jahr? Werden wir in der Familie eine fröhliche Zeit haben oder wann wird der erste Krach die Stimmung aufmischen? Wird der Besuch kommen? Habe ich das richtige Geschenk ausgesucht? Werde ich es aushalten ohne den Menschen, der nicht mehr bei mir ist und den ich so vermisse? Wie wird es werden?
Die Antwort darauf ist: Es kommt darauf an, was wir erwarten! Weihnachten kommt es darauf an, was wir erwarten – für uns, unser Leben, für unsere Welt. Die Erwartung des Propheten Jesaja ist: Es wird gut werden!
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die wohnen im finstern Lande scheint es hell.
Das ist die frohe Botschaft heute Abend: Es wird gut werden! Deshalb sind wir heute Abend hier, feiern Weihnachten, kommen in der Kirche zusammen, singen die bekannten Lieder und hören die große Geschichte von der Geburt im Stall. Von diesem Kind, das in unsere Finsternis gekommen ist.
In unsere Finsternis, die in der Bibel ja ganz und gar nicht verschwiegen wird. In unsere Finsternis, die auch an diesem Abend und in dieser Nacht nicht verschwiegen werden muss und auch nicht verschwiegen werden darf.
Wer heute Abend so tut, als gäbe es keine Finsternis, der gießt über Weihnachten eine Harmoniesoße aus, die nur verdeckt, wie es vielen Menschen wirklich geht. Heute Abend aber geht es darum, wie es uns wirklich geht und was wir wirklich erwarten!
Ich weiß, dass das für jeden von uns etwas ganz Unterschiedliches sein kann.
Und wenn sie zu denen gehören, die heute Abend mit einem fröhlichen Herzen, mit hellem Gemüt oder beschwingten Schrittes in die Thomaskirche gekommen sind, weil das Leben ihnen gerade so guttut, dann freuen sie sich darüber und ich freue mich mit ihnen.
Heute Abend sollen aber auch die gehört werden, denen gerade Weihnachten sehr schwer ums Herz ist. Denen das Singen schwer fällt bei all der Finsternis, die sie umgibt. Die heute Abend wie an jedem Abend damit beschäftigt sind, sich vor Krieg und Gewalt, vor den dröhnenden Militärstiefeln und schlagenden Fäusten in Schutz zu bringen. Die für sich und andere nach Recht und Gerechtigkeit suchen.
Die Bibel verschweigt nicht, wie die Welt ist. Eben manchmal sehr finster. Und mitten hinein in diese Finsternis flammt etwas auf. Zuerst ganz zart und klein und ohnmächtig: Ein Kind ist uns geboren. Ein kleines Wesen, das einen schweren Start ins Leben hat: das zwischen Tieren in einem dreckigen Stall liegt, das in eine eher unklare Familiensituation hineingeboren wird, das durch politische Zustände gefährdet ist.
Ein Kind wie so viele Kinder. Eine zarte Flamme, ein kleines Licht. Von dem wir aber zur Recht viel erwarten können! Nicht mehr und nicht weniger als Frieden und Gerechtigkeit.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er’s stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.
So die Worte Jesajas. Wie wird es also werden, liebe Gemeinde? Gut wird es werden, sagt Jesaja! Ein Reich wird entstehen, das wachsen wird, wie ein Kind, das groß und mächtig wird.
Jesaja erwartet also ziemlich viel! Und er kann das nur, weil Gott aus ihm spricht. Jesaja wird zum Fenster, durch das das Licht in die Finsternis scheint. Und dieses Licht, das in die Finsternis scheint, das ist das Kind, das uns geboren wird. Ihnen und mir und übrigens auch den anderen. Auch denen, mit denen wir uns schwer tun. Uns allen.
Das macht uns zur Familie Gottes, die grösser ist als jede andere Familie. Zu dieser Familie gehören wir, wenn wir wollen. Und dabei ist es egal, wie glücklich oder unglücklich wir in unseren eigenen kleinen Familien sind.
Es kann ja auch ganz schön anstrengend sein, dieses „Familienfest“ Weihnachten! Wie gut tut es da, sich daran zu erinnern, dass Weihnachten zuerst und zuletzt das Fest der Familie Gottes ist.
Und in diesem Sinne ist es ein Familienfest, bei dem wir nicht Harmonie vortäuschen müssen, wo keine ist. Bei dem wir nicht gute Miene zum bösen Spiel machen müssen. Bei dem wir auch weinen dürfen, weil uns geliebte Menschen fehlen.
Es ist das Fest, bei dem wir unsere Hände aufhalten können wie Kinder, aufhalten für den Frieden.
Das ist das Geheimnis dieses Heiligen Abends. Das Geheimnis, das wir feiern mit allen Heimlichkeiten, allen großen und kleinen Geheimnissen bei diesem Fest.
Gott kommt zu uns als Kind unter Kindern, als Mensch unter Menschen. So nah, wie es nur jemand kann, der uns von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit all seiner Kraft liebt.
Und dieses Kind hat einen Namen. Und wie es so ist bei Namen, so steckt auch hier viel Hoffnung in der Namensgebung. Allerdings nicht nur die Hoffnung der Eltern, sondern die eines ganzen Volkes.
Es sind so viele Hoffnungen, dass das Kind nicht einen, sondern ganze vier Namen hat: Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst. Und unter diesen vier Namen ist wohl einer der Rufname: Friede-Fürst.
Friede-Fürst – so heißt dieses Kind.
Friede-Fürst, dieser Name schwingt überall mit, wo wir von Jesus sprechen. Frieden und Gerechtigkeit sind sein Werk. Und die Mittel dazu sind einfach: keine Gewalt, nur das Wort, das Wort der Liebe.
Heute geht es darum, diesen Frieden zu erwarten! Hier in der Kirche, in den Weihnachtstagen und weit darüber hinaus! Das ist übrigens nicht naiv! Weihnachten ist keine Veranstaltung für Naive, sondern für Realisten mit wachen Augen.
Für Realisten, die sehen, wo sich der Frieden Gottes Bahn bricht.
Bei den Lehrerinnen und Polizisten und Sozialarbeitern, die tagtäglich in deutschen Schulen mit Kindern und Jugendlichen Gewaltlosigkeit einüben.
Bei den Tausenden von Menschen, die in Ungarn mutig für ihre Rechte kämpfen. Bei den Journalisten, die in vielen Ländern mit hohem Risiko arbeiten.
Weltweit wurden mindestens 80 von ihnen im vergangenen Jahr getötet. Trotzdem tun sie ihre Arbeit und treten für das Recht auf Meinungsfreiheit und damit auch für uns ein.
Diktaturen fallen, Währungen vergehen, Mächtige kommen ins Gefängnis.
Die Friedensstifter aber bleiben auf dem Plan, machen weiter, unablässig, von Generation zu Generation: Menschen, die die Erwartung haben, dass es gut werden wird. Dass es ein Ende haben wird mit der Finsternis.
Heute geht es darum, sich dieser Realität zu stellen, dass da noch etwas auf uns wartet!
Frieden, der so gerecht ist, dass er es aushält, wenn wir um den richtigen Weg streiten.
Frieden, der uns manchmal zurückhält und uns Demut schenkt, wenn wir so gerne über die anderen meckern würden.
Frieden, der unsere Stimme erhebt, wenn wir sehen, wie ein Kind im Nachbarhaus geschlagen wird.
Frieden, den wir mit uns selber machen, mit unserem Leben, mit unseren Schatten und unseren Schwächen.
Ja, es ist möglich, dass wir immer wieder scheitern mit unseren Bemühungen.
Weihnachten aber bedeutet: Bleibt dran! Lasst euch nicht einreden, die Finsternis würde sowieso siegen!
Und redet euch nicht selbst ein, es gäbe kein Licht!
Hört auf diese Worte, durch die das Licht in die Finsternis scheint.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.
Wie also wird es werden? Gut wird es werden, wenn wir diesem Frieden eine Chance geben.
Diesem Frieden, der wächst und wächst und wächst. Der uns das Leben schenkt, über Weihnachten hinaus. So wie er alles Leben schenkt.
Heute ist der Abend, diesen Frieden in Empfang zu nehmen. Diesen Frieden willkommen zu heißen, vielleicht zunächst zaghaft und mit einem skeptischen Blick. Damit wir erleben, was Jesaja uns prophezeit hat: Großes und Herrliches, Kindliches und Göttliches und Frieden, der alle Vernunft und alles Gefühl übersteigt.
3
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn ich so über den Weihnachtsmarkt gehe, dann geht mir immer wieder durch den Kopf: Der Advent ist doch ein seltsamer Monat!
Was für ein Aufwand dort Jahr für Jahr getrieben wird. Unzählige Menschen machen sich auf wie damals Josef und Maria zur Volkszählung nach Bethlehem. Sie finden, wenn schon keine Herberge, so doch ein schützendes Obdach an den Glühweinständen und Bratwursttheken. Sie treffen sich mit Freunden und Kollegen, atmen den Duft dieser besonderen Zeit mit ihren Familien oder allein und gehen schließlich, oft beladen mit Geschenken wie die Heiligen Drei Könige, wieder nach Hause.
Warum ist das so? Was zieht uns trotz Gedränge und laufender Nase, trotz quengelnder Kinder und quakender Weihnachtsmusik immer wieder an diese Orte im Advent?
Ich vermute, es ist die Sehnsucht nach einer großen, tiefen und durch nichts in der Welt zu hindernden Freude, die uns so sehr lockt.
Wir wissen ja, dass hinter den beleuchteten Fassaden graue Hinterhöfe hocken, dass Kaufbudenflitter und Konsum nicht halten, was sie versprechen. Und dennoch stürzen wir uns immer wieder in diese betriebsame Leere, weil sie angetrieben wird von unserer Sehnsucht. Weil die Lichter unsere Hoffnung wecken. Weil wir hinter Jingle Bells und Tannenbaum, hinter Zuckerwatte und Printen etwas suchen, was uns Halt gibt auf der Karussellfahrt des Lebens.
Etwas, das bleibt, auch wenn die Lichterketten längst wieder eingepackt sind.
Gibt es so etwas? In echt, nicht nur im Spiel des Weihnachtsmarktes?
Paulus versucht dieses Etwas zu umschreiben. Er ringt um Worte dafür und schickt große Begriffe auf die Karussellfahrt der Sprache: Geduld, Trost, Freude, Friede, Hoffnung. Er schreibt:
Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus.
Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre. Denn ich sage: Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind; die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht (Psalm 18,50): »Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen.« Und wiederum heißt es (5.Mose 32,43): »Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk!« Und wiederum (Psalm 117,1): »Lobet den Herrn, alle Heiden, und preisen sollen ihn alle Völker!« Und wiederum spricht Jesaja (Jesaja 11,10): »Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais, und der wird aufstehen, zu herrschen über die Völker; auf den werden die Völker hoffen.«
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. (Römer 15,4–13)
Das also suchen wir, wenn es nach Paulus geht. Wir kaufen Dinge was das Zeug hält und wollen doch eigentlich reich sein an Hoffnung. Wir wünschen uns fröhliche Weihnachten und suchen doch eigentlich Freude und Friede im Glauben.
Nur dass man Freude und Friede im Glauben nicht haben kann wie eine neue Uhr. Und der Reichtum an Hoffnung schlägt sich nicht in Zahlen nieder wie der Bonus auf dem Bankkonto.
Wie aber dann? Wie kommen wir ran an diese Schätze, die wir – wiederum nur mit einem ganz gebrechlichen Wort – als „geistliche Schätze“ bezeichnen könnten?
In den vergangenen Tagen fand ich ein Interview mit Salah Ahmad. Er ist Trauma-Therapeut in Berlin und im Irak, wo er Kriegsopfer behandelt. Seit fast 40 Jahren lebt er nun schon in Berlin. Obwohl er Muslim ist, freut er sich auf Weihnachten, „weil die Leute dann wärmer miteinander umgehen, sich verabreden und beglückwünschen. … das tut jeder Seele gut.“2 Die Menschen, die er behandelt, haben Schreckliches erlebt. Sie sind Kriegs- und Folteropfer aller Konfliktparteien im Irak. In der Therapie lernen sie, mit der Erinnerung an den Schmerz zu leben, ohne immer wieder neu von Angst, Demütigung und Zorn überwältigt zu werden.
Salah Ahmad erzählt von einem traumatisierten Mann, der sich scheiden lassen wollte.
Ich habe den Mann gefragt: „Welche Farbe haben die Augen deiner Frau? Er überlegte: Schwarz, nein, Braun, nein, so ein bisschen Hellbraun! Ich sagte: Du bist neun Jahre mit ihr zusammen, ihr habt zwei Kinder, und du kennst ihre Augenfarbe nicht? Er: Warum ist das wichtig? Ich: Damit sie weiß, dass Du sie siehst! Gib ihr ein gutes Gefühl, indem du zum Beispiel sagst, wow, deine Haare sehen heute fantastisch aus! Da hat er gelacht und gelacht. Er fühlte sich erwischt, aber ich habe ihm kein schlechtes Gewissen gemacht. … Erst war die Frau misstrauisch. Am Ende hat er mir gestanden, dass er sie über alles liebt. Ich konnte ihm helfen, ihr das zu zeigen. Das Wichtigste ist, dass in einer Familie mit einem Traumatisierten einer den anderen verstehen lernt. Freude kann man lernen!“3
Besonders dieser letzte Satz hat es mir angetan. „Freude kann man lernen!“ Wenn das für traumatisierte Menschen gilt, die an Leib und Seele schwer verletzt wurden, dann gilt es für alle, auch für uns. Salah Ahmad ist in seiner Erzählung von dem Mann auf ein Geheimnis gestoßen. Es liegt etwas Heilsames darin, einander zu sehen und anzunehmen. Es ist heilsam, den anderen zu sehen und dabei nicht zu beurteilen oder gar zu verurteilen, sondern zu verstehen. Zu fragen: Wie bist du so geworden? Welcher Schmerz und welche Freude haben dich geprägt?
Wenn wir einander so begegnen, dann ist Gott bei uns. Dann tun wir, was Paulus so ausdrückt: „Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre.“
Paulus schrieb diesen Satz vor langer Zeit an die Gemeinde in Rom. Ihm ging es damals darum, dass jüdische und nichtjüdische Menschen, die als Christen in einer Gemeinde zusammenlebten, einander annehmen und nicht verurteilen. Zur Begründung verwies er auch auf die Schrift, das Alte Testament, die Bibel der Juden:
„Was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben.“
Die Schrift ist eine Quelle der Hoffnung. Sie erzählt uns Geschichten und zeigt uns Verhaltensweisen, die Hoffnung wecken, weil Gott in ihnen dabei ist.
Damals dabei war und heute dabei sein wird.
Wenn wir einander annehmen, dann erfahren wir, dass Gott dabei ist. Einander anzunehmen ist eine Tat der Hoffnung, ist ein Tun mit Zukunft. Nicht weil wir darin perfekt wären, sondern weil Gott diesem Tun Zukunft versprochen hat.
Einander annehmen, das klingt gut und altbekannt, in unseren christlich geschulten Ohren fast schon ein wenig banal. Und doch ist es erstaunlich schwierig. Was hält uns eigentlich davon ab?
Es gibt offensichtlich Widerstände dagegen in uns selbst. Paulus nennt am Beginn des Kapitels die Selbstgefälligkeit. Es gibt in uns Menschen die Tendenz, das eigene Tun und die eigene Lebensweise eher ein bisschen zu unkritisch zu sehen und das Tun und die Lebensweise der anderen eher ein bisschen zu kritisch zu sehen.
Im kulturellen Mainstream wird diese Tendenz massiv verstärkt: Du musst dich durchsetzen. Du musst dir selbst vertrauen, damit du etwas erreichst im Leben. So lauten alltägliche Imperative.
Paulus empfiehlt uns etwas anderes. Denn wer nur sich selbst vertraut, der lebt in der Angst davor, sich selbst zu verlieren. Darum nehmt einander an und vertraut darauf, dass Gott darin bei euch ist. Dadurch wächst Hoffnung. Hoffnung ist ja nichts anderes als Vertrauen, dass Gott es gut macht, heute und in Zukunft. Und zwar gut macht nicht nur für mich, sondern für alle.
Und schaut auf Christus, der auch schon so gelebt hat. Der so sehr aus diesem Trost der Schrift lebte, dass er selbst zu einem Teil der Schrift geworden ist. Darum lesen wir ja bis heute seine Geschichte und inszenieren Jahr für Jahr das Fest seiner Geburt.
„Freude kann man lernen!“, sagt Salah Ahmad. Vielleicht nicht so besonders gut auf dem Weihnachtsmarkt. Aber auf jeden Fall beim gemeinsamen Singen und Gott Loben. Wer gemeinsam singt und Gott lobt, der verzichtet darauf, sich selbst durchzusetzen und lernt, auf die anderen zu hören. Und wenn das gelingt und wir im Klang einander annehmen und so zusammen klingen, dann erleben wir uns selbst neu und intensiv, werden uns selbst neu geschenkt als Teil eines anderen Körpers, der lebt und atmet zu Gottes Ehre.
Was für ein Reichtum an Freude und Frieden! Etwas, das bleibt, auch wenn die Lichterketten längst wieder eingepackt sind. In echt!
4
Merke auf mich, mein Volk, hört mich, meine Leute! Denn Weisung wird von mir ausgehen, und mein Recht will ich gar bald zum Licht der Völker machen. Denn meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil tritt hervor, und meine Arme werden die Völker richten. Die Inseln harren auf mich und warten auf meinen Arm. Hebt eure Augen auf gen Himmel und schaut unten auf die Erde! Denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen, und die darauf wohnen, werden wie Mücken dahinsterben. Aber mein Heil bleibt ewiglich, und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. (Jesaja 51,4–6)
Ich weiß nicht, wie es Ihnen im Rückblick auf das vergangene Jahr 2018 geht. Wenn ich es mit einem Schlagwort beschreiben sollte, dann würde ich dieses wählen: Abgesang.
„Ein Abgesang ist eine Gedenkrede über etwas, das bald untergehen wird.“
Und tatsächlich haben wir dieses Jahr einige Abgesänge gehört: Einen Abgesang auf den deutschen Fußball, nachdem die deutsche Nationalelf schon in der Vorrunde ausgeschieden ist.
Einen Abgesang stimmten die großen Zeitungen und Wochenmagazine an: auf Europa, auf Amerika, den Westen überhaupt, auf die transatlantischen Beziehungen und den freien Handel.
Einen Abgesang auf unser Bild von unserer Gesellschaft, in der wir Rassismus und Antisemitismus längst überwunden glaubten.
Dem wäre vermutlich manches hinzuzufügen, wohl auch aus unseren persönlichen Erfahrungen des vergangenen Jahres.
„Mit dem Abgesang wird das Ende eingeläutet. Der Tenor liegt auf der Wehmut: so wie es einmal war, ist es nicht mehr und wird es nicht mehr sein.“
Ein Abgesang ist ein Lied, das die singen, die einmal Hoffnung gehabt haben: auf eine bessere Welt und bessere Menschen.
Jesaja scheint auch so einen Abgesang zu singen: „Denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen, und die darauf wohnen werden wie die Mücken sterben.“
Das klingt zunächst einmal sehr finster, nach Zerfall und Tod überall.
Trotzdem möchte ich nicht einstimmen in den Abgesang.
Ich möchte neue Lieder singen. Etwa so wie Eichendorff:
Schläft ein Lied in allen Dingen
die da träumen fort und fort,
und die Welt hebt an zu singen,
triffst du nur das Zauberwort.4
Manchmal findet man das Zauberwort, das eine ganze Welt zum Singen bringt.
„Hol doch das Rusticana aus dem Schrank!“ Die Stimme der Mutter war plötzlich wieder ganz lebendig, so als stünde sie neben ihr. Frau K. erinnert sich: „Ich weiß noch genau, wie ich damals mit meinem Bruder das Haus meiner Mutter ausräumte. Wir standen vor dem offenen Wohnzimmerschrank. Darin: Das „Rusticana“, rosa Teller mit Szenen eines idyllischen Landlebens. Da kamen mir die Tränen. So viele Erinnerungen an gemeinsame Sonntagvormittage mit Frühstück von diesem Geschirr. Ich musste weinen. Nicht nur über den Tod meiner Mutter. Auch darüber, dass dieses Gefühl von damals wieder da war, dass ich die Stimme wieder hörte: „Hol mal das Rusticana aus dem Schrank!“
Das Zauberwort war gefunden: das Zauberwort „Rusticana“ stand für das Familienfrühstück, und mehr noch für die Liebe der Mutter. Was für die einen nur ein altmodisches Kaffeegeschirr ist, ist für andere eine Welt voller Liebe. Es kommt darauf an, wie man auf die Dinge schaut.
Ich glaube: Gegen den Abgesang auf die vergängliche Welt hilft nur ein Zauberwort.
Ja, das wünsche ich mir, dass wir doch ein Zauberwort fänden, das uns andere Lieder singen lässt: Lieder voll Hoffnung gegen den Augenschein. Lieder, die die Welt zum Singen bringen.
So ein Zauberwort ist für mich das, was der Prophet Jesaja von Gott weitersagt:
„Merke auf mich, mein Volk, hört mich, meine Leute! Denn meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil tritt hervor, und meine Arme werden die Völker richten. Die Inseln harren auf mich und warten auf meinen Arm.“
Das Zauberwort heißt: Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit.
Das ist das Zauberwort, das die Welt zum Singen bringt.
Das biblische Zauberwort „Gerechtigkeit“ muss man übersetzen. Es hat zu tun mit Treue und Gemeinschaft. Man müsste dafür ein neues Wort erfinden. Ein Wort, das eine Kraft der Veränderung für die Welt beschreibt.
Ich stelle mir die Gerechtigkeit Gottes wie ein Kraftfeld vor, in das die Menschen hineingezogen werden. Jesus nennt dieses Kraftfeld das Himmelreich oder das Reich Gottes. Er erzählt davon, wie die Gerechtigkeit Gottes wirkt und dass sie nahe ist und wie es dann sein wird:
Die Bedrängten werden errettet, die Verfolgten bekommen eine Heimat, die Armen werden satt, die Ausgestoßenen gehören dazu; da werden die Armen selig genannt und sogar die Sünder gerecht gesprochen.
Der Prophet Jesaja singt ein neues Lied von der Gerechtigkeit, die Gott ankündigt:
„Denn meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil tritt hervor und meine Arme werden die Völker richten. Die Inseln harren auf mich und warten auf meinen Arm.“
Der Arm dieses Richters tötet nicht, sondern rettet, wie einst der Arm des Mose das Meer geteilt hat. Und die Inseln sind nicht mehr länger die, die am Rand der Welt leben, die Außenseiter, sondern die, die ins Blickfeld rücken. Die Arme Gottes werden weit genug sein, dass alle in diesem Kraftfeld der Gerechtigkeit leben können, miteinander in Frieden und Gerechtigkeit leben können.
Das Zauberwort heißt Gerechtigkeit. „Und die Welt hebt an zu singen“.
Die Welt hebt an zu singen, wenn Kriege beendet werden und Frieden beginnt; wenn Menschen gerettet werden und Liebe erfahren; wenn aus Fremden Freunde werden. Jedes Mal, wenn zwei Menschen sich die Hand reichen zur Versöhnung, dann ist das neue Lied zu hören – gegen alle Abgesänge.
Über alle Zeiten und Reiche hinweg ist dieses Lied zu hören:
„Aber mein Heil bleibt ewiglich, und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen!“
Wer gerne singt, hier in der Kirche oder in einem Chor, der weiß wie gut das Singen tut: Die Haltung verändert sich, denn mit hängenden Schultern kann man keine frohen Lieder singen. Der Kopf ist gerade und der Blick offen, denn man muss rausschauen aus den Noten, man muss nach vorne schauen, dorthin, woher der Einsatz kommt.
Und egal, wie schlecht gelaunt man gekommen ist, nach dem Singen ist man ein bisschen wie ein neuer Mensch, ein bisschen aufrechter die Haltung und ein bisschen entspannter der Blick.
Dabei ist es nicht egal, was man singt: Nicht einen Abgesang, sondern einen Aufgesang, einen Aufgesang auf das Neue, auf das, was noch kommen wird, auf das, was wir hoffen.
Wenn wir singen, sind wir in einer anderen Welt, in der Welt, von der wir schon heute singen:
Es ist die Welt, wie Gott sie in Aussicht stellt; die Welt, von der Jesus erzählt. Wer davon singt, ist schon mit einem Bein im Reich Gottes, im Kraftfeld Gottes: