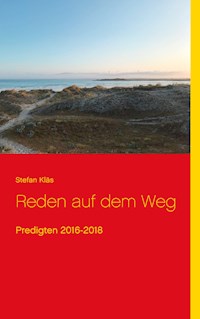Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Sonntagsreden sind der Inbegriff nutzloser Reden. Sie werden in bester Absicht gehalten, bleiben aber oft wirkungslos. So will es das Klischee. Dass Sonntagsreden dann bisweilen doch unerwartete Reaktionen, ja heftige Erschütterungen auslösen können, das gehört zu ihren Risiken und Nebenwirkungen. Predigten sind auch Sonntagsreden. Es sind Reden, die sonntags in bester Absicht gehalten werden. Die Absicht lautet, Gott möge durch sie zu Wort kommen, weil er ein Gott ist, der durchs Wort zu uns kommt. Die in diesem Buch gesammelten Predigten wurden in den Jahren 2011 bis 2016 in Düsseldorf gehalten. Sie zeigen mit Zweifel und Freude am Handwerk Predigt auch ein Stück persönlichen Weges des Verfassers.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sonntagsreden sind der Inbegriff nutzloser Reden. Sie werden in bester Absicht gehalten, bleiben aber oft wirkungslos. So will es das Klischee.
Dass Sonntagsreden dann bisweilen doch unerwartete Reaktionen, ja heftige Erschütterungen auslösen können, das gehört zu ihren Risiken und Nebenwirkungen. Martin Walser beispielsweise musste diese „Erfahrung beim Verfassen einer Sonntagsrede“ (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1998) machen.
Predigten sind auch Sonntagsreden. Es sind Reden, die sonntags in bester Absicht gehalten werden. Die Absicht lautet, Gott möge durch sie zu Wort kommen, weil er ein Gott ist, der durchs Wort zu uns kommt.
Manche halten diese Erwartung für sinnlos, andere die Predigt für wirkungslos. Wieder andere finden, die wahren Absichten beim Predigen seien ganz andere. Erstaunlich viele Hörerinnen und Hörer aber bezeugen: „Unser Gott kommt und schweiget nicht.“ (Psalm 50,2)
Ihnen, den Hörerinnen und Hörern dieser Sonntagsreden, danke ich hiermit. Gehalten wurden sie in den Jahren 2011 bis 2016 in Düsseldorf. Es waren bewegte Jahre, in denen ich immer wieder am Nutzen des Predigens zweifelte, letztlich jedoch erfahren durfte, dass wenig von dem, was wir in der Kirche tun, so sinnvoll ist wie das gemeinsame öffentliche Hören auf die biblischen Texte.
So ist ein persönliches Buch entstanden, das mir als Erinnerung, anderen vielleicht als Anregung dienen kann. Die Predigten selbst sind unverändert abgedruckt. Ihre Zusammenstellung in Kapiteln entspricht thematischen Sinnzusammenhängen, die ich beim Wiederlesen wahrgenommen habe. Sie sind eher lose und könnten auch anders sein.
Mein Dank gilt meiner Frau Antje Brunotte für 20 Jahre theologischen Gesprächs und gemeinsamen Lebens. Auf viele weitere Jahre!
Im Dezember 2017 Stefan Kläs
Inhaltsverzeichnis
Abschied und Neubeginn
Antrittspredigt
Vom klugen Verwalter
Gemeindehaus a.D.
Entwidmung der Matthiaskirche
Abschied
Haltung finden
Frieden suchen
Suche nach Gott
Hoffnung lernen
Gottes Ja
Es gibt Alternativen
Kirche – Institution und Gemeinschaft
Die Familie Gottes
Mut und Realismus
Lebendige Gemeinde
Moralgeschichten
Was tröstet
Der Bund
Der Riss
Die Fremden
Jesus für uns heute
König, Prophet, Priester
Christus König
Jesus fremd
Ich steh’ an deinem Kreuz
Opfer
Nachfolge
Einer von uns
Du wirst leben
Auf die sanfte Tour
Endnoten
I. Abschied und Neubeginn
1. Antrittspredigt
Lukas 15,1-7
1 Alle Zöllner und Sünder suchten seine Nähe, um ihm zuzuhören. 2 Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten: Der nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. 3 Er aber erzählte ihnen das folgende Gleichnis: 4 Wer von euch, der hundert Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die neunundneunzig in der Wüste zurück und geht dem verlorenen nach, bis er es findet? 5 Und wenn er es findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern 6 und geht nach Hause, ruft die Freunde und die Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein verlorenes Schaf gefunden. 7 Ich sage euch: So wird man sich auch im Himmel mehr freuen über einen Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die keiner Umkehr bedürfen. (Zürcher Bibel 2007)
Vom Suchen und Finden des Verlorenen, dieses Gleichnis ist mir im Moment so nahe wie kein anderes im Neuen Testament.
Wer ein- oder mehrmals mit seinem gesamten Hausrat umgezogen ist, weiß, wovon ich rede. Erst gestern habe ich verzweifelt meine Fahrrad-Luftpumpe gesucht.
99 andere Dinge begegneten mir bei meiner Suche, aber nicht die eine Luftpumpe.
99 andere Dinge waren völlig uninteressant für mich, interessant war die eine Luftpumpe. Nicht dass ich dringend Luft in meine Reifen hätte pumpen müssen. Nein, interessant war die Luftpumpe vor allem, weil ich fürchtete, sie sei zwischen all’ den anderen Dingen in den Umzugskartons verloren gegangen.
Und weil ich sie mag. Sie ist nämlich einzigartig, meine Luftpumpe, so eine alte mit einem Metallschaft und einem Holzgriff, wie man sie heute nur noch selten bekommt.
Und als ich sie dann endlich fand, meine Luftpumpe, – natürlich im letzten Karton, wo auch sonst –, da war die Freude groß, geradezu himmlisch groß.
Dass es gerade die Verlorenen sind, verlorene Dinge und verlorene Menschen, an denen wir besonders hängen, dass wir gerade nach ihnen besonders intensiv suchen, das ist die Pointe von Jesu Gleichnis.
Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die mit Jesus streiten, die eine Art Generalkritik an seinem Verhalten äußern, stoßen sich ja daran, dass diejenigen, die zu Jesus kommen, um ihn zu hören, nicht den moralischen Standards der Zeit entsprechen. Und viel mehr noch stoßen sie sich daran, dass Jesus diese Menschen aufnimmt, ihr Gastgeber wird und mit ihnen isst.
Pharisäer und Schriftgelehrte auf der einen Seite, Zöllner und Sünder auf der anderen Seite, so verlaufen die Frontlinien hier. In der Vergangenheit hat man aus dieser Frontlinie oftmals eine gemacht, die angeblich zwischen Juden und Christen verläuft. Hier die gesetzestreuen Juden, die ihr Heil vor Gott mit guten Werken erwirken wollen, dort Jesus, der die Sünder annimmt.
In Wahrheit ist das Streitgespräch zwischen Jesus und den Pharisäern, dessen Zeugen wir werden, zunächst einmal eine innerjüdische Debatte über das Verständnis von Sünde. Wie könnte es auch anders sein, denn schließlich war Jesus ja Jude.
In dieser innerjüdischen Debatte nimmt Jesus dann allerdings eine Position ein, die wegweisend geworden ist, und die wir doch auch für uns als christliche Kirche immer wieder neu entdecken müssen.
Sünde, das ist nicht irgendein Normverstoß, irgendein Vergehen aus dem Lasterkatalog. Zugegeben: Lang ist die Geschichte des Moralismus auch in der Kirche. Doch länger und nachhaltiger ist hoffentlich die Geschichte der Befreiung von solchem Moralismus.
Sünde, das ist nach Jesu Gleichnis ein Zustand der Verlorenheit. Ein Zustand, der viele Gestalten annehmen kann. Eine Gestalt der Verlorenheit kommt in der Bibel ins Spiel, sobald von Zöllnern die Rede ist, wie hier am Beginn des Gleichnisses vom verlorenen Schaf. Der Zöllner ist Inbegriff des gierigen Unternehmers, sozusagen die „Heuschrecke“ des Neuen Testaments. Er steht für einen Menschen, der sich an seinen Reichtum verloren hat, der dem Geld dienen muss.
Und das Geld ist ein harter Herr. Wer ihm dienen muss, hat nichts zu lachen.
Das zeigt auf ihre Weise ja auch die antike Sage vom König Midas. Der mächtige König Midas hatte einen Wunsch: Er wollte, dass alles, was er berührt, zu Gold wird. Da ihm der Gott Dionysos noch einen Gefallen schuldete, erfüllte er Midas' Wunsch.
Und tatsächlich: Alles was Midas berührte, wurde zu reinem Gold!
Brach er einen Zweig vom Baum, wurde er zu Gold, hob er einen Stein vom Boden auf, wurde er zu Gold. Der König war überglücklich.
Doch dann kam das böse Erwachen: Hungrig und durstig setzte sich Midas an den gedeckten Tisch. Doch kaum berührte er das Brot, wurde es zu Gold. Kaum nahm er einen Schluck aus seinem Becher, hatte er flüssiges Gold im Mund.
Der König drohte zu verhungern und zu verdursten.
Doch Dionysos war gnädig und schickte ihn zum Fluss Paktolos. Dort sollte er den Zauber abwaschen.
Das Bad half tatsächlich. Midas konnte wieder essen und trinken, und es wird erzählt, dass im Fluss Paktolos seitdem Gold zu finden ist.
Jesus nimmt Zöllner und Sünder in die Gemeinschaft mit sich auf und isst mit ihnen. Er legt sie nicht auf ihre Vergehen fest, sondern sieht ihre Verlorenheit, ruft sie in eine lebendige Gemeinschaft. In eine heilende Gemeinschaft, die sich hat befreien lassen von dem Zwang, immer mehr anhäufen zu müssen.
Die Menschen nicht auf ihre Defizite festlegen, sondern ihren Schmerz sehen, ihre Verlorenheit ernst nehmen, sie in die Gemeinschaft mit Gott und untereinander rufen, das ist auch unsere Aufgabe als Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder. Dabei ist Jesu Gleichnis auch ein Korrektiv gegen überzogene Wachstumsphantasien im Hinblick auf unsere Kirche. Phantasien, die gut gemeint sind, uns am Ende aber möglicherweise überfordern.
Es ist ein Einzelner, der durch seine Verlorenheit im Mittelpunkt des Gleichnisses steht, nicht die große Masse. Das sollte uns Mut machen, gerade da, wo wir als Kirchengemeinde nach außen strahlen wollen in unsere Stadtteile, wo wir den Grund unserer Hoffnung deutlich machen wollen, wo wir vom offenen Himmel erzählen wollen.
Vom offenen Himmel, in dem Freude herrscht über einen Einzelnen, der aufbricht, der Gemeinschaft mit Gott und den Menschen findet, mehr Freude als über 99 andere, die lieber für sich bleiben wollen und niemanden brauchen.
Wir dürfen uns über jeden freuen, der in unsere Gottesdienste kommt, der Teil unserer Gemeinschaft sein möchte. Freuen wir uns doch einfach über den einen, die eine, die kommt, anstatt uns über die 99 anderen zu ärgern, die nicht kommen!
In den knapp zwei Wochen, in denen wir jetzt hier mit ihnen und unter ihnen leben, habe ich schon viel Aufbruchstimmung gespürt. Und ich finde das ganz wunderbar. Ich spüre den guten Willen so vieler Menschen, gemeinsam etwas anzupacken und die Evangelische Kirchengemeinde Düsseldorf-Unterrath weiter zu entwickeln.
Lasst uns bei allem, was wir anpacken und planen, eine Sache vor Augen nie vergessen:
Wir sind und bleiben, wenn man es mit der theologischen Tradition sagen will, „begnadigte Sünder“.
Oder anders gesagt: Wir sind Verlorene, die gefunden wurden und sich auch immer wieder neu finden müssen.
Wir sind ja keine Gemeinschaft der Perfekten, das müssen wir auch gar nicht sein. Und ich sage das ganz bewusst als Coaching-Fan und Anhänger von Optimierungsprozessen: Solange es die Menschheit gibt, sind Fehler gemacht worden. Und es werden auch in Zukunft Fehler gemacht werden.
Doch Gott sei Dank hängt das Reich Gottes nicht daran, dass wir keine Fehler machen, sondern an Gottes Wirken. Darum sind wir Menschen, die zur Freude am Leben befreit sind, zum Dienst aneinander und an der Stadt, in der wir leben.
„Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen.“
Aus diesem Vorwurf an die Adresse Jesu hat die Kirche Gott sei Dank eine Tugend gemacht.
Das Beste ist ja, dass man das Reich Gottes nicht nur herbeipredigen und –beten, sondern auch herbeiessen und –trinken kann.
Und weil wir das gleich im Anschluss an diesen Gottesdienst ja auch noch tun wollen, deshalb schließe ich jetzt schleunigst.
2. Vom klugen Verwalter
Lukas 12,42-48
Der Monat November mit seinen ernsten Feiertagen, mit der Sitte des Friedhofsbesuchs und des Totengedenkens färbt die herbstlich goldene Stimmung dieser Tage trüb ein.
Am heutigen Ewigkeitssonntag gedenken wir der Verstorbenen aus unserer Gemeinde. Unsere Gedanken sind bei denen, von denen wir Abschied nehmen mussten. Erinnerungen steigen auf, die uns mit Menschen verbinden, Erinnerungen an schwere Zeiten und traurige Momente, aber auch Erinnerungen an glückliche Augenblicke und schöne Zeiten. Beides gehört zum heutigen Tag. In diesem Gottesdienst treten wir mit all’ diesen Gedanken und mit dem manchmal schwer entwirrbaren Durcheinander von Gefühlen vor Gott.
Der Ewigkeitssonntag erinnert uns aber auch daran, dass wir selbst einmal sterben müssen. Ein „Memento mori“, eine Erinnerung an unsere eigene Sterblichkeit ist dieser Tag. Und so brauchen wir beides: Trost angesichts des Todes lieber Menschen und Weisung für uns selbst, die wir noch leben.
„Seid auch ihr bereit“, so lautet die Weisung Jesu an seine Jünger. Doch für wen sollen wir uns bereiten? Nicht einfach für den Tod. In der Gleichniserzählung aus dem Lukasevangelium wird unser „Memento mori“, die Erinnerung an unsere eigene Sterblichkeit, in eine neue Richtung gelenkt: „Der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr’s nicht meint“ (Lk 12,40). Damit gibt Jesus uns zugleich einen Schlüssel für das Gleichnis, das der Evangelist Lukas erzählt:
42 Der Herr aber sprach: Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? 43 Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. 44 Wahrlich, ich sage euch: Er wird ihn über alle seine Güter setzen. 45 Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, 46 dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er's nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. 47 Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. 48 Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. (Lutherbibel 1984)
„Seid auch bereit“, damit bereitet Jesus seine Jüngerinnen und Jünger nicht einfach auf den Tod vor, sondern auf das Kommen des Menschensohns. An einem Tag wie heute, da wir unserer Verstorbenen gedenken, da wir auch über unsere eigene Sterblichkeit nachdenken, irritiert mich Jesu Gleichniserzählung zunächst einmal. Denn es geht in ihr vordergründig weder um unsere Verstorbenen noch um unser eigenes Ende. Fast scheint es mir, als wolle da jemand unter der Hand das Thema wechseln. Doch ich will mich auf diesen Perspektivwechsel einlassen und folge der Spur des Menschensohns und frage: Was hilft uns der Menschensohn angesichts unserer Trauer und unserer Angst?
Der Menschensohn, das ist Jesus Christus selbst. Jesus Christus, der gelebt hat und gestorben ist, den Gott von den Toten auferweckt hat und der nun in neuer Gestalt, im Geist, wirksam und mächtig unter uns ist.
Der Menschensohn, das ist Jesus Christus selbst, der immer wieder in Erscheinung tritt, der uns zu seiner Gemeinde erwählt hat, der uns ruft und in die Welt sendet.
Der Menschensohn, das ist Jesus Christus selbst, der am Ende der Zeit für alle Menschen sichtbar in Erscheinung tritt als derjenige, der dem Tod schon längst die Macht genommen hat.
„Seid auch ihr bereit!“ Mit dieser Weisung reißt Jesus unseren Horizont auf. Unseren Horizont, der durch den Tod geliebter Menschen und durch unseren eigenen Tod verschlossen war. Es kommt der Menschensohn, nicht einfach nur das Ende. Wer den Menschensohn erwartet, der gewinnt einen neuen Blick auf die Zeit, die uns noch bleibt. Es ist Zeit, die wir im Vertrauen auf Gott und in der Nachfolge Jesu Christi leben und wirken dürfen.
Für mich ist dieses Vertrauen eine Quelle, aus der ich Kraft schöpfe. Kraft für die zahlreichen Abschiede, von denen unser Leben durchdrungen ist. Kraft, mich den Abschieden im eigenen Leben bewusst zu stellen, um frei zu werden für Neues.
Wir werden geboren, verbringen die Jahre der Kindheit und Jugend, werden erwachsen. Als erwachsene Frauen und Männer gestalten wir unser Leben, reifen, werden stark, erreichen den Höhepunkt unserer Lebensmöglichkeiten. Im Alter werden unsere Möglichkeiten weniger, bis wir sterbend diese Welt verlassen. Unser Leben ist geprägt von dauerndem Verlassen und Neubeginnen. Ständig müssen wir uns auf Veränderungen einlassen, müssen loslassen und uns neu orientieren. Und in jedem dieser kleinen Abschiede steckt eine Ahnung von dem großen Abschied, der uns allen einmal bevorsteht.
Diese Abschiede bewusst wahrzunehmen, sie zu bejahen und zu gestalten, anstatt sie zu verdrängen, das kann sehr verschiedene Formen annehmen.
Der vor 20 Jahren verstorbene schweizerische Schriftsteller Max Frisch hatte im Garten seines Ferienhauses im Tessin eine Bank. Auf dieser Bank saß eine von ihm selbst hergestellte Figur, einer Vogelscheuche nicht unähnlich. Diese Figur stellte den Tod dar. Von Zeit zu Zeit nahm Frisch auf dieser Bank Platz und trank mit dem Tod ein Glas Wein.
Dem einen oder anderen mag das makaber vorkommen, aber es war für diesen Menschen eine Möglichkeit, bewusst zu leben im Angesicht der vielen kleinen und des einen großen Abschieds, die zu unserem Leben gehören.
Wir brauchen wohl solche Rituale, mit denen wir Lebenskunst auch angesichts des Todes einüben. Es müssen ja nicht gleich derartig originelle Rituale sein wie das Glas Wein mit dem Tod. Vielen Menschen hilft es auch, heute ganz einfach die Gräber ihrer Verstorbenen zu besuchen, Blumen oder Lichter mitzunehmen und noch einmal an die vergangenen Zeiten zu denken.
Dabei dürfen auch die „anderen“ Gefühle, die nicht nur friedvoll und dankbar sind, eine Rolle spielen. Gefühle wie Hass und Verzweiflung, Wut und Anklage oder auch Schuldgefühle. Wir dürfen sie zulassen, vor uns selbst und auch anderen Menschen, denen wir vertrauen. Manchen Menschen hilft es, diese Gefühle einmal auf einen Zettel aufzuschreiben, sie sich von der Seele zu schreiben. Vielleicht behalten sie diesen Zettel, vielleicht werfen sie ihn aber auch anschließend weg oder verbrennen ihn sogar. Das alles sind Möglichkeiten, mit dem Schmerz des Abschieds umzugehen.
„Seid auch ihr bereit!“, so ruft Jesus uns auf, ruft uns zum Vertrauen auf Gott und in seine Nachfolge. Das Gleichnis verschweigt dabei nicht die harte Wahrheit, dass wir die Zeit, die uns bleibt, auch nutzlos verstreichen lassen können. Ja, denen die das tun, wird sogar Strafe angedroht. Diese Seite des Gleichnisses ist mir fremd. Und doch liegt vielleicht auch in diesem Fremden eine Wahrheit.
Die Wahrheit, dass derjenige, der vor den Abschieden dieses Lebens immer nur flieht, sie immer nur verleugnet, sich selbst keinen Gefallen tut. Wer davonläuft, sich immer nur ablenkt, den treffen die Abschiede unvorbereitet und umso härter.
„Seid auch ihr bereit!“ Vertraut dem Menschensohn, der kommt. Vertraut Gott, dem Schöpfer und Erlöser eures Lebens. Die Kraft dieser Hoffnung wird euch in den Abschieden dieses Leben tragen. Ob wir am Ende unseres Lebens dann Lob empfangen, wie der kluge Verwalter im Gleichnis, das weiß ich nicht. Vielleicht ist das aber gar nicht entscheidend, ob am Ende unseres Lebens eine lobenswerte Bilanz steht. Mir jedenfalls ist wichtiger, dass ich hoffen darf: Da kommt einer, den ich kenne, der mich bei meinem Namen gerufen hat, der mich in den Abschieden meines Lebens schon begleitet hat, der nimmt mich am Ende an.
3. Gemeindehaus a.D.
1. Könige 8,23-29b.57-61
Wir treffen uns heute hier zu einer Andacht anlässlich der Außerdienststellung dieses Gemeindehauses. Der Anlass, aus dem wir uns treffen, ist demnach alles andere als freudig und heiter. Im Vordergrund stehen Trauer über Veränderungen in der Kirchengemeinde, die als ungerechtfertigt, zum Teil sicherlich auch als ungerecht empfunden werden. Und zur Trauer kommt Wut hinzu bei denen, die sich im Moment als Leidtragende dieser Veränderungen sehen.
Und nun wird also auch noch gesungen, gebetet und aus der Bibel gelesen. Sofort steht der Verdacht im Raum, es solle dem, was als ungerecht empfunden wird, ein frommes Mäntelchen umgehängt werden, der Skandal solle unter den geistlichen Teppich gekehrt werden. Ich kann diesen Verdacht nicht widerlegen, schon gar nicht in dieser Andacht. Ich kann und will sie aber um etwas bitten. Ich will sie bitten, den Formen und Inhalten unseres Glaubens, unseren Gottesdiensten und dem Evangelium, auch in diesen schwierigen Zeiten eine Chance zu geben.
Denn wenn wir im Kampf um Gebäude unseren Glauben verlieren, dann verlieren wir weit mehr als ein Gemeindehaus oder einen kirchlichen Standort, dann verlieren wir uns selbst. Wenn das so wäre, dann bliebe am Ende nichts als die Sprache der finanziellen Fakten. Und davon geht tatsächlich kein Heil aus. Genauso wenig wäre es heilvoll, diese Fakten zu ignorieren. Darum wird auch heute aus der Bibel gelesen, und zwar nicht irgendein Text, sondern einer, der zur Sache gehört, ja der uns hilft, die Sache, die zur Debatte steht, überhaupt erst in den Blick zu nehmen.
Denn schon in der Bibel geht es um Gebäude, vor allem ums eins, nämlich den Tempel in Jerusalem. Und auch damals waren Gebäude umstritten. Hören wir also aus dem 1. Buch der Könige im 8. Kapitel die Verse 23-29, den ersten Teil von Salomos Gebet zur Tempelweihe. Salomo sprach:
23 HERR, Gott Israels! Kein Gott ist dir gleich, nicht oben im Himmel und nicht unten auf der Erde. Den Bund und die Treue bewahrst du deinen Dienern, die mit ganzem Herzen vor dir gehen, 24 der du deinem Diener David, meinem Vater, gehalten hast, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es zugesagt, und durch deine Hand hast du es erfüllt, wie am heutigen Tag. 25 Und nun, HERR, Gott Israels, halte deinem Diener David, meinem Vater, was du ihm zugesagt hast, da du gesprochen hast: Es soll dir vor mir nicht fehlen an einem Nachfolger, der auf dem Thron Israels sitzt, wenn nur deine Söhne acht haben auf ihren Weg und vor mir gehen, wie du vor mir gegangen bist. 26 Und nun, Gott Israels, lass doch dein Wort wahr werden, das du zu deinem Diener David, meinem Vater, gesprochen hast. 27 Aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Sieh, der Himmel, der höchste Himmel kann dich nicht fassen, wie viel weniger dann dieses Haus, das ich gebaut habe! 28 Wende dich dem Gebet deines Dieners zu und seinem Flehen, HERR, mein Gott, und erhöre das Flehen und das Gebet, das dein Diener heute vor dir betet, 29 damit in der Nacht und bei Tag deine Augen offen sind über diesem Haus, über der Stätte, von der du gesagt hast: Dort soll mein Name sein. (Zürcher Bibel 2007)
Salomo hat den Tempel in Jerusalem erbaut. Er hat damit etwas in die Tat umgesetzt, was Gott zuvor seinem Vater David versprochen hatte.
Einen Tempel bauen, das kann man nur in Friedenszeiten. Nur im Frieden gibt es überhaupt Geld dafür. Dass also Salomo der Bau des Tempels gelungen ist, weist auf eine Periode des Friedens hin, auf eine gute Zeit, auf eine Zeit, in der die Treue Gottes zu seinem Volk spürbar gewesen ist durch Frieden und Wohlstand.
Wer Tempel, Kirchen und Gemeindehäuser baut, der kann dies überhaupt nur, weil Gott treu ist und in seiner Treue die Voraussetzungen für diese Häuser schenkt. Wir leben als Gemeinde von Gottes Treue. Es greift bei weitem zu kurz, wenn wir so tun, als lebten wir von der Kirchensteuer. Das mag bei oberflächlicher Betrachtung so aussehen. Aber in der Tiefe unserer Existenz als Gemeinde leben wir von der Treue Gottes, leben wir davon, dass Gott uns zum Glauben beruft und uns Möglichkeiten schenkt, sein Wort zu hören und in seiner Liebe zu leben.
Salomo weiß sehr genau, wir leben von Gottes Treue. Und darum sagt er auch nicht einfach: Danke für dieses Haus, aber jetzt nehmen wir die Sache mal in unsere Hände, jetzt geht’s los mit unserer Arbeit, sondern er bittet Gott: Lass dein Wort wahr werden, bleib bei uns als der Gott, der in seinem Namen ansprechbar ist für uns, der uns hört und zu uns spricht, der mit uns geht auf unseren Wegen und uns leitet.
Und weil Salomo so genau weiß, es kommt zuerst und zuletzt auf Gott selbst an, darum formuliert er bei der Einweihung des Tempels einen deutlichen Vorbehalt und trägt diesen Vorbehalt sogar vor Gott im Gebet:
„Sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Sieh, der Himmel, der höchste Himmel kann dich nicht fassen, wie viel weniger dann dieses Haus, das ich gebaut habe!“
In dieser Einsicht zeigt sich die ganze Lebensklugheit des sprichwörtlich weisen Königs Salomo.
Ich formuliere diese Einsicht mit Blick auf uns heute so:
Gott hat uns damals dieses Haus geschenkt. Und er hat uns mit diesem Haus Jahre und Jahrzehnte des Friedens und des Wohlstands geschenkt. Jahre, in denen wir gelebt und gefeiert, gelacht und getanzt und manchmal auch bitter geweint haben. Aber es waren gute Jahre, die wir hier verbringen konnten. Jahre, auf die wir heute nicht im Zorn, sondern voller Dankbarkeit zurückschauen können.
Voller Dankbarkeit auch deshalb, weil wir wissen, dass Gott und sein Haus nicht ein und dasselbe sind. Der Tempel in Jerusalem konnte Gott nicht fassen, dieses Gemeindehaus konnte Gott nicht fassen, ja selbst der höchste Himmel kann Gott nicht fassen.
Deswegen bleibt Gott da, auch wenn wir uns vom Gemeindehaus verabschieden. Er bleibt da, und er kommt mit seinem Wort und in der Kraft seiner Liebe. Und weil wir so unterscheiden können zwischen Gott und seinem Haus, darum legen wir das, was wir damals von Gott als Zeichen seiner Treue empfangen haben, heute zurück in seine Hände.
Was wir miteinander erlebt haben hier in diesem Haus, die Geschichten, die sich zwischen diesen Wänden ereignet haben, die Lebenserfahrungen, die Erfahrungen von Gemeinschaft aus vielen Jahrzehnten, die gehören zu unserem Leben, die behalten ihre Gültigkeit, auch wenn wir jetzt als Gemeinde weiterziehen.
Gott ist größer als dieses Haus, und unser eigenes Leben ist auch größer als dieses Haus.
Und darum werden wir jetzt Abschied davon nehmen und unsere Aufmerksamkeit neu auf die Mitte unseres Glaubens richten, auf Gott selbst, der uns zu seiner Gemeinde sammelt und in die Welt sendet – auch in die Welt jenseits dieser Mauern.
Unsere Aufmerksamkeit auf die Mitte unseres Glaubens zu richten, darum geht es auch am Schluss von Salomos Tempelweihgebet. Es endet mit der Bitte um Gottes Gegenwart. Salomo spricht: