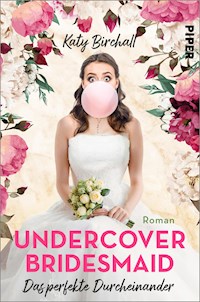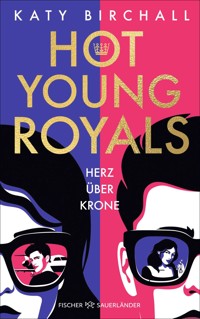
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Kleider? Haute Couture. Klassenkameraden? Londons Elite. Partys? Skandalös! Nach dem Tod ihrer Mutter wird Ruby vom ruhigen Landleben in die glitzernde Welt der Londoner Oberschicht katapultiert. In ihrer neuen Schule Clairmont Hall werden die Flure von der Elite beherrscht, einer Gruppe, die nicht nur aus den Reichsten Londons besteht, sondern auch aus echten Royals – darunter Prinzessin Caroline, die Gerüchten zufolge dem schillernden Herzog Xavier versprochen sein soll. Ruby fragt sich, ob es das ist, was er wirklich will … Doch während Ruby noch versucht, ihr neues Leben und ihren neuen Schwarm unter einen Hut zu bringen, kommt das Geheimnis ihres Lebens ans Licht … Eine glitzernde Geschichte über Familie, Identität und Liebe in der Londoner High Society - »Plötzlich Prinzessin« trifft »Gossip Girl« trifft »Made in Chelsea« - Geheimnisse, Romance und jede Menge royaler Gossip: coole Rom-Com ab 14 Jahren - Mit den Tropes Fake-Dating, Royals und Secret Identity
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Katy Birchall
Hot Young Royals
Herz über Krone
Über dieses Buch
Kleider? Haute Couture. Klassenkameraden? Londons Elite. Partys? Skandalös!
Nach dem Tod ihrer Mutter wird Ruby vom ruhigen Landleben in die glitzernde Welt der Londoner Oberschicht katapultiert. In ihrer neuen Schule Clairmont Hall werden die Flure von der Elite beherrscht, einer Gruppe, die nicht nur aus den Reichsten Londons besteht, sondern auch aus echten Royals – darunter Prinzessin Caroline, die Gerüchten zufolge dem schillernden Herzog Xavier versprochen sein soll. Aber Ruby fragt sich, ob es das ist, was er wirklich will … Doch während Ruby noch versucht, ihr neues Leben und ihren neuen Schwarm unter einen Hut zu bringen, kommt das Geheimnis ihres Lebens ans Licht …
Eine glitzernde Geschichte über Familie, Identität und Romantik in der Londoner High Society
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischer-sauerlaender.de
Biografie
Katy Birchall lebt nach einem Studium der Englischen Literatur- und Sprachwissenschaft wieder in ihrem Geburtsort London, England, und ist als Schriftstellerin und freiberufliche Journalistin tätig. Mit der Serie Plötzlich It-Girl gelang Birchall ihr erfolgreiches Debüt als Jugendbuchautorin und trifft auch als Autorin für Kinder (Emma Charming) und Erwachsene (Undercover Bridesmaid) gleichermaßen den richtigen Ton. Katy Birchall liebt ihren Hund Bono, begeistert sich für Marvel-Comics ebenso wie für Jane-Austen-Romane und würde zu gerne einmal als Elfe die magische Welt aus Der Herr der Ringe hautnah erleben.
Verena Kilchling, 1977 in Freiburg im Breisgau geboren, studierte Literaturübersetzen an der Uni Düsseldorf und arbeitet seit ihrem Abschluss als freie Übersetzerin aus dem Englischen und Spanischen. Im Kinder- und Jugendbuchbereich hat sie unter anderem die Werke von Liz Pichon und Katy Birchall (Moon & Midnight, Emma Charming) übertragen. Sie lebt mit ihrem Partner und zwei Kindern in München.
Impressum
Zu diesem Buch ist beim Argon Verlag ein Hörbuch erschienen, das als Download und bei Hörbuch-Streamingdiensten erhältlich ist.
Erschienen bei Fischer Sauerländer E-Book
Die englische Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel
Hot Young Royals bei Scholastic, Warwick
Text © Katy Birchall, 2025
Cover © Nastka Drabot, 2025
The moral rights of the author and illustrator have been asserted by them.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2025, Fischer Sauerländer GmbH, Hedderichstraße 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Dahlhaus & Blommel Media Design, Vreden, unter Verwendung einer Illustration von Nastka Drabot und nach einer Idee von Scholastic UK
Coverabbildung: Nastka Drabot
ISBN 978-3-7336-0983-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
Dank
Für alle, die manchmal daran erinnert werden müssen, dass sie Prinzessinnen sind – egal, was die anderen sagen.
Prolog
Alfred steht da und lauscht dem Donnern, das aus der Ferne herüberdringt.
Seit er am Morgen aufgewacht ist, plagt ihn das Gefühl, dass etwas Schreckliches passieren wird. Das Wetter scheint seine Befürchtungen zu bestätigen: Gegen Mittag sind dunkle, regenschwangere Wolken aufgezogen, und am Abend hat es angefangen zu schütten wie aus Kübeln. Jetzt verheißt das tiefe, finstere Grollen ein nahendes Gewitter.
Von seinem Platz am Fenster blickt er aufs Meer hinaus.
Normalerweise stört sich Alfred nicht an schlechtem Wetter – er ist in England aufgewachsen und daran gewöhnt –, zumal es etwas Behagliches hat, wenn man im Inneren eines Hauses ist, während jenseits der Fensterscheiben ein Sturm tost. Aber heute bringt ihn das Wetter zum Frösteln. Die italienische Villa, sonst sein Ort der Ruhe, an den er sich vor dem Trubel seines öffentlichen Lebens flüchtet, kommt ihm kalt und bedrückend vor. Irgendetwas stimmt nicht.
Erst rückblickend wird sich Alfred II, König von Großbritannien und Nordirland, eingestehen, dass das Gefühl, das ihn beschlichen hat, Angst ist. Er zuckt zusammen, als es plötzlich an der Tür klopft, und ruft, ohne zu zögern, »Herein!«, obwohl seine Familie und seine Bediensteten wissen, dass der Zutritt zu seinem Büro zu derart später Stunde untersagt ist.
Die groß gewachsene, hagere Gestalt von Jonathan, dem Privatsekretär und intimsten Vertrauten des Königs, erscheint im Türrahmen.
Er neigt den Kopf. »Eure Majestät«, sagt er.
»Was gibt es denn?«, antwortet Alfred in scharfem Ton.
Jonathan holt tief Luft. Er sieht aus, als müsse er sich innerlich wappnen, was seltsam ist, denn er ist geübt darin, jede Gefühlsregung zu verbergen. In seiner Stimme liegt stets ein feierlicher Ernst, wenn er Neuigkeiten überbringt, was manchmal für ungewollte Komik sorgt – wie damals, als er es bedauerte, Seiner Majestät mitteilen zu müssen, dass ein Erzbischof für Verstimmung gesorgt habe, »indem er den Premierminister für alle vernehmbar einen – ich zitiere – ›langweiligen alten Knacker‹ genannt« habe.
Der König hatte daraufhin keine Miene verzogen, obwohl es ihm schwergefallen war, nicht wenigstens zu schmunzeln.
Die heutige Botschaft ist eindeutig keine heitere.
»Es tut mir leid, dass ich Sie so spät noch stören muss, aber ich dachte mir, Sie würden sicher sofort erfahren wollen, dass …« Jonathan zögert, und sein Stirnrunzeln vertieft sich. »… Eleanor Carter gestorben ist.«
Genau in diesem Moment zeugt ein lautes Donnern vom Näherrücken des Gewitters.
Für einen kurzen Moment senkt der König den Kopf. Er weiß nicht, warum, aber ihn durchzuckt eine sehr konkrete Erinnerung: Eleanor, wie sie als junges Mädchen mit ihren rabenschwarzen Haaren auf der Fensterbank der Schulbibliothek von Clairmont Hall kauert, einen Zettel zerknüllt und damit nach ihm wirft. Sie grinst verschmitzt, als sie ihn mitten auf die Stirn trifft.
Warum muss er ausgerechnet an diese unbedeutende Szene denken? Sie haben so viele Situationen gemeinsam erlebt, so vieles miteinander durchgestanden. Der damalige Tag hatte nichts Interessantes oder Spektakuläres an sich, jedenfalls nicht, soweit Alfred sich erinnern kann. Er weiß nicht mal mehr genau, warum Eleanor die Papierkugel nach ihm geworfen hat. Hatte er sie mit irgendetwas aufgezogen? Einen schlechten Witz gemacht? Einen dummen Kommentar von sich gegeben? Was auch immer es war, er hatte erreicht, worauf er gehofft hatte: ihr ein Lächeln zu entlocken.
Es kommt Alfred so vor, als hätte er während seiner Freundschaft mit Eleanor fast ununterbrochen versucht, sie zum Lachen zu bringen.
Wie eigenartig, dass er hier, an der Amalfiküste, von ihrem Tod erfährt. Ausgerechnet an ihrem gemeinsamen Ort, in jenem Haus, in dem sie das Gefühl hatten, sie selbst sein zu können. Eleanor war einer der wenigen Menschen gewesen, in deren Gegenwart sich Alfred nicht wie ein König fühlte, sondern wie ein junger Mann, der mit einem Mädchen zusammensitzt und sich grundlos kaputtlacht.
Wie er Eleanor vermisst hat in den letzten Jahren!
Auf das vorherige Donnern folgt ein greller Blitz.
Alfred hebt den Kopf und räuspert sich.
»Danke, Jonathan«, sagt er monoton, ohne jeden Ausdruck in der Stimme, eine Kunst, die er perfektioniert hat. Seit seiner Geburt vor vierundvierzig Jahren wurde ihm jeden Tag eingetrichtert, er müsse seine Gefühle verbergen. Schließlich ist er der König.
Nach fast zwanzig Jahren im Dienst ebenjenes Königs weiß Jonathan, wann ein Gespräch beendet ist. Mit einer letzten Verbeugung verlässt er den Raum und schließt rasch und lautlos die Tür hinter sich.
Sobald Alfred wieder allein ist, hebt er die antike Schreibtischuhr hoch, ein Geschenk seiner Mutter an seinen Vater. Die Uhr hat noch nie zum restlichen Stil der Villa gepasst, aber sie erinnert ihn an seine Eltern, weshalb er sie nie hat wegräumen lassen. Unter der Uhr verbirgt sich ein kleiner Schlüssel. Damit schließt Alfred die unterste Schublade seines Schreibtischs auf, in der er – unter einem Haufen Papieren – findet, wonach er sucht: einen alten Brief, auf dessen Umschlag nur ein einziges Wort steht.
Alfred.
Es ist ein Brief, dessen Inhalt das Potenzial hat, alles zu verändern.
1
Ich stehe wartend vor dem Bahnhof King’s Cross, als ein glänzend schwarzer Wagen vor mir hält. Offenbar bin ich im Weg. Ich packe den Griff meines Koffers, ziehe ihn ein Stück zurück und vertiefe mich wieder in mein Buch. Es ist ein Krimi, der in einem kleinen Dorf in England spielt, ähnlich dem, das ich gerade verlassen habe. In letzter Zeit lese ich nur noch Spannungsliteratur, weil meine Gedanken bei jeder anderen Lektüre zu schnell in die schreckliche Realität zurückkehren. Nur wenn ich ein Rätsel zu lösen habe, findet mein Kopf für eine Weile Ruhe.
Aus der schwarzen Limousine steigt jemand aus, und ich bin am Ende der Seite angekommen und blättere um.
Es ist müßig, in dem Meer aus umherhastenden Personen nach meiner Tante Ausschau zu halten, denn ich kenne sie zwar nicht gut, weiß jedoch immerhin, dass sie nie pünktlich kommt.
»Was Tabatha angeht, kann man sich nur auf eins verlassen: ihre Unzuverlässigkeit«, hat meine Mutter mir einmal vor längerer Zeit erklärt.
Die bisherigen Treffen mit meiner Tante kann ich an einer Hand abzählen, und sie ist tatsächlich jedes Mal zu spät gekommen. Mum war schon beeindruckt, dass sie überhaupt auftauchte.
»Ruby Carter?«
Obwohl der Chauffeur des luxuriösen schwarzen Wagens meinen Namen sagt und mir dabei direkt in die Augen sieht, glaube ich noch immer nicht, dass er wegen mir hier ist. Stattdessen schiele ich über meine Schulter, in der Annahme, dass es noch eine Ruby Carter gibt, die direkt hinter mir steht.
»Ruby Carter«, wiederholt er, diesmal mit mehr Nachdruck, als müsste er uns beide davon überzeugen, dass er bei mir richtig ist. »Ich habe den Auftrag, Sie abzuholen.«
Meine Hände mit dem Buch sinken nach unten. »Ich warte auf meine Tante.«
»Lady Tabatha ist leider verhindert. Sie hat mich darum gebeten, Sie zu ihr zu bringen.« Er tippt sich an die Kappe. »Ich bin Dean, ihr Fahrer. Es freut mich, Sie kennenzulernen.«
Ich mustere seine Uniform, von der Kappe bis zu den auf Hochglanz polierten Schuhen. Dann spähe ich zu dem Wagen, der hinter ihm steht.
»Geben Sie mir Ihr Gepäck«, fordert mich Dean auf, greift nach meinem Koffer und bietet an, auch den Rucksack zu tragen, der über meiner Schulter hängt.
»Den behalte ich lieber bei mir«, wehre ich ab und umklammere den Schulterriemen fester.
Verlegen warte ich ab, bis der Chauffeur mein Gepäck in den Kofferraum geladen hat und ums Auto herumgeeilt ist, um mit einem freundlichen Lächeln die hintere Tür für mich zu öffnen. Im Inneren der Limousine schlägt mir der sterile Geruch eines Neuwagens entgegen. Die Ledersitze sind makellos sauber, und ich habe das Gefühl, nicht richtig gekleidet zu sein für ein derart edles Interieur. Nervös stopfe ich meinen Rucksack in den Fußraum, aus Angst, er könnte schmutzig sein von der Zugfahrt und die Rückbank verunreinigen.
»Bereit zur Abfahrt?«, fragt Dean vom Fahrersitz und begegnet meinem Blick im Rückspiegel.
Ich umklammere mein Buch und nicke. Dann drehe ich den Kopf und schaue durch die getönte Fensterscheibe nach draußen, während wir uns in den Londoner Verkehr einfädeln.
Mum und ich haben zusammen überlegt, wo ich nach ihrem Tod leben soll. Es gibt nicht allzu viele Möglichkeiten – wer mein Vater ist, weiß ich nicht, und Mums Eltern sind schon vor langer Zeit gestorben. Es existieren also keine Großeltern mehr, die mich aufnehmen könnten. Infrage kommen eigentlich nur Mums Geschwister Spencer und Tabatha. Mit Spencer hat sich Mum noch nie gut verstanden, erst nach ihrer Diagnose haben sie sich wieder ein wenig angenähert.
Bleibt also Tabatha. Allerdings musste sie erst einmal ihre Zustimmung dazu erteilen, zu meinem Vormund ernannt zu werden. Ich war diesbezüglich nicht sehr zuversichtlich, denn Tabatha führt ein ziemlich hektisches, glamouröses Leben, in dem es keinen Platz für eine Siebzehnjährige zu geben scheint. Doch zu meiner Überraschung hat sie die Verantwortung für mich bereitwillig übernommen.
Mum war nicht weiter überrascht.
»Ihr hat schon immer die Vorstellung gefallen, eine jüngere Ausgabe von sich selbst heranzuzüchten«, murmelte sie mit Sorge in der Stimme. »Na ja, du brauchst sowieso nur noch für ein paar Monate einen Vormund, dann wirst du achtzehn. Meine Schwester weiß, dass es keine längere Verpflichtung ist. Zum Glück bist du schlau genug, dich nicht von diesem ganzen Blödsinn blenden zu lassen, auf den sie so scharf ist.«
»Du meinst, sie will eine ›Lady Ruby Carter‹ aus mir machen?«, witzelte ich.
Mum lachte. »Sie wird es auf jeden Fall versuchen.« Ein Anflug von Traurigkeit trat in ihr Gesicht, als sie hinzufügte: »Sie wird dafür sorgen, dass es dir an nichts fehlt. Mehr kann ich wohl nicht von ihr verlangen.«
Wir ließen das Thema schnell wieder ruhen. Ich sprach nicht gern über die Zeit, wenn Mum nicht mehr da sein würde. Das tue ich immer noch nicht, auch wenn diese Zeit jetzt gekommen ist.
Als sie damals, im Alter von siebenundzwanzig Jahren, mit mir schwanger wurde, lebte sie im Westen Londons, beschloss jedoch, aufs Land zu ziehen und mich allein in dem kleinen, idyllischen Dörfchen Bridsbury in der Grafschaft Wiltshire großzuziehen. Sie suchte sich eine Arbeit in einem schlecht laufenden Dorfladen, dessen Sortiment angeblich auf durchreisende Touristen ausgerichtet war. Irgendwann kaufte sie dem Inhaber seinen Laden ab und verwandelte ihn innerhalb kürzester Zeit in einen Erfolg, indem sie gründlich renovierte und ein Produktangebot schuf, das Touristen tatsächlich ansprach. Seither gab es in dem Laden köstliche regionale Erzeugnisse sowie die Werke einheimischer Künstler und Kunsthandwerker. Die Gemeinde liebte meine Mutter dafür.
Nicht viele Menschen hätten einfach so einen ganzen Laden samt Inventar aufkaufen können, aber meine Mum stammte aus einer wohlhabenden Familie. Sie war die jüngste Tochter des Grafen und der Gräfin von Milbourne und auf dem Familiensitz Milbourne Hall aufgewachsen, einem weitläufigen Landgut in Norfolk. Heute gehört es Mums Bruder Spencer und dessen Frau Unity, die dort mit ihren zwei Kindern leben. Als mein Großvater starb, erbte Spencer als ältestes Kind und einziger Sohn den Titel des Grafen von Milbourne und damit auch Haus und Hof. Meine Mutter und meine Tante bekamen zwar nicht den Landsitz zugesprochen, aber da mein Großvater nicht nur selbst über einigen Wohlstand verfügte, sondern auch eine reiche Aristokratin – meine Großmutter – geheiratet hatte, mangelte es ihnen nicht an Geld. Die eine residierte in einem herrschaftlichen Londoner Stadthaus, die andere hatte die finanziellen Möglichkeiten, einen Dorfladen zu erstehen und umzukrempeln.
Während Mum kaum Kontakt zu Spencer und seiner Familie pflegte, unterhielt sie mit Tabatha eine gewisse schwesterliche Beziehung, wenn auch keine enge. Wir besuchten Tabatha hin und wieder, aber ich hatte immer den Eindruck, dass die beiden Schwestern sich nicht wirklich verstanden, was bedeutete, dass jedes über reine Höflichkeitsfloskeln hinausgehende Gespräch in einem Streit endete. Mums diesbezügliche Taktik bestand darin, sich auf Small Talk zu beschränken. Wenn ich ehrlich bin, kann ich es Tabatha nicht verübeln, dass sie frustriert war. Man konnte Spaß haben mit Mum, denn sie war geistreich und temperamentvoll, aber sie konnte auch reserviert sein, sogar kühl. Sie ließ nur selten jemanden an sich heran und sah sich fast nie dazu veranlasst, sich für irgendetwas zu rechtfertigen. Ich schien der einzige Mensch zu sein, dem sie vertraute, und selbst mir erzählte sie kaum je von ihrer Vergangenheit, wie oft ich auch danach fragte. Sie verriet mir nicht einmal, wer mein Vater war, selbst dann nicht, als sie wusste, dass sie sterben würde.
»Da wären wir«, reißt mich der Chauffeur aus meinen Gedanken.
Ich lasse per Knopfdruck das Fenster herunter und spähe zu dem Haus hinauf, vor dem er geparkt hat. 18, Darlington Square, Knightsbridge. Mein Blick schweift über die großzügigen weißen Reihenhäuser, die den ruhigen Platz säumen, über die eleganten Säulen, die die glänzenden schwarzen Haustüren flankieren, die hohen Fenster mit ihren gepflegten, farbenfroh bepflanzten Blumenkästen. Nachdem ich das Fenster wieder geschlossen habe, lehne ich mich in meinen Sitz zurück und schließe die Augen.
Dean ist bereits ausgestiegen, um meinen Koffer auszuladen. Mir selbst fällt es schwer, mich in Bewegung zu setzen. Bis jetzt kam mir alles vollkommen surreal vor, aber jetzt sitze ich tatsächlich vor der Haustür meiner Tante im Auto und bin drauf und dran, ein neues Leben zu beginnen, an einem neuen Ort und mit neuen Menschen.
Mum, ich vermisse dich!
Die Wagentür geht auf, und Dean blickt erwartungsvoll zu mir herein.
»Brauchen Sie Hilfe?«, fragt er freundlich und streckt mir seine Hand hin.
»Es geht schon«, krächze ich und versuche damit vor allem, mich selbst zu überzeugen.
»Keine Eile. Lassen Sie sich ruhig Zeit.«
Nachdem ich tief Luft geholt habe, ziehe ich meinen Rucksack aus dem Fußraum und trete auf den Gehweg hinaus. Nervös schiebe ich mir eine Strähne meiner langen dunklen Haare hinters Ohr.
Alles an diesem Ort ist makellos – nicht eine schmutzige Treppenstufe ist zu sehen, nicht eine fleckige Fensterscheibe, nicht ein unpolierter Messingtürknauf. Sogar der Gehweg ist so sauber, dass ich befürchte, mit meinem Rollkoffer Streifen zu hinterlassen. Mir wird mit aller Deutlichkeit bewusst, dass ich ein verblichenes Band-T-Shirt, Jeans und mein Lieblingspaar Nikes trage. Bestimmt wirke ich zu verlottert für diese Gegend. Ich rechne jederzeit damit, dass irgendein Sicherheitsmensch auftaucht und mir sagt, ich solle verschwinden. Noch nie bin ich mir so fehl am Platz vorgekommen.
Auf der Straße ist alles leer und still, in Haus Nummer achtzehn hingegen nicht. Ich höre Musik und das gedämpfte Plaudern und Lachen von Gästen.
»Soll ich für Sie klingeln?«, fragt Dean, der sich vermutlich darüber wundert, dass ich mich noch keinen Zentimeter vom Fleck bewegt habe.
»Nein, schon gut. Danke, dass Sie mich abgeholt haben«, sage ich, nachdem mir meine Manieren wieder eingefallen sind. Ich will ihm den Griff meines Koffers abnehmen, aber er winkt ab.
»Den bringe ich gleich hinterher«, versichert er, tippt mit dem Finger auf meinen Koffer und weist mit dem Kinn zur Haustür.
Ich verstehe den Wink und zwinge mich, die Eingangsstufen hinaufzugehen und die Türklingel zu drücken.
Mühsam schlucke ich den Kloß in meiner Kehle herunter.
Die Tür geht auf, doch statt meiner Tante begrüßt mich ein großer Mann in einem dreiteiligen Anzug. Ich kenne ihn nicht, wohingegen er genau zu wissen scheint, wer ich bin.
»Willkommen zu Hause, Miss Carter«, sagt er und tritt beiseite. »Kommen Sie doch rein.«
Er wartet, bis ich an ihm vorbei in die große, helle, marmorglänzende Eingangshalle getreten bin, und fügt dann hinzu: »Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise von Wiltshire.«
»Ja, vielen Dank.«
Ich blicke zu dem gewaltigen Kristallleuchter hinauf, der über mir an der hohen Decke hängt. Geradeaus führt eine breite, geschwungene Treppe mit glänzendem schwarzem Geländer nach oben, und auf dem schweren runden Marmortisch, der danebensteht, sind in einer eleganten Vase rosa Rosen und Pfingstrosen arrangiert. Alles hier drinnen riecht blumig und teuer, als wäre ich in der Parfumabteilung eines Luxuskaufhauses gelandet.
»Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle: Ich bin Bennet, Lady Tabathas Butler«, sagt der Mann und neigt vornehm den Kopf, während Dean meinen Koffer hereinrollt und ihn hinter mir in der Eingangshalle abstellt, um sich eilig wieder zurückzuziehen. »Lady Tabatha hat derzeit Gäste, die Gesellschaft ist hinten im Garten. Ich werde Ihre Tante darüber informieren, dass Sie eingetroffen sind. Wenn Sie möchten, können Sie gern im Salon Platz nehmen, während Sie warten.« Bennet zeigt auf eine Tür zur Linken, aber ich antworte, dass ich lieber hier in der Eingangshalle bleibe. Ich bin viel zu nervös, um mich hinzusetzen. Der Butler macht auf dem Absatz kehrt und eilt davon.
Mein Magen krampft sich zusammen. Ich atme flach und flatternd aus.
Einige Minuten später tritt Tabatha durch eine Tür und rauscht quer durch die Eingangshalle auf mich zu, in einem fuchsiapinken Maxikleid, an den Ohren baumelnde Goldohrringe. Ihre glänzenden hellbraunen Haare sind zu einer eleganten Frisur hochgesteckt, und ihre Haut wirkt strahlend und frisch, ohne fettig auszusehen. Ihre blauen Augen sind mit Eyeliner umrandet, sodass sie noch größer und funkelnder wirken.
Mum und Tabatha haben sich nie besonders ähnlich gesehen, von ihren Augen einmal abgesehen. Auch Mum hatte blaue Augen. Doch während sie einen lässigen, unkonventionellen Kleidungsstil bevorzugte, liebt Tabatha den großen Auftritt und hinterlässt gern überall einen bleibenden Eindruck. Leger ist ein Fremdwort für sie. Jetzt kommt sie mit ausgestreckten Armen auf mich zu, in der Hand ein halb volles Champagnerglas.
Sie sieht aus wie eine glamouröse Theaterdiva aus einem Poirot-Krimi der Zwanzigerjahre.
»Darling!«, ruft sie und legt mir leicht die Hand auf den Arm, um mir links und rechts zwei Luftküsschen zu verpassen. Dann tritt sie zurück, um mich zu mustern. »Du siehst ja noch bleicher und elender aus als bei der Beerdigung, du armes Ding! Bestimmt hast du schreckliche Zeiten hinter dir. Wirklich ein Jammer, dass du nicht früher nach London reisen konntest. Wie ich sehe, hat sich eure Nachbarin mehr schlecht als recht um dich gekümmert, während du das Haus ausgeräumt hast.«
»Eigentlich war es total lieb von Lottie, dass sie …«, setze ich an.
»Die Hauptsache ist doch, dass du jetzt hier bist«, unterbricht mich Tabatha und lächelt voller Anteilnahme. »Ich habe Eleanor versprochen, dass ich gut auf dich aufpasse, und genau das habe ich vor. Fangen wir doch damit an, dass … BENNET!« Sie sieht sich nach ihrem Butler um und entdeckt ihn direkt hinter sich. »Ach, da sind Sie! Holen Sie Ruby doch bitte ein Glas Champagner. Und vergewissern Sie sich, dass es der Pol Roger ist, nicht dieser entsetzliche Fusel, den Baron Close mitgebracht hat. Ungenießbar, das Zeug!«
Während Bennet davoneilt, teilt sie mir verschwörerisch mit: »Der Baron hat einen unterirdischen Geschmack, der Ärmste. Aber ich will mir kein Urteil anmaßen, zumal ich weiß, dass JJ ganz vernarrt in ihn ist. Findest du nicht auch, dass Gastgeschenke eine Menge über den Charakter eines Menschen verraten? Das wird eine der ersten Lektionen, die ich dir als dein Vormund erteilen werde: Frag mich in puncto Marke und Jahrgang immer erst um Rat, bevor du ein Tröpfchen auf eine Party mitbringst.« Tabatha mustert mich von Kopf bis Fuß. »Ich denke, du solltest dich umziehen, bevor du dich zu uns gesellst. Meine Schuld – ich hätte dir sagen müssen, dass ich heute eine kleine Feier gebe, aber du weißt ja, wie schnell einem so etwas entfällt …«
»Tante Tabatha, ich …«
»Du lieber Himmel, nenn mich bloß nicht Tante!« Sie schnappt nach Luft und presst ihre freie Hand an die Brust. »Das klingt, als wäre ich uralt! Ich habe zu viel von meinem Vermögen in Botox investiert, um auch nur den Gedanken zuzulassen, dass ich einen Tag älter als vierzig aussehen könnte! Erschwerend hinzu kommt, dass ich nach der Schwester meines Vaters benannt wurde, die wir damals ›Tante Tabatha‹ genannt haben. Die Gute hatte die Angewohnheit, in den unpassendsten Momenten langatmige Gedichte vorzutragen. Insofern: einfach nur Tabatha, bitte.«
»Entschuldigung. Tabatha, ich …«
»Und auf keinen Fall Tabby«, fügt sie mit Nachdruck hinzu und zeigt mit ihrem Champagnerglas auf mich. »So hat mich Eleanor immer genannt, wenn sie mich auf die Palme bringen wollte. Zum Glück hat sie es sich später abgewöhnt, aber Spencer greift noch hin und wieder darauf zurück, um mich in die Schranken zu weisen. Dieser unausstehliche Trottel.«
»Tabatha«, versuche ich es erneut, während sie in einem Zug ihr Glas leer trinkt. »Ich bin nicht in der richtigen Stimmung für eine Party. Ich werde einfach auf mein Zimmer gehen und … mich eingewöhnen, falls das okay ist. Aber danke für das Angebot.«
Sie sieht mich mit schräg gelegtem Kopf an. »Ach, Darling, natürlich! Man vergisst so leicht, dass das alles« – sie macht eine ausschweifende Geste – »noch neu für dich ist! Der Gedanke, an einer Party teilzunehmen, überfordert dich bestimmt.«
»Es war ein langer Tag, und …«
»Wenn ich ehrlich bin, habe ich bis heute nicht verstanden, warum Eleanor dich gezwungen hat, mitten im Nirgendwo aufzuwachsen, fernab deiner Wurzeln«, fährt sie fort. »Für mich grenzt das an eine Verletzung der Sorgfaltspflicht.« Sie hält inne, um mir über die Haare zu streichen, bevor sie mit weicherer Stimme hinzufügt: »Du siehst ihr wirklich unglaublich ähnlich. Die glatten dunklen Haare, die kräftigen Augenbrauen … Ich weiß noch, wie sie als Jugendliche einmal verkündet hat, sie wolle sie schmaler zupfen, woraufhin unsere Mutter völlig hysterisch wurde und ihr verboten hat, sie anzurühren. Aber deine Augen sind anders … Lass mal sehen: grün. Ihre waren blau.«
Ich nicke stumm, weil ich mir noch nicht wieder zutraue, über Mum zu reden, ohne in Tränen auszubrechen.
Auch meine Tante scheint Mühe zu haben, sich zu sammeln. »Wir werden deiner Garderobe ein kleines Update verpassen müssen, du wohnst schließlich nicht mehr in Wiltshire. Aber keine Sorge: Wenn ich dich erst ein paar Wochen unter meinen Fittichen hatte, redet die ganze Stadt über dich. Überlass das nur mir. Bennet, da sind Sie ja! Würden Sie Ruby bitte ihr Zimmer zeigen?«
Bennet balanciert auf der einen Hand ein Silbertablett mit einem Champagnerglas und zeigt mit der anderen zur Treppe.
»Ich flitze jetzt wieder zurück zu meinen Gästen, ich hoffe, es macht dir nichts aus«, sagt Tabatha. »Fühl dich ganz wie zu Hause, Darling.« Sie lächelt und legt mir die Hand auf die Schulter. »Denn genau da bist du jetzt: zu Hause.« Mit diesen Worten dreht sie sich um und schwebt Richtung Garten davon.
Bennet versichert mir, dass mein Koffer nach oben gebracht wird, und geht in den ersten Stock voraus. Ich folge ihm mit matten Schritten, erschöpft von dem kurzen Gespräch mit meiner Tante. Nachdem der Butler mich einen Flur entlanggeführt hat, bleibt er vor einer Tür stehen und öffnet sie. Dahinter kommt ein geräumiges, helles Zimmer mit weiß gestrichenen Wänden, cremefarbenem Teppichboden und Doppelbett zum Vorschein, auf dem akkurat mehrere Zierkissen aus grauer Seide arrangiert sind. Ein schöner, eleganter und vor allem unpersönlicher Raum – das perfekte Gästezimmer.
»Ihr Champagner«, sagt Bennet und hält mir das Tablett hin.
»Danke«, erwidere ich schüchtern und nehme das Glas entgegen.
»Kann ich Ihnen außerdem noch irgendetwas bringen?«
»Nein, danke, ich habe alles.«
»Gut.« Er wendet sich zum Gehen. »Ich hole jetzt Ihr Gepäck. Wenn Sie doch noch etwas brauchen, zögern Sie nicht, mich zu rufen.«
Er schließt die Tür hinter sich. Als ich mein Champagnerglas auf dem Nachttisch abstelle, höre ich die Partygeräusche durchs Fenster heraufschallen. Ich lasse mich auf den Rand des Betts plumpsen, und die Tränen, die schon die ganze Zeit in meinen Augen brennen, quellen hervor und rollen mir über die Wangen.
Noch nie habe ich mich so allein gefühlt.
2
»BENNET!«
Ich hebe ruckartig den Kopf, als am nächsten Morgen Tabathas Stimme durchs Haus hallt. Ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, stellt Bennet ein Glas frisch gepressten Orangensaft vor mir ab.
Als er meine panische Reaktion bemerkt, erklärt er: »Ich vermute, Lady Tabatha braucht ihre übliche Bloody Mary.« Er eilt aus dem Speisezimmer und biegt zur Küche ab.
Kurz darauf höre ich Tabatha die Treppe herunterpoltern. Als sie in der Tür erscheint, ist meine gesamte Selbstbeherrschung nötig, damit ich nicht laut lospruste. Sie trägt einen langen salbeigrünen Morgenmantel aus Seide, flauschige Hausschuhe und eine riesige Sonnenbrille, die fast ihr ganzes Gesicht einnimmt. Ihre Haare sind um einen großen, satinbeschichteten Lockenwickler gerollt, der wie ein Heiligenschein ihr Gesicht umgibt.
»Mir ist STERBENSELEND zumute!«, jammert sie theatralisch, lässt sich in einen Stuhl sinken und vergräbt das Gesicht in den Händen. »Ich genieße meine Rolle als Gastgeberin wirklich sehr, aber sie verlangt mir alles ab, das muss ich schon sagen! Wo ist Bennet? BENNET!! Puh, was für eine Nacht! Ich hoffe, du hast besser geschlafen als ich, Ruby.«
»Ja, habe ich. Danke«, lüge ich.
In Wirklichkeit habe ich kaum ein Auge zubekommen. Es war eine Mischung aus Heimweh, Beklemmung und Trauer, die mich wach gehalten hat.
Aber die Kissen waren sehr bequem.
»Womit habe ich ein solches Elend verdient? Mein Kopf dröhnt, und mir ist speiübel«, stöhnt Tabatha und wird erst munterer, als sie Bennet mit einem professionell aussehenden blutroten Cocktail hereinkommen sieht. »Ach, GOTT sei Dank! Ruby, falls du auch mal zu tief ins Glas schaust und es am nächsten Morgen bereust, musst du Bennet sofort damit beauftragen, einen seiner Katerbekämpfungsdrinks zu mixen. Er ist ein Genie! Ich persönlich bin ein großer Fan seiner Bloody Mary – die beste von ganz London, und es will etwas heißen, wenn ich das sage!«
Sie nimmt dankbar ihr Glas entgegen und trinkt einige Schlucke daraus, bevor sie es vor sich abstellt und tief und erleichtert durch die Nase einatmet.
»Ich spüre schon, wie der Drink seine magische Wirkung entfaltet«, behauptet sie und nimmt sich eine Scheibe Toast von dem beeindruckenden Frühstücksangebot, das bereits auf dem Tisch stand, als ich heute Morgen zaghaft die Treppe herunterkam. »Ich fürchte, ich vertrage heute nur trockenes Brot – wie deprimierend. Du hast dir hoffentlich ein etwas aufregenderes Frühstück schmecken lassen.«
»Toast reicht mir vollkommen, danke«, antworte ich. Selbst davon habe ich nur wenige Bissen herunterbekommen.
»Bennet, ich verstehe nicht, warum es mir so schlecht geht! Sie haben doch nur den Wein kredenzt, den ich persönlich im Keller ausgewählt hatte«, sagt sie mit einem schweren Seufzen, während der Butler ihr ein Glas eiskaltes Wasser einschenkt. »Ein guter Wein verursacht eigentlich keinen Kater, Ruby. Champagner genauso wenig, wenn man die ganze Nacht dabei bleibt. Das sind deine nächsten beiden Lektionen.«
Während sie weiter stöhnt und jammert, unterdrücke ich ein Schmunzeln.
Mum hatte recht mit ihrer Prognose, dass die Anfangszeit in London zwar schwer für mich werden würde, ich mich aber wenigstens darauf verlassen könne, dass Lady Tabatha Carter amüsant sei, ob nun freiwillig oder nicht.
»Ich frage mich, ob es die Pralinen waren, die wir nach dem Dinner genascht haben«, überlegt sie weiter. »Andererseits könnte ich schwören, dass ich nur zwei davon gegessen habe. Immy behauptet, sie seien selbst gemacht gewesen, aber wer hat schon Zeit, hausgemachte Schokoladentrüffel herzustellen? In meinen Augen sahen die Dinger den Pralinen von Charbonnel et Walker verdächtig ähnlich.«
Sie zieht vorübergehend die Sonnenbrille ab, um sich in den Nasenrücken zu kneifen, nippt erneut an ihrem Drink und lehnt sich dann in ihren Stuhl zurück.
»Also, Ruby, was ziehst du heute zur Galerieeröffnung an? Hast du ein passendes Outfit im Schrank, oder war meine Schwester noch nie mit dir in Paris?«
»Welche Galerieeröffnung?«, frage ich und unternehme einen weiteren Versuch, einen Bissen Toast herunterzuwürgen.
»Die von Cruz Alderley natürlich!«, antwortet Tabatha laut und zuckt mit schmerzverzerrtem Gesicht zusammen. Offenbar verschlimmert der schrille Ton ihrer eigenen Stimme ihre Kopfschmerzen. »Er hat die irritierendsten Nasenhaare, die ich je gesehen habe, aber sein Kunstgeschmack ist exquisit. Seine Galerie in Belgravia ist hocherfolgreich, und heute eröffnet eine zweite in Chelsea. Jeder, der Rang und Namen hat, wird da sein – eine wunderbare Gelegenheit, dich in die High Society einzuführen. Der Tatler wird selbstverständlich berichten. Wenn ich den Redakteuren sage, wer du bist, landest du mit Sicherheit im Gesellschaftsteil!«
»Danke, aber ich möchte lieber nicht mitkommen«, sage ich leise. »Wahrscheinlich sollte ich … die nähere Umgebung erkunden. Ich dachte, ich könnte vielleicht einen Spaziergang durchs Viertel machen. Oder ein bisschen lesen.«
Tabatha seufzt. »Ach ja. Deine Mutter hat mich diesbezüglich vorgewarnt.«
Ich sehe sie stirnrunzelnd an. »Wie meinst du das?«
»Sie hat mir erzählt, dass du in letzter Zeit lieber Zeit mit Pferden oder fiktiven Charakteren verbringst als mit Menschen aus Fleisch und Blut«, erklärt sie mit hochgezogenen Augenbrauen.
Ich rutsche unbehaglich auf meinem Stuhl herum. »Stimmt doch gar nicht!«
Tabatha wedelt mit der Hand durch die Luft. »Dann tu meinetwegen heute noch, wonach dir der Sinn steht. Aber lass mich dir eins sagen, Ruby: Wenn du deinen neuen Wohnort kennenlernen willst, genügt es nicht, draußen herumzulaufen. Es sind die Anwohner, die diesen Ort ausmachen, und ich garantiere dir, dass sich eine Auswahl der allerwichtigsten Persönlichkeiten in der Galerie herumtreiben wird. Die Leute werden zwar so tun, als wollten sie ein Kunstwerk kaufen, aber in Wahrheit sind alle nur da, um gesehen zu werden.«
»Gehst du auch aus diesem Grund hin?«
»Natürlich. Ich habe noch nie aus einem anderen Grund das Haus verlassen.«
Ich senke grinsend den Blick auf die Serviette, die ich über meinen Schoß drapiert habe.
»Danke, dass du mich zur Eröffnung mitnehmen wolltest«, sage ich. »Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss.«
»Ach was, du brauchst dich nicht bei mir zu entschuldigen«, wehrt sie ab und trinkt noch einen Schluck von ihrer Bloody Mary. »Ich dachte nur, es wäre eine gute Gelegenheit für dich, eine deiner Schulkameradinnen kennenzulernen, bevor es nächste Woche losgeht. Venetia Alderley, Cruz’ Tochter, besucht nämlich ebenfalls Clairmont. Sie ist ein bisschen jünger als du, glaube ich, auch wenn man das bei Teenagern nie so genau wissen kann. Nichts für ungut, aber für mich seht ihr alle gleich alt aus.«
Unvermittelt schnürt mir Panik die Kehle zu.
»Was meinst du mit ›Schulkameradinnen‹?«, kiekse ich. »Ich … Ich habe mich doch noch gar nicht für eine Schule entschieden. Wir haben bisher nicht über dieses Thema gesprochen.«
»Was wäre ich für ein Vormund, wenn ich mich nicht um deine Schulbildung kümmern würde?«, fragt sie entrüstet. »BENNET! BENN… Oh. Da sind Sie ja. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir noch eine davon zu mixen? Diese hier hat wahre Wunder vollbracht! Vielen Dank.«
»Tabatha«, hake ich ein und beuge mich vor, um ihre Aufmerksamkeit auf mich zurückzulenken. »Du hast mir nichts von einer Schule erzählt. Um welche Art der Schulbildung hast du dich genau gekümmert?«
»Ich wollte, dass es eine Überraschung wird«, antwortet sie lächelnd und rückt zufrieden ihre Sonnenbrille zurecht. »Halt dich fest: Ich habe dir einen Platz in Clairmont Hall organisiert!«
Der Name sagt mir irgendetwas, allerdings komme ich beim besten Willen nicht darauf, woher ich ihn kenne.
Tabatha wartet gespannt auf meine Reaktion. Als ich nichts sage, scheint sie davon auszugehen, dass ich sprachlos bin vor Staunen und Dankbarkeit.
»War mir ein Vergnügen«, sagt sie glucksend. »Zuerst hieß es, es sei völlig unmöglich, dich so kurzfristig in der Schule unterzubringen. Du musst ja nur noch die letzten Monate der Oberstufe hinter dich bringen, und Clairmont nimmt so spät im Jahr keine Schülerinnen mehr auf. Es war also eigentlich ein aussichtsloses Unterfangen. Auf ihrer Frühlingssoiree meinte Flora zu mir, sie fände es richtiggehend unverschämt, dass ich es überhaupt versuche. Na ja, letzten Endes war es gar nicht so schwierig, wie alle behauptet haben. Ich habe der Schulleiterin einfach erzählt, wer du bist, und ihr deine Situation geschildert. Nachdem sie sich mit deiner früheren Schule in Verbindung gesetzt hat, war sie bereit, dich in Clairmont aufzunehmen. Dein erster Schultag ist am Montag.«
»W-w-was ist Clairmont für eine Schule?«, erkundige ich mich stammelnd.
»Ruby Diana Carter, Clairmont Hall ist die elitärste und prestigeträchtigste Schule im ganzen Land«, klärt mich Tabatha unwirsch auf. »Nicht nur ich bin dort zur Schule gegangen, genau wie dein Onkel und deine Großeltern, nein, auch deine Mutter war in Clairmont. Die Tatsache, dass sie das vor dir geheim gehalten hat, ist eine Schande!« Meine Tante blickt zu Bennet auf, der mit ihrem aufgefüllten Cocktailglas hereingeeilt kommt. »Ich hoffe doch sehr, dass Sie einen großzügigen Schuss Wodka hinzugefügt haben, Bennet. Vor lauter Entsetzen darüber, dass meine Nichte – mein eigen Fleisch und Blut – Clairmont Hall nicht kennt, kehren meine Kopfschmerzen gerade mit voller Wucht zurück!«
»Meine Mutter ist auf diese Schule gegangen?«, frage ich verblüfft. »Sie hat nie darüber gesprochen. Wusste sie, dass du vorhast, mich dorthin zu schicken?«
»Ich habe ihr von diesem Plan erzählt, ja. Um ehrlich zu sein, war sie nicht so begeistert von der Idee, wie ich gehofft hatte. Sie meinte, wenn für mich keine anderen Schulen infrage kämen, sollte ich lieber einen Privatlehrer für dich einstellen, damit du auf diese Weise die Schule zu Ende bringst. Bestimmt wollte sie dir nur eine Enttäuschung ersparen, denn es war ja höchst unwahrscheinlich, dass du aufgenommen wirst. Ruby – Clairmont ist die einzig angemessene Schule! Was glaubst du, wo die Mitglieder des britischen Königshauses ihre Schulbildung erhalten?«
»Prinzessin Caroline besucht Clairmont Hall?« Endlich dämmert mir, wo ich den Namen der Schule schon einmal gehört habe. »Ist sie nicht genauso alt wie ich?«
»Wie gesagt: Für mich sehen alle Teenager gleich aus, deshalb habe ich leider keine Ahnung«, antwortet Tabatha und trinkt einen Schluck von ihrer Bloody Mary.
»Vielleicht bin ich im selben Jahrgang wie die Thronfolgerin«, murmele ich und versuche, mich an diesen Gedanken zu gewöhnen. »Das ist … wow!«
»Genau das war meine Befürchtung, Bennet«, sagt Tabatha kopfschüttelnd und weist mit dem Kinn auf mich. »Eleanor hat ihr nicht das Geringste über Etikette beigebracht. Was für ein verantwortungsloses Versäumnis. Es gibt viel zu tun für uns.« Sie stößt einen tiefen Seufzer aus. »Dieses Gespräch hat mir das bisschen Energie geraubt, das ich heute Morgen aufbringen konnte, daher ziehe ich mich jetzt für ein Schläfchen zurück, bevor ich zur Galerieeröffnung aufbreche.«
Sie nimmt ihre Bloody Mary und rauscht Richtung Tür davon, wobei der salbeigrüne Morgenmantel wie der Umhang einer Superheldin hinter ihr herflattert.
»Tabatha!«, rufe ich. Sie bleibt in der Tür stehen und dreht sich zu mir um. »Hat meine Mutter … Hat es ihr gefallen in Clairmont Hall?«
»Ob es ihr gefallen hat? Sie hat es geliebt! Die Schule war ihr zweites Zuhause!«
»Und wie war sie so?«, frage ich, begierig darauf, so viel über Mum zu erfahren wie möglich. »Als sie dort zur Schule ging, meine ich.«
Tabatha holt tief Luft, und ein breites Lächeln erscheint auf ihrem Gesicht.
»Sie war ein richtiger Wirbelwind«, antwortet sie und lacht in sich hinein, während sie den Raum verlässt. »Du hättest sie nicht wiedererkannt, wenn du sie damals erlebt hättest.«
Einige Tage später klopft es an meiner Zimmertür.
»Herein!«, rufe ich und blicke von meinem Buch auf.
Tabatha stöckelt auf himmelhohen Absätzen in den Raum, ausstaffiert mit einem auffälligen gelben Kleid und einem breitkrempigen Hut.
»Du siehst hübsch aus«, merke ich an und spüre ein Kitzeln im Hals von der Parfumwolke, die mit ihr ins Zimmer geweht ist. »Ich hoffe, du amüsierst dich gut auf der Party. Was ist heute noch mal der Anlass?«
»Lord und Lady Walters Frühlingsempfang.« Sie marschiert schnurstracks zu dem Ganzkörperspiegel in der hintersten Ecke meines Zimmers und betrachtet sich prüfend. »Den veranstalten die beiden jedes Jahr, um Floras Frühlingssoiree auszustechen. Lord Walter ist Parlamentsabgeordneter, daher glaube ich ihm grundsätzlich kein Wort, aber seine Frau ist sehr charmant, eine reizende Person. Manchmal frage ich mich, warum sie ihn geheiratet hat – ich nehme mal an, er war früher steinreich. Inzwischen geht sein Vermögen zur Neige, wie man munkelt …«
Nachdem Tabatha eine winzige Justierung an ihrem Hut vorgenommen hat, wirbelt sie herum und sieht mich auffordernd an.
»Komm doch mit mir zu dem Frühlingsempfang, Ruby! Du hast die ganze Woche nur zu Hause herumgesessen. Seit du in London bist, verlässt du kaum dein Zimmer. Findest du nicht auch, dass du mal ein bisschen unter die Leute gehen solltest? Ich bin seit Tagen die Einzige, mit der du redest.«
»Das stimmt nicht. Mit Bennet rede ich auch«, widerspreche ich matt. »Ich habe eben Zeit gebraucht, um mich einzuleben. Hier ist alles so anders.«
Das ist stark untertrieben. Meine bisherige Welt wurde komplett auf den Kopf gestellt. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in dem jeder jeden kennt. Frühmorgens ging ich mit meiner Mutter zum Dorfstall, um mit ihr Ausritte durch den umliegenden Wald zu unternehmen, und wenn ich nicht gerade Schule hatte, half ich ihr im Laden und füllte mit Kopfhörern die Regale auf, während sie die Kundschaft bediente. Bevor Mum krank wurde, traf ich mich häufig mit Freunden und besuchte mit ihnen das Dorfkino, in dem nur ein einziger Film lief – entweder ein erfolgreicher neuer Blockbuster oder ein Klassiker. Wir quasselten die ganze Vorführung durch und stopften uns mit Popcorn voll. Sonntags gingen Mum und ich meistens irgendwo brunchen (sie war eine miserable Köchin und hatte nur selten Lust, sich an den Herd zu stellen) und halfen anschließend im Stall mit. Meine Pferdeliebe habe ich von ihr. Trotzdem war ich kein typisches Landei, das abgeschieden in der Provinz lebte. Im ländlichen Wiltshire war nur eben alles sicher und vorhersehbar.
Manchmal vermisse ich Mum so sehr, dass sich meine Kehle zuschnürt und ich kaum noch Luft bekomme. Dabei wusste ich, dass sie sterben würde, wir wussten es beide. Aber es macht einen Verlust nicht unbedingt einfacher, wenn man darauf vorbereitet ist. Mum versicherte mir, dass es völlig okay sei, auch mal schwach zu sein. Ich würde viele schlechte Tage durchmachen müssen, bevor wieder gute Tage folgten.
Manchmal frage ich mich, ob es je dazu kommen wird.
»Du hast dir ein bisschen Spaß verdient, Ruby«, argumentiert Tabatha, und ihre blauen Augen funkeln verschmitzt. »Na los, komm mit zum Frühlingsempfang! Die Walters ziehen immer eine große Show ab, das darfst du dir nicht entgehen lassen. Außerdem besucht ihr Sohn Jonty auch Clairmont Hall. Er sieht einfach umwerfend aus, aber du solltest dir keine allzu großen Hoffnungen machen: Angeblich ist er schwul und datet einen gut aussehenden französischen DJnamens Guillaume. Na ja, kein Grund, Trübsal zu blasen. Normalerweise treiben sich noch jede Menge andere fesche Burschen auf solchen Veranstaltungen herum. Also, was sagst du?«
»Danke, Tabatha. Ich weiß die Einladung zu schätzen, würde aber lieber …«
»… hierbleiben und dich vor Gott und der Welt verstecken«, beendet sie meinen Satz. Ihre Stimme klingt auf einmal anders, sanft und verständnisvoll. Ich sehe sie überrascht an.
Sie umrundet das Bett, um sich neben mich auf die Kante zu setzen, die Hände im Schoß gefaltet. Fast scheint es, als müsste sie erst ihren Mut zusammennehmen.
»Hör mal, ich weiß, dass das alles nicht … leicht für dich ist«, beginnt sie schließlich, und ich habe den Verdacht, dass Sorgenfalten in ihrer Stirn erscheinen würden, wenn sie nicht derart mit Botox vollgespritzt wäre. »Du bist mit so vielen Veränderungen konfrontiert: einem neuen Wohnort, einer neuen Umgebung, neuen Menschen. Dass dich das überfordert, ist vollkommen verständlich. Ich weiß, dass ich nicht die Kompetenteste bin, was … Kindererziehung angeht. Also versuche ich erst gar nicht, dich zu erziehen. Das wäre eine Beleidigung für uns beide. Aber ich würde mich freuen, wenn wir Freundinnen werden könnten.«
Ich lächle ihr zu, gerührt von ihrer Ernsthaftigkeit. Sie kommt mir wie eine Person vor, die nicht gern über ihre Gefühle spricht, und doch gewährt sie mir gerade einen Blick hinter die sorgfältig errichtete Fassade der Society-Lady, und dafür bin ich ihr dankbar.
»Darüber würde ich mich auch freuen«, sage ich.
»Gut.« Sie zögert. »Ich weiß zufälligerweise genau, wie verlockend es ist, sich zu verkriechen, wenn einem etwas Schlimmes passiert ist. Der Rest der Menschheit macht einfach weiter wie bisher, obwohl die eigene Welt komplett in sich zusammengestürzt ist. Das ist eine der größten Ungerechtigkeiten des Lebens.«
Vor meinen Augen verschwimmt plötzlich alles, und ich kämpfe blinzelnd gegen meine Tränen an.
»Aber es wird nicht besser davon, dass man in den eigenen vier Wänden herumsitzt und krampfhaft versucht, sich in fiktive Parallelwelten zu flüchten«, fährt sie mit sanfter Stimme fort. »Eleanor hätte niemals gewollt, dass du das tust. Falls doch, hätte sie dich nicht zu mir nach London verfrachtet.«
Ich lächle schwach.
»Jeder trauert auf seine Weise, und es steht dir natürlich zu, mir zu sagen, ich solle verschwinden, damit du ungestört herausfinden kannst, ob der Butler der Mörder war«, sagt sie und weist mit dem Kinn auf das Buch in meiner Hand. »Aber falls du dich doch wieder unter Menschen wagen willst, um herauszufinden, wie du außerhalb des Hauses mit deiner Trauer zurechtkommst, wäre heute die ideale Gelegenheit – denn wie ließe sich ein Nachmittag besser verbringen als damit, anderen Leuten den Champagner wegzutrinken, einer Jazzband zu lauschen und sich den neuesten Klatsch und Tratsch zu Gemüte zu führen? Die Gästeliste der Walters kann sich normalerweise durchaus sehen lassen, und das, obwohl der Hausherr Politiker ist. Es könnte Vorteile für dich bringen, wenn du mitkommst und ein paar interessante Leute kennenlernst.«
»Wahrscheinlich hast du recht.« Ich seufze und spähe zu dem gerahmten Foto von Mum, das auf meinem Nachttisch steht. »Es ist sicher eine gute Idee, mal das Haus zu verlassen.«
»Ist das ein Ja?«
Ich nicke beklommen.
»Wunderbar!« Tabatha springt vom Bett auf und klatscht in die Hände. »Rühr dich nicht vom Fleck. Ich suche Bennet und organisiere dir mit seiner Hilfe etwas Passendes zum Anziehen. Ich habe schon ein Outfit für dich im Sinn, aber Bennet weiß besser als ich, wo sich meine Schätzchen verstecken.«
»Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Irgendwas habe ich bestimmt dabei, was ich anziehen könnte.«
»Da muss ich dir leider widersprechen«, sagt sie und legt mitleidig den Kopf schräg. »Ich habe mir deine mitgebrachten Kleider genau angeschaut, und es ist absolut nichts dabei, was für diese Art von Veranstaltung angemessen wäre. Überlass das nur mir!«
»Wann hast du meine Sachen durchgesehen?«, frage ich verwirrt, doch sie ignoriert mich und stapft aus dem Zimmer.
»BENNET!«, höre ich sie den Flur entlangrufen. »Sie müssen mir helfen, das Chanel-Kleid zu finden, Sie wissen schon, das mit der Blümchenstickerei. Außerdem brauchen wir dazu passende Schuhe und eine Handtasche. Aschenbrödel kommt doch mit zum Ball!«
3
Wie Tabatha mir auf der Fahrt zum Frühlingsempfang erzählt, haben Lord und Lady Walter in diesem Jahr William Shakespeares Ein Sommernachtstraum als Inspiration für ihre Gartenparty gewählt.
»Lady Walter behauptet, ihr sei plötzlich eine luftige, blumige Vision gekommen, dabei sind Blumen lustigerweise exakt das Motto, das Flora für ihre Frühlingssoiree präsentiert hat«, erklärt Tabatha trocken. »Sie hatte die gesamte Hausfassade mit rosa Rosen geschmückt, und der Effekt war wirklich verblüffend. Ich bin gespannt, ob Lady Walter das toppen kann.«
Als der Wagen vor der Stadtvilla der Walters hält, stelle ich fest, dass die Gastgeberin sich nicht allzu schlecht schlägt. Ein Tunnel aus farbenfrohen Frühlingsblumen, dessen Boden üppig mit Blütenblättern bestreut ist, führt um das prächtige Haus herum, und als wir aus dem floralen Gebilde heraustreten, erwartet uns ein spektakulärer Anblick: Der gesamte weitläufige Garten ist mit einem Baldachin aus Leuchtgirlanden überspannt, und darunter tanzen in großen, efeugeschmückten Brunnen als Feen verkleidete Ballerinen.
Die Gäste schlendern in Designerkleidung um mehrere extravagante, zwei Meter hohe Blumenarrangements herum, ignorieren weitgehend die Brunnentänzerinnen und die Jazzband, die im hinteren Teil des Gartens spielt, schlürfen Champagner und plaudern miteinander, als wäre die Opulenz der Szenerie vollkommen normal. An den Gerüchten über das schwindende Vermögen der Walters scheint zumindest auf den ersten Blick nichts dran zu sein.
Ich bin vor Ehrfurcht wie erstarrt, und Tabatha muss mich anstupsen, damit mir aufgeht, wie unhöflich es ist, den jungen Mann mit dem weißgoldenen Elfenkostüm und der Blumenkrone auf dem Kopf zu ignorieren, der mir ein Getränk anbieten will.
»Vielen Dank«, piepse ich, nehme das Glas entgegen und zögere, als ich die Flüssigkeit näher in Augenschein nehme. »Oh … ich glaube, in meinem Glas schwimmen irgendwelche Stückchen herum.«
Mit einem gezwungenen Lachen packt Tabatha mein Handgelenk und zieht mich von dem als Elf verkleideten Kellner weg, bevor er auf meine Bemerkung reagieren kann.
»Das sind keine ›Stückchen‹, Ruby, das ist Blattgold!«, zischt sie aufgebracht. »Am besten bittest du mich von jetzt an um Erlaubnis, bevor du auf dieser Party irgendetwas sagst, zu wem auch immer.«
»Wirkt das nicht komisch, wenn ich immer erst Rücksprache mit dir halte, bevor ich den Mund aufmache?«, hake ich nach, während ich noch immer staunend in mein Glas spähe.
»Könntest du bitte aufhören, so zu tun, als hättest du noch nie ein Champagnerglas gesehen?«, blafft sie mich an und setzt dann hastig ein breites Lächeln auf. Ich drehe mich um und sehe, dass ein Mann mit hellen Haaren und dunkelblauem Smoking und eine Frau in einem weißen, umhangähnlichen Gewand mit Silberstickerei auf uns zukommen.
Nachdem Tabatha mich vorgestellt hat, heißen uns die beiden auf ihrer Party willkommen. Während Lady Walter beteuert, wie betroffen sie war, als sie vom Tod meiner Mutter erfahren hat, wirkt Lord Walter beinahe erschrocken über meine Anwesenheit. Seine Augen weiten sich, als er mich genauer mustert. Erst als seine Frau ihn aufmunternd anstupst, räuspert er sich und bekräftigt, wie »schrecklich« das Ganze sei.
Ich nehme seine unbeholfene Reaktion nicht persönlich. Die meisten Leute haben keine Ahnung, wie sie mit einem umgehen sollen, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Es überrascht mich daher nicht, als Lord Walter zu seiner Frau sagt, sie müssten jetzt das Paar begrüßen, das unmittelbar nach uns eingetroffen sei. Er hat es eilig, aus diesem unangenehmen Gespräch zu flüchten, und ich mache es ihm leicht, indem ich höflich beiseitetrete.
»Hmm. Nicht so viele Gäste hier wie letztes Jahr«, murmelt Tabatha. »Seltsam. Ah, wunderbar, da ist Freddie! Seine Eltern sind der Viscount und die Viscountess Culbeth«, erklärt mir Tabatha, als müssten mir diese Titel irgendetwas sagen. Dabei winkt sie kokett einem Mann am anderen Ende des Gartens zu. »Komm, wir gehen und sagen ihm Hallo. Hör auf, an deinem Kleid herumzufummeln, Ruby! Du benimmst dich, als hättest du Flöhe!«
Ich lasse verlegen die Hand sinken, mit der ich gerade an meinem Kragen gezupft habe.
»Sorry, ich bin solche figurbetonten Schnitte nicht gewohnt«, murmele ich und drücke die Handflächen gegen meinen Bauch. »Bist du sicher, dass mir das Kleid steht? Ich weiß nicht, ob ich so ein Outfit überzeugend rüberbringe …«
»Du bringst es äußerst überzeugend rüber, keine Sorge«, antwortet Tabatha sachlich und lehnt mit einem höflichen Lächeln die Kaviarkanapees ab, die ein geflügelter Elf ihr im Vorübergehen anbietet. »Meinst du, ich würde mich mit dir auf einer Party blicken lassen, wenn du nicht umwerfend aussähest? Nein. Wenn dir etwas nicht steht, teile ich es dir garantiert mit – darauf kannst du dich verlassen. Deshalb habe ich auch diesen furchtbaren Strickpullover weggeworfen. Wenn du wirklich etwas tragen möchtest, das im Farbton ›Khaki‹ hergestellt wird, musst du dir eine andere Unterkunft suchen.«
»Du hast einen Pulli von mir weggeworfen?«, frage ich entsetzt, aber sie antwortet nicht, weil Freddie und seine Entourage inzwischen zu uns herübergekommen sind.
Ich setze ein steifes Lächeln auf, während Tabatha mich dem Grüppchen vorstellt. Natürlich kann ich mir keinen einzigen Namen merken – geschweige denn Titel, falls diese Leute einen tragen. Alle betrachten mich voller Mitleid und teilen mir mit, wie erschüttert sie waren, als sie vom Ableben meiner Mutter gehört haben. Nachdem sie darin übereingestimmt haben, wie wunderbar Lord und Lady Walter diese Party gestaltet haben, wendet sich das Gespräch anderen Themen zu. Anfangs versuche ich noch, dem Geplauder über die neuesten gesellschaftlichen Ereignisse zu folgen, doch schon bald wird mir klar, dass ich nicht mitreden kann.
Irgendwann dreht sich die Frau, die neben mir steht und von Tabatha als »beste Theaterschauspielerin ihrer Generation« vorgestellt wurde, zu mir um und sagt: »Mit deiner Mutter konnte man so viel Spaß haben, ich habe sie regelrecht vergöttert! Ist sie damals nicht mit einem verheirateten Feuerwehrmann durchgebrannt? Ich hoffe, dieser Schritt hatte nicht allzu schlimme Nachwirkungen.«
Ich huste und spucke den Champagner wieder aus, den ich gerade getrunken habe. Um ein Haar landet er mitsamt Blattgold auf dem Kleid der Schauspielerin.
»Du lieber Himmel, Ruby! Geht es dir gut?«, fragt Tabatha, während die Frau angewidert zurückweicht.
Ich versichere meiner Tante, dass alles in Ordnung ist, erhalte jedoch keine Gelegenheit mehr, der Theaterdarstellerin zu widersprechen und ihre haarsträubende Geschichte geradezurücken. Als ich endlich aufgehört habe, zu würgen und zu husten, hat sie sich bereits von unserer Gruppe abgewandt und unterhält sich mit anderen Partygästen.
»Sie dachte, Mum wäre mit einem verheirateten Feuerwehrmann durchgebrannt!«, sage ich wütend zu Tabatha, als ich endlich wieder sprechen kann. »Wie kommt sie auf so eine Idee?«
Meine Tante zuckt mit den Schultern. »In diesen Kreisen kursieren die wildesten Gerüchte über deine Mutter. Was du gehört hast, ist noch harmlos im Vergleich zu den Geschichten, die mir zu Ohren gekommen sind.«
»Was? Tabatha, das ist ja schrecklich!«
»So darfst du das nicht sehen, Darling, die Leute meinen es nicht böse«, antwortet sie fröhlich. »Du bist hier inmitten der Crème de la Crème der Londoner Gesellschaft. Wenn diese Menschen nicht über einen tuscheln, hat man etwas falsch gemacht. Eleanor ist damals ohne ein Wort aus London verschwunden – ist doch klar, dass da geredet wird! Ich glaube, sie selbst fand es ganz gut, dass ihr Abgang so geheimnisumwoben war. Sie hat jedenfalls nie irgendjemandem ihre Beweggründe erklärt, nicht einmal mir.«
Ich nehme einen Anflug von Verbitterung in Tabathas Tonfall wahr.
»Mir hat sie es auch nie erklärt«, murmele ich ungeduldig, »aber das rechtfertigt doch nicht, dass …«
»Ach herrje«, unterbricht mich Tabatha leise und späht mit halb zugekniffenen Augen zu einer Person, die sie irgendwo hinter mir entdeckt hat. »Da ist Talia. Pfui Teufel!«
»Wer ist Talia?«, frage ich und blicke über die Schulter zu einer gertenschlanken Frau mit glänzenden kastanienbraunen Haaren. Sie trägt ein knallrotes Kleid, und an ihren Handgelenken klimpern teure Goldreifen.
»Wir sind zusammen in Clairmont zur Schule gegangen, und sie hat ihr ganzes bisheriges Leben mit dem Versuch verplempert, mich zu übertrumpfen, was ich persönlich mehr als armselig finde! Diese Frau ist eine in Dior gehüllte Giftschlange.« Tabathas Mund verzieht sich zu einem zuckersüßen Lächeln. »Tally-Schätzchen!«
Talia ist neben mir aufgetaucht und tauscht Luftküsse mit Tabatha aus.
»Darf ich dir meine Nichte Ruby Carter vorstellen?«, sagt meine Tante, während Talia dazu übergeht, auch mir zwei Luftküsse zu verpassen. »Ruby, das ist meine liebe Freundin Talia.«
»Sehr erfreut«, begrüßt mich besagte Dame mit weicher, schmeichelnder Stimme. »Tabby, du siehst toll aus! Umwerfendes Kleid! Wie ähnlich es dem Kleid ist, das ich bei Floras Soiree getragen habe! Ich weiß noch, wie du es an mir bewundert hast. Und nun stehst du hier im gleichen Dress, strahlend und schön!«
Tabatha gefriert das Lächeln im Gesicht. »Wenn ich mich recht entsinne, hattest du ein vollkommen anderes Kleid an, meine liebe Tally.«
»Es war eins zu eins dasselbe, Tabby. Was für ein Privileg, dich zu deiner heutigen Kleiderwahl inspiriert zu haben! Wie auch immer, wir müssen uns bald mal wieder zum Lunch treffen – es gibt so viel zu erzählen! Vielleicht schaffen wir es, nach Lord Berrys Schwarz-Weiß-Ball eine freie Lücke im Terminkalender zu finden.«
Tabathas Gesicht erstarrt. Als Talia es sieht, erscheint ein triumphierendes Funkeln in ihren Augen.
»Jetzt sag nicht, du hast keine Einladung bekommen, Tabby!«, ruft sie und schnappt mit übertriebenem Entsetzen nach Luft.
»Natürlich habe ich eine Einladung bekommen«, versichert Tabatha eilig, während ihr das Blut in die Wangen steigt. »Ich kann nur leider nicht an dem Termin.«
»Ärgere dich nicht, meine Liebe«, sagt Talia und tätschelt ihr teilnahmsvoll die Hand. »Du weißt, wie exklusiv diese Bälle sind. Nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr. Ach, da ist Genevieve! Ich muss ihr unbedingt Hallo sagen! Hat mich gefreut, dich kennenzulernen, Ruby. Und Tabby: Ich rufe dich an, sobald es ein bisschen ruhiger geworden ist in meinem Terminplan!«
Mit einem strahlenden Lächeln schwebt sie davon. Tabatha kneift unterdessen so fest die Lippen zusammen, dass sie fast verschwinden, und atmet tief durch die Nase ein.
»Alles in Ordnung?«, frage ich sie besorgt.
Nachdem sie in einem Zug ihr Glas ausgetrunken hat, stößt sie hervor: »Es ging mir noch nie besser. Ruby, wir müssen auf dieser Feier mit so vielen Leuten wie möglich sprechen. Ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass diese Talia mehr soziale Anlässe in ihrem Kalender stehen hat als ich. Noch heute Abend sichern wir uns eine Einladung, die ihr das selbstverliebte Lächeln aus ihrem operierten Gesicht treiben wird!«
»Was denn für eine Einladung?«
»Das weiß ich noch nicht genau. Komm, wir haben keine Zeit zu verlieren.«
Sie lässt den Blick über die Menge schweifen und wählt ihr erstes Opfer aus. Ich werde der Modedesignerin Marie vorgestellt und treffe danach auf den Luxushotelier Carlos, bevor wir uns plaudernd zu einer ganzen Ansammlung bekannter Society-Ladys gesellen. Anschließend sind ein Schönheitschirurg, eine Unternehmerin und ein Bankier an der Reihe, gefolgt von einem Paar, von dem Tabatha behauptet, man müsse es unbedingt kennen, wenn man sich für das Potenzial von Löwenzahn interessiere.
»Löwenzahn wird dieses Jahr ein RIESENDING«, informiert mich die eine Hälfte besagten Paars. »Ein besseres Superfood gibt es nicht! Das schlägt ein wie eine Bombe, ihr werdet sehen.«
Ich brauche dringend eine Pause. Es erschöpft mich, ständig zu lächeln und so zu tun, als wäre ich beeindruckt von Menschen, die allein daran interessiert sind, über sich selbst zu reden. Überzeugt davon, dass Tabatha viel zu sehr in ihre Mission vertieft ist, um es mitzubekommen, wenn ich für ein paar Minuten verschwinde, schlüpfe ich in die Menge davon und bahne mir einen Weg durch den blumengeschmückten Garten, wobei ich immer wieder Gästen und Elfen ausweiche. Als ich mich dem Haus nähere, stoße ich versehentlich gegen die Schulter eines jungen Mannes, dessen Drink sich über seinen Smoking ergießt. Wir schnappen gleichzeitig erschrocken nach Luft.
»Oh, das tut mir leid!«, beteuere ich und verziehe das Gesicht, während der Junge sich die Flüssigkeit von der Hand schüttelt.
»Schon gut«, sagt er barsch und wirft mir einen finsteren Blick zu, der klarstellt, dass überhaupt nichts gut ist.
Ich glaube, er ist ungefähr in meinem Alter, groß und breitschultrig, mit zerzausten braunen Haaren, kantigem Kinn und vollen Lippen. Sein gutes Aussehen wird allerdings ein wenig von seinem wütenden Gesichtsausdruck getrübt, an dem ganz offensichtlich ich schuld bin.
»Ich wollte nicht …«, setze ich an, werde jedoch von einem zweiten jungen Mann unterbrochen, der neben seinem Freund auftaucht und ihm auf den Rücken klopft.
»Warum bist du stehen geblieben, Xav? Ich hab dir doch gesagt: auf schnellstem Weg zur Bar am anderen Ende des Gartens. Nur da schenken sie das gute Zeug aus.«
»Ich wurde aus heiterem Himmel attackiert«, erklärt der Angesprochene, und seine dunklen Augen huschen verärgert zu mir.
Sein Freund bemerkt mich erst jetzt. Er ist kleiner als sein Begleiter, hat kurze, platinblond gefärbte Haare und freundliche braune Augen. Er trägt eine smaragdgrüne Hausjacke, ein weißes Hemd und ein blau gepunktetes Halstuch. Auch wenn er nicht so umwerfend aussieht wie »Xav«, ist er durchaus attraktiv und strahlt auf mühelose Weise Stilbewusstsein und Wohlstand aus – Jay Gatsby als Teenager.
»Ich glaube, wir kennen uns noch nicht«, sagt er und streckt mir seine Hand entgegen. »Darf ich mich vorstellen? Jonty Walter.«
Jonty Walter, Sohn des Gastgeberpaars und ebenfalls Schüler an der berühmten Privatschule Clairmont Hall. Ich ergreife vor den Augen des Dunkelhaarigen seine Hand und schüttle sie.
»Hallo. Ich bin Ruby.«
»Sehr erfreut. Und dieser Kerl, der dank dir seinen Drink quer über der Brust trägt, ist Xavier.«
»Das mit dem Drink tut mir …«
»Wer zum Teufel hat dich reingelassen?«, unterbricht mich Jonty.
Ich erröte bis unter die Haarwurzeln und stammle nervös etwas davon, dass ich mit meiner Tante hier bin. Erst dann geht mir auf, dass Jonty nicht mit mir gesprochen hat. Offenbar hat er hinter mir jemanden entdeckt, und während er sich noch über seinen eigenen Witz kaputtlacht, drängt er sich an mir, der völlig unbedeutenden Ruby Carter, vorbei, um die betreffende Person zu begrüßen. Xavier scheint meine Reaktion hingegen mitbekommen zu haben, denn sein Mundwinkel zuckt belustigt.
Peinlich berührt mache ich mich aus dem Staub, nicht ohne ihm noch einen bösen Blick zuzuwerfen.
Jonty und Xavier sind genau so, wie ich mir meine zukünftigen Mitschüler vorgestellt habe: privilegiert, unhöflich und arrogant.
Ich verziehe mich an den äußersten Rand der Menge und recke den Hals auf der Suche nach einem ruhigen Ort, an dem ich mich verstecken könnte. Aber die Party wird immer lauter und ausufernder. Als ein Mitglied des Cateringteams eine Seitentür zum Haus offen lässt, nutze ich die Gelegenheit und schlüpfe hinein. Ich muss mich kurz sammeln und neue Energie tanken, bevor ich mich wieder ins Getümmel wage. Das Personal wird zum Glück nicht auf mich aufmerksam, als ich durch die riesige Küche eile, in der geschäftiges Treiben herrscht. Ich tue so, als wüsste ich genau, wo ich hinwill – eine enge Freundin der Familie, die jederzeit das Recht hat, das Haus zu betreten. Erleichtert atme ich auf, als ich jenseits der Küche im Flur verschwunden bin.