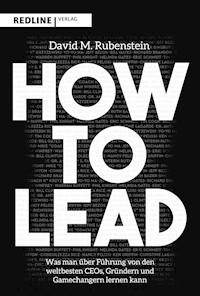
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
WAS DIE BESTEN FÜHRUNGSKRÄFTE AUSMACHT Was haben erfolgreiche Gründer und CEOs wie Bill Gates, Warren Buffett, Tim Cook und Eric Schmidt und Entscheidungsträgerinnen wie Nancy Pelosi oder Christine Lagarde gemeinsam? Sie alle haben ganz eigene Prinzipien und Philosophien zum Thema Führung. Jeff Bezos nutzt beispielsweise die Kraft des Umherschweifens und trifft seine Entscheidungen mit Herz und Intuition. Richard Branson schließt Geschäfte ab, um der Beste auf einem Gebiet zu werden. Diese und andere Ausnahmepersönlichkeiten wie Oprah Winfrey oder Phil Knight berichten in exklusiven Interviews von den Anfängen ihrer Karrieren und ihren Erfahrungen mit Misserfolgen, Innovationen und Krisen. David Rubenstein zeigt in seinem Buch so nicht nur, wie vielfältig die Wurzeln des Erfolgs sind, sondern auch, was man von diesen herausragenden Führungskräften lernen kann. »In diesen schnelllebigen, oft turbulenten Zeiten ist eine kluge und effektive Führung entscheidend. […] Dies ist eine Pflichtlektüre für heutige Führungskräfte, die ihr Spiel verbessern wollen – und für zukünftige Führungskräfte, die diese Arena betreten wollen.« - Sheryl Sandberg, COO von Facebook und Gründerin von LeanIn.Org und OptionB.Org
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
David M. Rubenstein
HOW TO LEAD
David M. Rubenstein
HOW TO LEAD
Was man über Führung von den weltbesten CEOs, Gründern und Gamechangern lernen kann
Übersetzung aus dem Englischen von Norbert Juraschitz
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
1. Auflage 2021
© 2021 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
© der Originalausgabe 2020 by David Rubenstein
Die englische Originalausgabe erschien 2020 bei Simon & Schuster, Inc. unter dem Titel How to lead.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Norbert Juraschitz
Redaktion: Werner Wahls
Abbildungen Innenteil: © 2020 by Matthew Cook
Umschlaggestaltung: Marc Fischer
Satz: Carsten Klein, Torgau
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-86881-847-5
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96267-333-8
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-334-5
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
INHALT
EINLEITUNG
VISIONÄRE
Jeff Bezos
Bill Gates
Sir Richard Branson
Oprah Winfrey
Warren Buffett
GRÜNDER
Phil Knight
Ken Griffin
Robert F. Smith
Jamie Dimon
Marillyn Hewson
REFORMER
Melinda Gates
Eric Schmidt
Tim Cook
Ginni Rometty
Indra Nooyi
BEFEHLSHABER
Präsident George W. Bush & Präsident Bill Clinton
General Colin Powell
General David Petraeus
Condoleezza Rice
James A. Baker III
ENTSCHEIDUNGSTRÄGER
Kongressmitglied Nancy Pelosi
Adam Silver
Christine Lagarde
Anthony S. Fauci
Ruth Bader Ginsburg
MEISTER IHRES FACHS
Jack Nicklaus
Mike »Coach K« Krzyzewski
Renée Fleming
Yo-Yo Ma
Lorne Michaels
DANK
ÜBER DIE BETEILIGTEN
ÜBER DEN AUTOR
EINLEITUNG
Führungsstärke hat mich schon immer fasziniert – insbesondere das, was einzelne Personen durch die Kraft ihres Intellekts, das Ausmaß ihrer einzigartigen Fertigkeit, die Stärke ihrer Persönlichkeit oder die Effektivität ihrer Überzeugungskraft zu bewirken vermögen.
Diese Faszination wurde während der COVID-19-Krise zweifellos von so gut wie allen auf dem Planeten geteilt, während sie erwartungsvoll verfolgten, ob bestimmte Personen der Aufgabe gewachsen sein würden, die Menschheit durch diese noch nie dagewesene Krise zu lenken, indem sie die notwendigen gesundheitlichen, medizinischen, finanziellen, sozialen und politischen Lösungen entwickelten. Auf einige trifft das ganz eindeutig zu.
Auf ähnliche Weise hielten während der Proteste nach dem Tod George Floyds viele Amerikaner nach Führungspersönlichkeiten Ausschau, welche die rassisch bedingten Spannungen linderten und sich dem im Land tief empfundenen Kummer widmeten. Und wiederum zeigten sich einige heldenhaft der Aufgabe gewachsen.
Führungsstärke äußert sich in unzähligen Formen und wird auf unzählige Weise ausgeübt. Manche Leader befehligen militärische Truppen im Krieg. Andere können sich große Unternehmen vorstellen und aufbauen. Manche erzielen Durchbrüche in der wissenschaftlichen Forschung, die das Leben vieler Millionen Menschen verbessern, oder tragen mit ihrem Fachwissen dazu bei, die staatliche Reaktion auf gefährliche neue Krankheiten zu steuern. Einige sind imstande, Werke in den visuellen oder darstellenden Künsten zu schaffen, die tiefe Emotionen auslösen und die menschliche Ausdrucksform auf höchstem Niveau präsentieren. Wieder andere beherrschen athletische Fertigkeiten, die Fans auf der ganzen Welt begeistern, oder sie verändern eine bestehende Organisation oder entwickeln Lösungen für komplizierte Probleme. Und manche sind in der Lage, neue Wege der Kommunikation oder des Denkens zu entwickeln.
Ich interessiere mich schon lange dafür, wie diese unterschiedlichen Menschen zu Führungspersonen geworden sind und es blieben. Als Folge meiner Faszination für die menschliche Eigenschaft der Führungsstärke hatte ich schon immer die – womöglich schlechte – Gewohnheit, Führungspersönlichkeiten gleich bei der ersten Begegnung zu fragen, wie sie eigentlich dazu wurden. Welche Faktoren gaben den Ausschlag? War es Glück, Tatendrang, Talent, Training, Erfahrung oder ein anderer Faktor? Wie wurde diese Eigenschaft eigentlich entdeckt und gepflegt? Auf welche Weise setzten sie sie in die Praxis um, und was geschah, wenn sie auf die Probe gestellt wurde? Nicht alle waren bereit, sofort auf mein Sperrfeuer an Fragen zu antworten.
Diese »schlechte« Gewohnheit trat stärker in der Öffentlichkeit zutage, als ich im Jahr 2008 Präsident des Economic Club von Washington, D.C., wurde und anfing, fast monatlich eine prominente Führungskraft aus den Bereichen Wirtschaft, Regierung oder Kultur zu interviewen. Wohl oder übel setzte ich meine Neugier, wie Führungskräfte ticken, fort, als ich 2016 auf dem Kanal Bloomberg TV meine Talkshow Peer to Peer begann (seit 2018 auch auf PBS).
Dieses Buch, ein Ergebnis dieser Interviews, soll den Lesern die Sichtweisen unterschiedlicher Arten von Führungspersönlichkeiten nahebringen, in der Hoffnung, dass er oder sie dazu inspiriert werde, eigene Führungsqualitäten zu entwickeln oder zu fördern. Wie bauten Jeff Bezos und Bill Gates weltweite Hightech-Imperien auf, allen Widrigkeiten zum Trotz? Wie gründete Phil Knight aufgrund einer Idee aus seiner Examensarbeit an der Business School das größte Unternehmen für Sportschuhe? Wie überwand Ruth Bader Ginsburg juristische Barrieren für die Gleichstellung der Geschlechter und wurde später zum Star des Supreme Court? Wie trat Tim Cook in die Fußstapfen des legendären Steve Jobs und baute ein noch stärkeres Unternehmen auf? Wie wurde Jack Nicklaus zum weltbesten Golfspieler? Wie gelang Condoleezza Rice der Aufstieg bis in die höchsten Etagen der US-Regierung, und das trotz ihrer Kindheit in den Südstaaten, in denen noch Rassentrennung herrschte? Wie bewältigten Bill Clinton und George W. Bush die ernsten Herausforderungen, mit denen sie als Präsident konfrontiert wurden? Wie wurde Anthony Fauci zu einer der weltweit angesehensten Koryphäen für Infektionskrankheiten wie Ebola, HIV/AIDS und jetzt COVID-19? Ganz offensichtlich reicht es nicht aus, ein Buch über Führungsqualitäten zu lesen, um ein Leader zu werden. Doch die Geschichten einiger der bekanntesten Persönlichkeiten zeigen, wie sich im Laufe eines Lebens und einer Berufskarriere Führungsstärke entwickelt. Viele der in diesem Buch präsentierten Personen fingen mit nicht viel mehr als einer Idee und dem eigenen Tatendrang an. Ihre Geschichten enthüllen auch, wie wichtig ein guter Führer für eine Herausforderung ist, was sich dann häufig zutiefst positiv für die Menschheit auswirkt. Jede einzelne Geschichte ist inspirierend.
Eine Frage allerdings mag durchaus ihre Berechtigung haben: Warum sollte überhaupt jemand führen wollen?
Erstens kann ein Leader die Art von Veränderungen oder Ergebnissen bewirken, die das Leben anderer Menschen verbessern. Zweitens kann er andere motivieren, Führungspersonen zu werden und damit wiederum das Leben anderer verbessern. Und drittens vermag ein Leader ein Gefühl von Vollendung und Leistung zu empfinden, das einem Menschen Erfüllung und Glück beschert.
Ich habe das Buch How to Lead geschrieben, weil mir die positive Wirkung, die starke, entschlossene und talentierte Führungspersonen in eine Gesellschaft einbringen können, sehr am Herzen liegt. Dabei hatte ich, offen gesagt, nicht den Eindruck, dass sich meine eigene spezielle Führungsgeschichte dazu eignen würde, andere zu inspirieren. Ich war der Meinung, die Geschichte wirklich außergewöhnlicher Persönlichkeiten, in offenherzigen Interviews erzählt, wäre weitaus hilfreicher.
Abgesehen davon habe ich aus meiner eigenen bescheidenen und zunehmend eklektischen »Führungsreise« einige Erkenntnisse gewonnen: vom Einzelkind einer Arbeiterfamilie zum Stipendiatsstudent, Juristen, Mitarbeiter des Weißen Hauses, Mitbegründer einer Beteiligungsgesellschaft, Philanthrop, Vorsitzenden einer gemeinnützigen Organisation, öffentlichen Redner, Fernsehmoderator und Kommentator und Autor. (Da ich auf keinem dieser Felder ein wirklich gutes Vorbild war, probierte ich wohl etliche verschiedene Tätigkeiten aus.)
Von klein auf scheinen Kinder zu erkennen, dass manche Erwachsene außerordentlich eindrucksvolle Dinge vollbringen. Tatsächlich scheinen so gut wie alle Kinder zu Leadern – oder »Helden« – aufzublicken und wollen so wie sie sein. In meiner Kindheit zählten zu diesen Personen historische Figuren wie George Washington, Abraham Lincoln, Theodore und Franklin Roosevelt und Winston Churchill sowie damalige Zeitgenossen wie John Wayne, der Immunologe Jonas Salk und Martin Luther King Jr., und noch typischer für einen Jungen in meiner Heimatstadt Baltimore Sportstars wie der dritte Baseman der Orioles Brooks Robinson oder der Quarterback der Colts Johnny Unitas.
Allerdings konnte es keine Führungspersönlichkeit in meiner Kindheit mit dem jugendlich wirkenden, charmanten und charismatischen Präsidenten John F. Kennedy aufnehmen, der in der Kubakrise von 1962 eine Führungsstärke bewies, welche die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion vor einem Atomkrieg bewahrte – ein Krieg, dem theoretisch über 100 Millionen Menschen hätten zum Opfer fallen können (mich eingeschlossen). Meine Lehrerin der neunten Klasse war so fest überzeugt, dass es zu einem Atomkrieg kommen würde, dass sie uns ein paar Tage lang keine Hausaufgaben gab. Sie meinte, wir wären vermutlich eh bald nicht mehr auf der Welt – nicht gerade ein tröstlicher Grund, keine Hausaufgaben zu machen.
Damals habe ich mich gefragt – und tue es heute noch –, was Einzelpersonen veranlasst, sich zu erheben und zu außergewöhnlichen Menschen zu werden. Wie ließen sie etwas geschehen, das sonst nicht passiert wäre? Lag es an ihrer Persönlichkeit, ihren mentalen oder physischen Fähigkeiten oder an dem glücklichen Zufall, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein? Und warum ließen so viele Menschen, die später in ihrem Leben zu Führungspersonen aufstiegen, in ihrer Jugend keinerlei Anzeichen von Führungsqualität erkennen? Warum waren sie damals nicht Präsident einer Studentenorganisation, Rhodes-Stipendiat oder Mannschaftskapitän? Das habe ich mich in der Hoffnung gefragt, dass ich – da ich in meiner Jugend kein großer Leader war – später im Leben vielleicht noch eine Chance bekäme, einer zu werden.
Wenn ich mit Studenten oder jungen Führungskräften spreche, sage ich häufig, das Leben lasse sich allgemein in Drittel unterteilen. Im ersten Drittel geht es um Erziehung und eine Ausbildung für eine künftige Berufslaufbahn; das zweite dreht sich in erster Linie um die Entwicklung der Karriere, die Vervollkommnung der Fertigkeiten und den Aufstieg in eine höhere oder eine verantwortungsvolle Position und Führungsstelle; im dritten schließlich wird »geerntet« – finanziell, psychisch, öffentliche Anerkennung – gemäß dem Grad der Leistungen, die in der zweiten Phase erzielt wurden.
Ich habe Studenten gesagt, dass »Gewinnen« im ersten Drittel des Lebens oft angenehm sein mag, aber häufig entwickeln sich die Gewinner dieser Phase nicht zu den Führern, die man aufgrund dieser frühen Ergebnisse vermutet hätte. Und Führungsstärke, füge ich hinzu, in der zweiten und dritten Lebensphase ist unter Umständen für den Einzelnen ebenso wie für die Gesellschaft bedeutsamer und nachhaltiger.
Warum werden so viele Leader der ersten Phase nicht zu den weltbedeutenden Persönlichkeiten, für die sie, in jungen Jahren, prädestiniert schienen? Womöglich liegt es daran, dass viele, die etwa ein Rhodes-Stipendium bekommen, Präsident einer Studentenorganisation oder Zeitungsredakteur sind oder im College in einem Auswahlteam spielen oder als Laufjunge am Supreme Court arbeiten und dergleichen mehr, bis zum Ende der ersten Phase bereits ein wenig ausgebrannt sind. Vielleicht machen sie nach dem ersten Drittel einfach eine kleine Verschnaufpause. Oder sie sind zu dem Schluss gelangt, dass ein großer Leader zu sein, auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Warum sollte man sich also in den restlichen beiden Dritteln selbst das Leben schwer machen?
Hingegen zählen, mit wenigen Ausnahmen, diejenigen, die im zweiten und letzten Drittel Führungskräfte sind, in der Regel im ersten Drittel nicht zu den Superstars. Woran liegt das?
Manche Menschen reifen später. Andere sind in der Kindheit womöglich in irgendeiner Form benachteiligt: familiäre Verhältnisse, fehlende finanzielle Ressourcen, Gesundheitsprobleme, schlechte Bildungschancen, etc. Wieder andere hatten früher vielleicht einfach keine Motivation, wenig Ehrgeiz, möglicherweise wegen fehlender Vorbilder oder Chancen.
Ich selbst gehörte vielleicht in eine bemerkenswerte, aber nicht ganz ausgefallene Kategorie: Ich wäre im ersten Drittel meines Lebens gerne ein echter Leader gewesen – es mangelte mir nicht an Ehrgeiz – und gab mir auch große Mühe; aber offen gesagt besaß ich weder das Talent, noch die Fähigkeiten oder anderen erforderlichen Eigenschaften, die damals von meinen Gleichaltrigen geschätzt wurden (etwa aufgeschlossene Persönlichkeit, athletische Fähigkeiten, reiche Familie, außerordentliches Talent auf einem bestimmten Gebiet). Später hatte ich das etwas unerwartete und wohl unverdiente Glück, gegen Ende des zweiten und zu Beginn des letzten Drittels eine Führungsperson im Finanzsektor und in der Welt der Philanthropie und gemeinnützigen Organisationen zu werden. Dieser späte Erfolg hat meine Klassenkameraden oder anderen Jugendfreunde mit Sicherheit überrascht, auch wenn viele das aus Höflichkeit nie offen sagen würden.
In meiner Jugend war ich ein ordentlicher Schüler, aber kein akademischer Überflieger. Wenn es nach den Zeugnissen oder Anzeigetafeln geht, war ich mit acht Jahren noch ein recht guter Sportler, doch dann zogen meine Alterskameraden in Größe und Talent an mir vorbei, und ich versank im Mittelmaß. Ich beteiligte mich an unzähligen außerschulischen Aktivitäten und war Mitglied einer beeindruckenden Jugendgruppe in Baltimore, war aber nie der dynamische Führer, der sich in diesem Umfeld an die Spitze setzte.
Immerhin erhielt ich ein Teilstipendium (nicht für Basketball) für den Besuch der Duke University und ein Stipendium über die vollen Studiengebühren an der Law School der University of Chicago. (Ich war auf Stipendien angewiesen; mein Vater arbeitete für das Postamt und verdiente nicht allzu gut.) Außerdem bekam ich einen Job bei der bekannten New Yorker Kanzlei Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, die mir überaus reizvoll erschien, weil dort prominente Persönlichkeiten, die in der Regierung gearbeitet hatten – wie zum Beispiel Ted Sorensen, einer der wichtigsten Berater John F. Kennedys –, angestellt waren. Als junger Anwalt bekam ich die Gelegenheit, mit den besten Anwälten der Kanzlei und mit den führenden Wirtschaftsbossen und Regierungsvertretern New Yorks zusammenzuarbeiten, als mir die Abwendung des drohenden Konkurses der Stadt anvertraut wurde.
Ich habe diese Arbeit für die Regierung genossen und hatte den Eindruck, eine staatliche Tätigkeit sei lohnenswert. Das niedrigere Gehalt war nicht von Bedeutung, denn Geld spielte eigentlich keine Rolle für mich. Ich hatte noch nie viel Geld gehabt und trachtete ehrlich gesagt auch gar nicht danach, allzu viel anzuhäufen. Die Politik und die öffentliche Ordnung reizten mich weit mehr.
Wäre ich bei der Kanzlei Paul, Weiss geblieben wäre, dann hätte ich womöglich eine juristische Fachrichtung eingeschlagen, wäre Partner geworden und dort für die nächsten gut 40 Jahre geblieben – bis zum Zwangsruhestand, den derartige Betriebe inzwischen ihren 65- bis 70-jährigen Partnern nahelegen. Doch diese Plattform, so begehrenswert sie womöglich für ambitionierte Anwälte war, hätte mir vermutlich nicht die Chance geboten, ein großer Akteur in der Welt des Staatsdienstes oder der Politik zu werden. Also schied ich nach zwei Jahren aus, um dem Traum nachzujagen, in der Bundesregierung und letztlich als Mitarbeiter des Weißen Hauses und Berater des Präsidenten zu arbeiten – wie Ted Sorensen.
Im Grunde war das eher ein Wunschtraum: Ich hatte weder politische Kontakte noch eine politische Karriere, und ich hatte erst vor Kurzem mein Jura-Examen bestanden. Aber ich fühlte mich zur Politik, zum Staatsdienst und dem Amt des Präsidenten hingezogen, und mit Wirtschaft hatte ich damals überhaupt nichts am Hut.
Dieser Traum begann vermutlich, als ich John F. Kennedy bei seiner eloquenten Antrittsrede am 20. Januar 1961 beobachtete. Er rief die Nation auf, sich den neuen Herausforderungen, mit denen die Welt konfrontiert wurde, zu stellen; und er inspirierte eine ganze Generation, sich für die Regierung und das allgemeine Wohl zu engagieren. Die Rede war ein Gedicht in Prosa, und seine Worte, jeder solle danach trachten, etwas für sein Land zu tun, behielt ich in meiner ganzen Jugend im Gedächtnis.
Für denjenigen, der die Gunst der Stunde nutzt, geht es manchmal ganz schnell.
Mit einer Empfehlung von Ted Sorensen verließ ich die Kanzlei und wurde juristischer Berater im U.S. Senate Judiciary Committee’s Subcommittee on the Constitution, also dem »Unterausschuss des Justizausschusses im US-Senat für die Verfassung« – ein ziemlich langer Titel für die Funktion des juristischen Beraters von Senator Birch Bayh in Angelegenheiten des Justizausschusses. Aber Bayh kandidierte für die Präsidentschaft, schien mir auch geeignet für dieses Amt und würde mich nach seiner unvermeidlichen Wahl mit Sicherheit in seinen Mitarbeiterstab holen.
Leider hatte die Schicksalsgöttin andere Pläne: Senator Bayh schied aus dem Rennen aus (allerdings wohl kaum wegen der schlechten Wahl eines Beraters im Justizausschuss) und beendete damit meine, wie ich glaubte, große Chance, im Weißen Haus zu arbeiten. Während meiner Tätigkeit im Senat hatte ich jedoch Gelegenheit, im Saal des Senats zu sitzen und die Großen jener Ära – die Senatoren Scoop Jackson, Warren Magnuson, Phil Hart, Jacob Javits, Howard Baker und Ted Kennedy – zu beobachten, wie sie ihre Führungsstärke unter Beweis stellten.
Als die Vorwahlen von 1976 ihrem Ende zu gingen, bekam ich einen Anruf von jemandem, der für einen anderen Kandidaten arbeitete, nämlich für Gouverneur Jimmy Carter, und wurde zu einem Bewerbungsgespräch für einen Job in seinem Politikstab nach der Nominierung eingeladen. Ich hielt die Chancen eines Erdnussfarmers, die Wahl zu gewinnen, für eher bescheiden, aber ich hatte nichts Besseres zu tun. Ich bekam den Job, zog nach Atlanta und unterstützte anschließend nach Kräften den innenpolitischen Chefberater Gouverneur Carters: Stuart Eizenstat.
Als ich zum Wahlkampfteam stieß, hatte Carter einen Vorsprung von mehr als 30 Prozentpunkten auf den Amtsinhaber Gerald Ford. Nach meinem Eingreifen gewann Carter mit einem Vorsprung von einem Punkt.
Zum Glück gab man nicht mir die Schuld am Schrumpfen des Vorsprungs, und letztlich wurde ich stellvertretender innenpolitischer Berater – ein Posten, für den ich eigentlich gar nicht qualifiziert war, wie ich zugeben muss. Die Jobs im Weißen Haus werden häufig mit den Leuten besetzt, die im Wahlkampf geholfen haben; das sind nicht unbedingt die am besten qualifizierten Kandidaten.
Ich hatte diesen Posten während der ganzen vier Jahre der Carter-Administration inne und genoss ihn in vollen Zügen. Wie könnte jemand aus bescheidener Herkunft, der erste College-Absolvent der Familie, keinen Gefallen daran finden, im Westflügel des Weißen Hauses zu arbeiten, mit Air Force One und Marine One zu reisen, sich mit dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten zu treffen und dem eigenen Boss Stuart Eizenstat dabei zu helfen, den innenpolitischen Stab im Weißen Haus zu leiten – und das mit Ende zwanzig und Anfang dreißig? Gab es überhaupt eine Steigerung im Leben?
Ich bezweifle, dass Erfahrung mich im ersten Drittel meiner Laufbahn wirklich zu einem »Leader« machte, aber es war mir mit einer gehörigen Portion Glück gelungen, eine bessere Karriere zu machen, als wenn Talent, Verstand und Führungsqualitäten die einzigen Kriterien gewesen wären.
Schließlich schlug, wie so oft im Leben, die Realität zu. Ich dachte, Carter würde die Wiederwahl gewinnen und ich in der zweiten Amtszeit womöglich auf einen höheren Posten im Weißen Haus befördert werden – um ein richtiger »Leader« zu werden. Die Wahlgötter hielten das jedoch anscheinend für keine gute Idee; Jimmy Carter wurde von Ronald Reagan vernichtend geschlagen!
Ich hätte das nie für möglich gehalten, denn Reagan würde kurz nach Amtsantritt 70 werden. Wie konnten die Amerikaner nur einen derart alten Mann wählen? Ich war damals 31. Heute bin ich 71, und inzwischen kommt mir dieses Alter um einiges jünger vor, als ich einst gedacht hatte.
Am einen Tag war ich ein junger, leitender Angestellter im Umfeld des Weißen Hauses, mit dem Potenzial, eine größere Führungsperson zu werden. Und am nächsten Tag war ich arbeitslos. Die Anwaltskanzleien rissen sich nicht gerade um einen 31-jährigen Ex-Berater aus der Carter-Administration, der gerade mal zwei Jahre Anwaltspraxis vorzuweisen hatte. Eine gewisse Bescheidenheit stellte sich rasch ein und verließ mich zum Glück nie wieder.
Es dauerte etliche Monate, bis ich eine Kanzlei fand, die bereit war, mir eine Chance zu geben. (Meiner Mutter sagte ich damals, ich hätte so viele Angebote, dass ich einfach etwas Zeit bräuchte, um sie zu prüfen.) Als ich schließlich eine Stelle annahm, wurde mir klar, warum sich die Anwaltskanzleien nicht um mich rissen. Ich hatte keine Erfahrung in der Justiz; kein Mensch wollte in der Reagan-Ära Erkenntnisse über die Carter-Administration; und ohne Spezialgebiet oder richtige juristische Ausbildung würde ich vermutlich für den Rest meines Lebens ein durchschnittlicher Anwalt bleiben, bestenfalls.
Also beschloss ich, ein Risiko einzugehen: die Juristerei an den Nagel zu hängen und eine neue (und tatsächlich die erste) Kapitalbeteiligungsgesellschaft in Washington, D.C., zu gründen.
Ich nehme an, fünf Faktoren gaben den Ausschlag:
Die Arbeit als Anwalt machte mir keine Freude – und ich erkannte, dass Erfolg im Beruf davon abhängt, dass man für das, was man tut, eine Leidenschaft entwickelt.
Ich las von einer überaus erfolgreichen Unternehmensübernahme, die dem ehemaligen Finanzminister William E. »Bill« Simon mit der Grußkartenfirma Gibson gelungen war. Er erzielte finanzielle Ergebnisse, die bei Weitem das überstiegen, was im Justizwesen möglich wäre. (Eine Investition in Höhe von 300 000 Dollar schnellte binnen nur 18 Monaten auf einen Wert von 70 Millionen Dollar.)
Ich betrachtete die Anwaltspraxis zunehmend als ein Geschäft, statt als eine Leidenschaft, und war der Meinung, dass ich, wenn ich in die Wirtschaft ginge, möglicherweise etwas ausprobieren könnte, das mir interessanter und lukrativer als die Tätigkeit als Anwalt erschien. (Meine frühere Verachtung für das Geldverdienen war mit der Gründung einer Familie verschwunden.)
Ich war der Meinung, in Washington herrsche in der Welt der Unternehmensübernahmen – es gab keine einzige Buyoutfirma – kaum Konkurrenz, somit war dies ein offenes Feld in einem aufstrebenden Sektor.
Zu guter Letzt hatte ich gelesen, dass Unternehmer tendenziell ihre Firmen noch vor dem 37. Lebensjahr gründeten und dass es nach diesem Alter viel weniger wahrscheinlich sei, dass sie jemals eine Firma gründen würden. Und ich war gerade 37.
Es gab eigentlich keinen Grund zu der Annahme, dass meine neue Beteiligungsgesellschaft Erfolg haben würde. Solche Firmen hatten in der Regel ihren Sitz in New York; kein Einziger meiner Geschäftspartner hatte Erfahrung an der Wall Street oder bei Unternehmensbeteiligungen; wir hatten am Anfang kein Geld; und wir hatten weder einen klaren Geschäftsplan noch Aussichten, uns Kapital zu beschaffen.
Doch die Firma, die Carlyle Group, fand tatsächlich eine Möglichkeit, in die Gänge zu kommen. Ich gewann drei Partner, die Investmenterfahrung hatten; es gelang mir im Jahr 1987 die ersten fünf Millionen Dollar für die Firmengründung aufzutreiben; und unsere ersten Deals hatten tendenziell Erfolg – was uns die nötige Glaubwürdigkeit verlieh, um letztendlich zu einer global agierenden Firma zu expandieren. Zur Überraschung aller, mich eingeschlossen, stiegen wir im Lauf der nächsten gut 30 Jahre zu einer der weltgrößten und bekanntesten Firmen im Bereich Private Equity auf, was dazu beitrug, aus mir im zweiten und letzten Lebensdrittel einen »Leader« zu machen, ungeachtet der bescheidenen Führungsqualitäten, die ich anfangs an den Tag gelegt hatte.
Über die Entwicklung zu einem »Leader« in der aufkeimenden Welt der Unternehmensbeteiligungen hinaus gab mir der Erfolg von Carlyle auch die Möglichkeit, und vielleicht auch das Selbstvertrauen, mich in der Welt der Philanthropie und der gemeinnützigen Organisationen zu engagieren.
Auf dem Feld der Philanthropie zählte ich zu den ersten Unterzeichnern der Kampagne Giving Pledge (ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates und Warren Buffett) und propagierte hauptsächlich das Konzept der »patriotischen Philanthropie«, d.h. Aktionen, um die Bevölkerung an die Geschichte und das Vermächtnis unseres Landes zu erinnern: der Kauf der Magna Carta und deren Aufbewahrung im Nationalarchiv; der Erhalt der wenigen Kopien der Unabhängigkeitserklärung und der Emanzipationsproklamation Lincolns; die Unterstützung der Sanierung des Washington Monument, des Lincoln Memorial, des Jefferson Memorial, von Jeffersons Sitz Monticello, der Hauptstadt von Vermont Montpelier und des Iwo Jima Memorial.
In der Welt der gemeinnützigen Organisationen habe ich als Vorstandsvorsitzender der Duke University, der Smithsonian Institution und als Co-Vorsitzender der Brookings Institution gedient; und derzeit arbeite ich als Vorstandsvorsitzender des John F. Kennedy Center for the Performing Arts and the Council on Foreign Relations, als Präsident des Economic Club von Washington, D.C., als Fellow der Harvard Corporation und als Kurator der National Gallery of Art, als Verwalter der University of Chicago, von Johns Hopkins Medicine, des Memorial Sloan Kettering Cancer Center und des Institute for Advanced Study. Ferner habe ich meine Tatkraft der Bildung gewidmet, indem ich in den Vorständen von vier großen Universitäten mitarbeitete und Stipendienprogramme für die Duke University, Harvard, die University of Chicago und für die staatlichen und freien Schulen in Washington, D.C., ins Leben rief.
Welche Eigenschaften haben es mir nun ermöglicht, von dem Typ eines Nichtführers in meiner ersten Lebensphase zu einer Führungsperson in der zweiten und dritten aufzusteigen?
Eine Selbstanalyse ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden, und es besteht die Gefahr, sich allzu sehr auf die Schulter zu klopfen. Doch die Faktoren, die ich hier nenne, sind die gleichen, die ich häufig von den Menschen höre, die ich in meiner Show interviewe:
Glück. Es besteht kein Zweifel daran, dass erfolgreiche Leader auf ihrem Weg offenbar unglaubliches Glück hatten. Eine zufällige Begegnung bescherte mir das Vorstellungsgespräch bei Stuart Eizenstat, das mir wiederum zu einem Posten im Weißen Haus verhalf. Die Arbeit dort endete zwar nicht gerade gut für mich, doch die Stelle verschaffte mir vermutlich genügend Präsenz, Selbstvertrauen und Ehrgeiz, um ohne finanzielle Erfahrung eine Beteiligungsgesellschaft zu gründen. Außerdem hatte ich das Glück, mit Bill Conway und Dan D’Aniello zwei Partner zu finden, die über sehr viel mehr Erfahrung im Finanzwesen verfügten als ich. Dass wir mehr als 30 Jahre lang als Partner zusammenblieben ist in der Geschäftswelt ungewöhnlich – und ein Glücksfall.
Streben nach Erfolg. Ein Leader muss auch den Drang verspüren, Erfolg zu haben – etwas Bedeutendes zu erreichen, ein Zeichen zu setzen, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu schaffen, die anderen wirklich nützt und von ihnen geschätzt wird. Womöglich hatte ich diesen Wunsch aus dem gleichen Grund, aus dem ihn viele Menschen aus bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen haben: um ein interessanteres und erfüllenderes Leben zu führen als das in der eigenen Kindheit erlebte. (Meine Eltern hatten weder die Highschool noch das College abgeschlossen; wir lebten in einem kleinen Reihenhaus mit knapp 75 Quadratmetern in einem jüdischen Arbeiterviertel von Baltimore.)
Etwas Neues und Einzigartiges als Ziel. Führungspersonen sind in der Regel Leute, die danach trachten, etwas zu bauen oder zu erschaffen – sich dorthin zu wagen, wo noch niemand versucht hat hinzugehen. Die Idee, in Washington eine Beteiligungsgesellschaft mit Menschen zu gründen, die keine Wall-Street-Erfahrung hatten, erschien vielen ein wenig lächerlich. Doch die typische Reaktion auf diese Idee war in Wirklichkeit positiv, verglichen mit der Reaktion auf meine darauffolgende Idee, eine Firma zu gründen, die alle Formen außerbörslicher Unternehmensbeteiligung, nicht nur Übernahmen, anbot, und zwar weltweit. Das hatte wirklich noch niemand gemacht.
Harte Arbeit/lange Arbeitstage. Es gibt keine Abkürzung auf dem Weg zu einer Führungsperson, es erfordert schlicht viele Stunden harter Arbeit. Es ist unmöglich, die dafür erforderlichen Fertigkeiten in einer Fünftagewoche und mit einem Achtstundentag zu entwickeln.
Ich hatte stets die Vorstellung, dass es brillantere und schlauere Leute als mich gebe und dass ich es mit ihnen nur aufnehmen könne, wenn ich länger und härter als sie arbeitete. Meine Tendenz zum »Workaholic« eckte im Laufe meiner Karriere an, aber ich nehme an, sie hielt mich auch von den charakteristischen Versuchungen als Jugendlicher oder Erwachsener ab, die nicht gerade karrierefördernd sind. Ein kleines Plus für Workaholics.
Aber in Wirklichkeit ist nach meiner Erfahrung Arbeitseifer nur dann ein Vorteil, wenn jemand auch externe Interessen hat, die andere, weniger spannungsgeladene Erfahrungen, Vergnügungen und intellektuelle Freude verschaffen. Sogar Einstein hatte das Bedürfnis, täglich Geige zu spielen und im Sommer regelmäßig segeln zu gehen.
Fokus. Konzentrieren Sie Ihre Tatkraft auf die wahre Beherrschung einer Fertigkeit oder eines Gegenstands; erweitern Sie ihren Fokus erst, nachdem Sie sich Glaubwürdigkeit als Meister auf einem Feld erarbeitet haben. Bei Carlyle beschloss ich, mich auf die Beschaffung des erforderlichen Kapitals zu konzentrieren, das für die wachsende Zahl an Investments nötig war, welche die Firma in den Vereinigten Staaten und weltweit tätigte. Sobald meine Fähigkeiten bei der Kapitalbeschaffung außer Frage standen, erweiterte ich meinen Fokus auf andere Aspekte der Firma.
Scheitern. Jeder erfolgreiche Mensch ist einmal oder sogar öfter gescheitert. Lernen Sie daraus und beweisen Sie, dass das Scheitern nur ein Versehen war. Der Umstand, dass ich einem »gescheiterten« Weißen Haus angehörte, schürte mit Sicherheit meinen Ehrgeiz, beim nächsten Karriereschritt Erfolg zu haben. Außerdem lehrt ein Scheitern Demut und steigert exponentiell das Bedürfnis, es das nächste Mal richtigzumachen.
Hartnäckigkeit. Fast schon per Definition macht ein Leader etwas Neues, anderes, Einzigartiges, etc. und wird deshalb auch auf Widerstand seitens derjenigen stoßen, denen der Status quo gefällt oder die ihn bewahren wollen. Entscheidend ist, hartnäckig zu bleiben, wenn andere Nein sagen oder gegen die Veränderung ankämpfen, die man durchsetzen will. Alle sagten mir, Carlyle könne auf keinen Fall die globale Firma werden, die mir vorschwebte. Je häufiger ich das zu hören bekam, desto fester war ich entschlossen, an meinem Traum und Ziel festzuhalten.
Überzeugungskraft. Es ist unmöglich, andere zu führen, wenn einem keiner folgt. Ein Leader kann Menschen durch eine der drei elementaren Kommunikationsmittel überzeugen, ihm zu folgen: etwas schreiben, das die Leser inspiriert; etwas sagen, das die Zuhörer motiviert; oder etwas tun, das anderen ein Beispiel gibt, dem sie nacheifern. Nur wenige Leader können gleich gut mit all diesen Mitteln umgehen, doch ich habe tatsächlich im Lauf der Jahre durch viel Praxis und Ausprobieren versucht, meine grundlegenden Schreib- und Redefertigkeiten zu verbessern und Aktionen zu verfolgen, von denen ich hoffte, sie würden andere veranlassen, meinem Beispiel zu folgen, insbesondere auf dem Feld der Philanthropie.
Demut. Manche Führungspersonen entwickeln mit der Zeit ein arrogantes Verhalten; andere erkennen wohl, dass sie weder allmächtig noch allwissend sind und dass sie das Glück auf ihrer Seite hatten – und daraus ergibt sich eine demütigere Haltung. Letztere ist deutlich effektiver, wenn es darum geht, sich Respekt zu verdienen.
Ganz offensichtlich waren einige der berühmtesten Leader der Welt nicht gerade angenehme Personen, das lag nicht zuletzt an ihrer allzu großen Arroganz. Meiner Meinung nach legen die effektiveren und ausdauernderen Führer eine Bescheidenheit an den Tag, die zeigt, dass sie ihre eigenen Schwächen und ihr großes Glück kennen. Ich habe mich in meinem Leben stets bemüht, bescheiden zu bleiben; das passt nicht nur zu meiner Persönlichkeit, es hat sich auch als wirkungsvollere Methode erwiesen, in anderen den Wunsch zu wecken, einem nachzufolgen.
Das Verdienst teilen. Die besten Führer erkennen unweigerlich, dass sie weit mehr bewirken können, wenn sie bereit sind, das Verdienst mit anderen zu teilen.
John F. Kennedy hat einmal eine chinesische Redensart zitiert: »Der Sieg hat viele Väter, und die Niederlage ist ein Waise.« Natürlich würde jeder gerne das Verdienst für gelungene Ergebnisse einstreichen; und daran ist auch nichts auszusetzen, solange das Verdienst angemessen geteilt wird. Ronald Reagan sagte einmal fast das Gleiche: »Es gibt keine Grenzen für das, was Menschen erreichen können, wenn sie bereit sind, das Verdienst zu teilen.« Ich habe festgestellt, dass es äußerst wirksam ist, so viel Verdienst wie möglich anderen zuzusprechen, wenn sich der Erfolg einstellt, und die Schuld auf sich zu nehmen oder zu teilen, wenn die Sache scheitert.
Die Fähigkeit, weiter zu lernen. Führungspersonen müssen tagtäglich ihr Wissen erweitern – schon um ihren einzigartigen »Muskel« zu trainieren: ihr Gehirn. Wenn man das nicht tut, fällt es schwer, mit einer sich rasch verändernden Welt Schritt zu halten und die stetig wachsende Menge an Informationen zu verarbeiten, die hilfreich sein kann, wenn man ein gut informierter und kompetenter Leader sein will.
Ich habe mich immer bemüht, durch ein fast schon zwanghaftes Lesen weiter zu lernen: sechs Zeitungen am Tag, wöchentlich mindestens ein Dutzend Zeitschriften, und wenigstens ein Buch pro Woche (häufig allerdings auch der Versuch, mit drei bis vier Büchern gleichzeitig zu Rande zu kommen). Nichts konzentriert den Verstand besser als ein gut geschriebenes Buch.
Integrität. Führungspersönlichkeiten legen unterschiedlich stark Wert auf Integrität und ethisches Verhalten, doch von den Besten wird erwartet, dass sie sich für ein ethisches Verhalten einsetzen – und dieses Engagement fördert wiederum ihre Führungskraft.
Als ich als Anwalt anfing, sagte der Leiter der Kanzlei, der ehemalige Richter Simon Rifkind, allen neuen Anwälten: »Es dauert ein Leben, sich einen Ruf zu erwerben, und nur fünf Minuten, um ihn zu ruinieren. Gehen Sie also keine ethischen Risiken ein, die Ihren Ruf – und Ihr Leben – ruinieren können.« Was bleibt dem noch hinzuzufügen?
Krisenmanagement. Führungspersönlichkeiten werden am dringendsten gebraucht, wenn es zu Krisen kommt, wie uns die COVID-19-Pandemie und die landesweiten Proteste wegen des Todes von George Floyd erneut vor Augen geführt haben. Sich der Aufgabe gewachsen zu zeigen, wenn eine existenzielle Krise ausbricht, kann einen Leader für alle Zeit kennzeichnen: Lincoln, wie er sein Land während eines Bürgerkrieges zusammenhielt, oder Churchill, wie er sein Land zum Kampf gegen die Nazis um sich scharte. In weit kleinerem Maßstab habe ich mich durch harte Arbeit und verbesserte Kommunikation bemüht, unsere Beschäftigten in einer Phase enormer, beispielloser finanzieller Belastung zu motivieren.
Zu den soeben beschrieben Erkenntnissen gelangte ich aufgrund meiner eigenen Erfahrungen mit Führungskräften und deren Beobachtung. Andere werden unweigerlich andere Ansichten vertreten, weil sie andere Erfahrungen gemacht haben und weil es nicht nur einen Führungstyp gibt.
In meinem Berufsleben umfasste meine eigene Erfahrung mit Führung Gründung, Aufbau, Erweiterung und Leitung einer Investmentfirma. Diese Form der Führung unterscheidet sich von den Arten der Führungserfahrungen, die viele der für dieses Buch befragten Menschen gemacht haben. Der Einfachheit halber habe ich sie in sechs Kategorien unterteilt:
Visionäre: Jeff Bezos, Bill Gates, Richard Branson, Oprah Winfrey und Warren Buffett
Gründer: Phil Knight, Ken Griffin, Robert F. Smith, Jamie Dimon und Marillyn Hewson
Veränderer: Melinda Gates, Eric Schmidt, Tim Cook, Ginni Rometty und Indra Nooyi
Befehlshaber: George W. Bush, Bill Clinton, Colin Powell, David Petraeus, Condoleezza Rice und James A. Baker III.
Entscheidungsträger: Nancy Pelosi, Adam Silver, Christine Lagarde, Anthony S. Fauci und Ruth Bader Ginsburg
Meister ihres Fachs: Jack Nicklaus, Mike »Coach K« Krzyzewski, Renée Fleming, Yo-Yo Ma und Lorne Michaels
In jedem Interview in diesem Buch habe ich versucht, den Gesprächspartner zu fragen, wie sie oder er zum Leader wurde und es blieb. Ihre Geschichten sind völlig verschieden, doch die Eigenschaften, die sie als ausschlaggebend für ihren Erfolg angeben, drehen sich unweigerlich tendenziell um die oben genannten Aspekte, die für einen guten Führer lebenswichtig sind. Die Interviews wurden bei Bedarf bezüglich der Länge und Stimmigkeit bearbeitet, in Rücksprache mit den Gesprächspartnern.
Ich hoffe, dass die Leser erkennen werden, dass eine Führungsposition gewisse Herausforderungen mit sich bringt; allein das Interesse, ein Leader zu werden, reicht nicht aus. Aber Menschen jeder Herkunft können es werden – und starke Führer können einen Teil der Welt zu einem besseren Ort machen.
David M. Rubenstein, Juni 2020
VISIONÄRE
Jeff Bezos
Bill Gates
Sir Richard Branson
Oprah Winfrey
Warren Buffett
Jeff Bezos
(*1964)
Gründer und CEO, Amazon; Eigentümer der Washington Post
»Wenn man eine Entscheidung aufgrund einer Analyse treffen kann, sollte man das auch tun. Aber es zeigt sich im Leben, dass die wichtigsten Entscheidungen stets mit dem eigenen Instinkt, der Intuition, dem Geschmack, dem Herzen getroffen werden.«
Jeff Bezos hatte keineswegs als Erster die Idee, Bücher über das Internet zu verkaufen. Das taten andere bereits, als er im Jahr 1994 Amazon gründete. Er hatte aber eine Vision, wie er mithilfe einer besseren Software den Verkaufsprozess effizienter gestalten konnte. Wichtiger noch, Jeff hatte am Ende die Vision, so gut wie alles über das Internet zu verkaufen – und das zu einer Zeit, als es im Grunde noch in den Kinderschuhen steckte.
Ich habe Jeff Bezos im Jahr 1995 zum ersten Mal in den sehr bescheidenen Büroräumen seines Start-ups in Seattle getroffen. Ich fuhr hin, weil ich einen Deal neu verhandeln wollte, den ein Unternehmen von Carlyle – Baker & Taylor, der zweitgrößte Buchvertrieb des Landes – zwei Jahre zuvor mit ihm ausgehandelt hatte. Nach diesem Abkommen gestattete Baker & Taylor es Amazon, ihr eigenes Titelverzeichnis zu nutzen und es Bezos so zu ermöglichen, Bücher über das Internet zu verkaufen.
Als Jeff zum ersten Mal an Baker & Taylor herantrat, schwamm er nicht gerade in Geld und bot ihnen eine Kapitalbeteiligung an dem neuen Unternehmen an. (Manche sprechen von 20 bis 30 Prozent.) Unser Vertreter wollte jedoch Bargeld und erzielte schließlich eine Zahlung von 100 000 Dollar jährlich über fünf Jahre.
Als mir allmählich klar wurde, dass eine Beteiligung womöglich vorteilhafter als Geld war, beschloss ich, Jeff in Seattle zu besuchen. Er erklärte mir höflich, dass er auf unser Titelverzeichnis nicht länger angewiesen sei und dass sein Unternehmen inzwischen einige Fortschritte gemacht hätte. Aber er sagte auch, dass Baker & Taylor ihm beim Start geholfen hätte und dass er uns eine Beteiligung gewähren würde – grob geschätzt 1 Prozent von Amazon – anstelle der jährlichen Bargeldzahlungen. Leider hatten wir nicht das nötige Vertrauen in Amazon und verkauften unsere Beteiligung kurz nach dem Börsengang im Jahr 1996 für rund 80 Millionen Dollar.
Mein größter geschäftlicher Fehler. Dieser Anteil hätte heute, nach Aktienaufteilungen und neuen Emissionen, einen Wert von ungefähr 4 Milliarden Dollar.
Seither hat Jeff die Welt des Einzelhandels, des Computing und der Weltraumforschung neu geschrieben und ist zum reichsten und einem der bekanntesten Menschen der Welt aufgestiegen. Anfang 2020 hat Amazon einen Marktwert von über eine Billion Dollar erreicht (mehr als 840 000 Teil- und Vollzeitbeschäftigte) und zählt zu den weltweit bekanntesten Markennamen, allgegenwärtig in den Vereinigten Staaten und zunehmend auf der ganzen Welt.
Im Lauf der Jahre habe ich Jeff ein bisschen näher kennengelernt und ihn mehrere Male interviewt. (Einmal in einem privaten Rahmen mit Bill Gates – das erste Mal, dass die beiden Nachbarn und Unternehmensführer gemeinsam interviewt wurden. Ich wünschte, es gäbe davon eine Aufnahme oder ein Transkript. Es wird wohl für alle Zeiten mein Lieblingsinterview bleiben.) Zusätzlich zu seinen außergewöhnlichen Führungsqualitäten ist Jeff auch ein hervorragender Interviewpartner: einnehmend, offen, scharfsichtig, selbstironisch, klug und interessant – eine seltene Kombination.
Alle wollen wissen, wie Jeff Amazon aufgebaut und in relativ kurzer Zeit zu derart großem Erfolg geführt hat. In diesem Interview, im September 2018 in Washington, D.C., gehalten, enthüllt er einige Geheimnisse: bereit sein, die Chance zu nutzen und zu scheitern, sich auf die langfristige Perspektive konzentrieren, den Kunden an die erste Stelle setzen, ausreichend Schlaf bekommen, Schlüsselentscheidungen weder zu früh noch zu spät am Tag treffen, und Eltern, die einen unterstützen.
Wenn dieses Muster bereits ausreichen würde, gäbe es viele Jeff Bezos und Amazons. Ich denke, es sind noch weitere Zutaten nötig – solche, die allein Jeff Bezos besitzt.
***
David Rubenstein (DR): Ihre Aktie ist dieses Jahr [2018] gerade um 70 Prozent gestiegen. Gibt es einen bestimmten Grund dafür, oder mehrere Gründe?
Jeff Bezos (JB): Wir veranstalten bei Amazon regelmäßig Belegschaftstreffen, und seit 20 Jahren sage ich auf fast jedem Treffen: »Wenn die Aktie in einem Monat um 30 Prozent steigt, fühlt euch nicht um 30 Prozent klüger. Denn wenn die Aktie in einem Monat um 30 Prozent fällt, wird es sich nicht so gut anfühlen, sich 30 Prozent dümmer vorzukommen.«
Das passiert einfach. Warren Buffett kommt ständig mit dem großartigen Zitat von Benjamin Graham daher, dass die Börse kurzfristig eine Abstimmungsmaschine und langfristig eine Waage ist. Man muss das eigene Unternehmen in dem Wissen führen, dass es eines Tages gewogen werden wird. Lassen Sie es einfach wiegen. Verschwenden Sie nie einen Gedanken an den aktuellen Aktienkurs. Ich mach’ das nie.
DR: Als Folge sind Sie einer der reichsten Männer der Welt geworden. Ist das ein Titel, den Sie wirklich wollten?
JB: Ich habe diesen Titel nie angestrebt. Es macht mir nichts aus, der zweitreichste Mensch auf der Welt zu sein. Es wäre mir lieber, wenn sie sagten »Erfinder Jeff Bezos« oder »Unternehmer Jeff Bezos« oder »Vater Jeff Bezos« – solche Dinge bedeuten mir viel mehr.
Ich besitze 16 Prozent von Amazon. Der Wert von Amazon beträgt grob eine Billion Dollar. Das heißt, wir haben ein Vermögen in Höhe von 840 Milliarden Dollar für andere Menschen aufgebaut.
Ich glaube fest an die Fähigkeit des unternehmerischen Kapitalismus und der freien Märkte, sehr viele Probleme der Welt zu lösen. Nicht alle, aber viele.
DR: Sie leben im Staat Washington, in der Nähe von Seattle. Der Mann, der rund 20 Jahre lang der reichste Mann der Welt war, heißt Bill Gates. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden reichsten Männer auf der Welt nicht nur im gleichen Land, im gleichen Staat, in der gleichen Stadt, sondern auch in der gleichen Wohngegend wohnen? Hat dieses Viertel etwas, das wir wissen sollten? Stehen dort zufällig noch Häuser zum Verkauf an?
JB: Medina ist eine großartige kleine Vorstadt von Seattle. Ich glaube nicht, dass in dem Wasser dort etwas Besonderes ist. Ich verlegte Amazon wegen Microsoft nach Seattle. Ich glaubte, dieser Pool an technischem Talent biete einen guten Ort, um fähige Menschen zu rekrutieren. Und das erwies sich als richtig. Also ist es nicht reiner Zufall.
DR: Erzählen Sie mir von Ihrem Vorgehen bei der Entwicklung und Entscheidungsfindung.
JB: Alles, was ich jemals gemacht habe, hat klein angefangen. Amazon hat mit einer Handvoll Leuten begonnen, Blue Origin [seine Raumfahrtfirma] mit fünf Menschen. Das Budget von Blue Origin war sehr, sehr klein. Jetzt nähert sich sein Jahresbudget der Milliarden-Dollar-Marke. Nächstes Jahr wird es bereits über einer Milliarde liegen.
Für Amazon arbeiten heute eine halbe Million Menschen; angefangen haben wir mit zehn, und es kommt mir vor wie gestern; ich habe die Pakete selbst zum Postamt gebracht und gehofft, dass wir uns eines Tages einen Gabelstapler würden leisten können!
Ich habe beobachtet, wie kleine Dinge groß wurden. Ich behandle Dinge gerne so, als wären sie klein. Auch wenn Amazon ein großes Unternehmen ist, möchte ich, dass es das Herz und die Seele eines kleinen hat.
Der Day One Families Fund [die 2018 gegründete, wohltätige Stiftung von Bezos, die gemeinnützige Organisationen unterstützt, die mit Obdachlosen und bei der Früherziehung von Kindern arbeiten] wird genauso sein. Wir werden auch ein bisschen herumschlendern. Wir haben ein paar sehr konkrete Ideen, was wir tun wollen, aber ich glaube an die Kraft des Umherwanderns. Meine besten Entscheidungen im Geschäft und im Leben habe ich alle mit dem Herzen, der Intuition, dem Bauch getroffen, nicht aufgrund einer Analyse.
Wenn man eine Entscheidung aufgrund einer Analyse treffen kann, sollte man das auch tun. Aber es zeigt sich im Leben, dass die wichtigsten Entscheidungen stets mit dem eigenen Instinkt, der Intuition, dem Geschmack, dem Herzen getroffen werden.
Ich unterhalte mich so oft mit anderen CEOs und Gründern und Unternehmern, und ich kann sagen, dass sie sich, auch wenn sie über Kunden reden, in Wirklichkeit auf ihre Rivalen konzentrieren. Es ist ein großer Vorteil für jedes Unternehmen, wenn man den Fokus auf die Kunden lenken kann, statt auf die Konkurrenten.
Und dann muss man natürlich herausfinden, wer die eigenen Kunden sind. Bei der Washington Post etwa sind die Kunden diejenigen, die von uns Inserate kaufen? Nein. Der Kunde ist der Leser. Punkt.
Und wo sind die Inserenten am liebsten? Inserenten sind dort am liebsten, wo es Leser gibt. Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert.
Bei einer Schule, wer sind da die Kunden? Sind es die Eltern? Sind es die Lehrer? Nein. Es ist das Kind. Genau das werden wir bei Day One anstreben. Wir werden uns auf das Kind konzentrieren. Wir werden wissenschaftlich vorgehen, wo es möglich ist, und wir werden unser Herz und unsere Intuition nutzen, wo es nötig ist.
DR: Warum haben Sie eigentlich die Washington Post gekauft? Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen? Sie hatten keinerlei Hintergrund auf dem Gebiet.
JB: Ich hatte nicht die Absicht, eine Zeitung zu kaufen, hatte nie daran gedacht. Es war nicht etwa ein Kindheitstraum von mir.
Mein Freund Don Graham [1979–2000 Herausgeber der Washington Post] – wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren – trat über einen Mittelsmann an mich heran und erkundigte sich, ob ich Interesse hätte, die Post zu kaufen. Ich erwiderte, dass ich kein Interesse hätte, weil ich wirklich nichts von Zeitungen verstände.
Im Laufe von mehreren Gesprächen überzeugte Don mich, dass das keine Rolle spielte, weil es innerhalb der Washington Post so viele Talente gebe, die etwas von Zeitungen verständen. Was sie brauchten, sei jedoch jemand, der eine Ahnung vom Internet hat.
Ich ging eine Zeit lang in mich. Meine Entscheidungsfindung in so einer Frage lief eindeutig über Intuition, nicht über Analyse.
Die finanzielle Situation der Washington Post tendierte zu der Zeit – 2013 – sehr stark nach unten. Es handelt sich um eine Branche mit festen Kosten, und ihnen war im Lauf der letzten fünf oder sechs Jahre ein großer Teil der Einnahmen weggebrochen. Ich sagte mir: »Ist das etwas, in das ich hineingezogen werden will? Und wenn ich es tue, dann werde ich wohl ein wenig Herz und einige Arbeit in das Projekt investieren.« Ich beschloss es nur zu tun, wenn ich wirklich überzeugt war, dass es eine wichtige Institution ist.
Kaum fing ich an, so zu denken, da war mir klar: »Das ist eine wichtige Institution. Es ist die Zeitung in der Hauptstadt des wichtigsten Landes auf der Welt. Die Washington Post hat in dieser Demokratie eine unglaublich wichtige Rolle inne.«
Heutzutage, mit dem Internet, bekommt man das Geschenk der kostenlosen Verbreitung. Wir mussten uns dieses Geschenk zunutze machen. Das war die Basisstrategie. Wir mussten von einem Geschäftsmodell, bei dem man bei einer relativ kleinen Zahl von Lesern viel Geld pro Leser verdiente, zu einem mit wenig Geld pro Kopf bei einer sehr großen Zahl von Lesern wechseln. Eben diesen Wandel haben wir geschafft.
Es freut mich zu vermelden, dass die Post heute profitabel arbeitet. Die Nachrichtenabteilung wächst.
DR: Als Sie einwilligten, die Zeitung zu kaufen, lag der geforderte Preis bei 250 Millionen Dollar. Haben Sie verhandelt?
JB: Nein. Ich fragte Don, wie viel er haben wollte. Er sagte: »250 Millionen.« Ich sagte: »In Ordnung.« Ich habe mit ihm nicht gehandelt. Ich machte keine Kaufprüfung. Bei Don hatte ich das nicht nötig.
DR: Ich habe etwas, das ich gerne verkaufen würde. … Sie sind in Texas aufgewachsen?
JB: Ich wurde in Albuquerque geboren, aber im Alter von drei oder vier verließ ich es und zog nach Texas.
DR: Und seit Ihrer Kindheit waren Sie ein ziemlich guter Schüler?
JB: Ich bin schon immer akademisch klug gewesen. Je älter ich werde, desto klarer erkenne ich, wie viele Arten von Klugheit es gibt. Es gibt auch viele Arten von Dummheit. Ich treffe ständig Leute, die in ihren Mathe-Prüfungen keine Eins plus bekommen hätten, aber unglaublich klug sind. Aber ja, ich war ein sehr guter Schüler.
DR: Sie haben als Jahrgangsbester Ihren Abschluss gemacht. Wie kam es, dass Sie sich für Princeton entschieden?
JB: Ich wollte theoretischer Physiker werden, also ging ich nach Princeton. Ich war im Begabtenkurs für Physik, der mit 100 Studenten startet. Bis die Quantenmechanik behandelt wird, sind es vielleicht noch 30.
Da sitze ich also in der Quantenmechanik, und ich habe etliche Informatikkurse und Elektrotechnikkurse belegt, die mir auch Spaß machen. Und ich kann diese partielle Differentialgleichung nicht lösen. Sie ist wirklich richtig schwer. Ich habe mit meinem Zimmergenossen Joe studiert, der auch sehr gut in Mathe war.
Wir beide plagten uns drei Stunden lang an dieser einen Hausaufgabe ab und kamen nicht weiter. Schließlich blicken wir im gleichen Moment auf, schauen uns über den Tisch an und sagen: »Yasantha«, weil Yasantha das schlauste Kerlchen in Princeton war.
Wir gehen zu Yasanthas Zimmer und zeigen ihm das Problem. Er sieht es sich an. Er starrt eine Zeit lang darauf und sagt: »Cosinus.« »Wie bitte?« »Das ist die Antwort.« »Das ist die Antwort?« »Klar, ich zeig’s euch.« Er schreibt drei Seiten ausführlicher Algebra runter. Alles kürzt sich weg, und die Antwort ist Cosinus.
Ich sagte: »Yasantha, hast du das alles einfach in deinem Kopf gemacht?« Er sagte: »Nein, das wäre unmöglich. Vor drei Jahren habe ich ein ganz ähnliches Problem gelöst, und ich war imstande, dieses Problem auf euer Problem zu übertragen, und dann war sofort offensichtlich, dass die Antwort Cosinus lautete.« Das war ein wichtiger Moment für mich, weil es der Moment war, in dem ich erkannte, dass ich niemals ein großartiger theoretischer Physiker sein werde.
In der theoretischen Physik muss man zu den besten 50 Leuten auf der Welt zählen, oder man wird wirklich keine große Leuchte sein. Ich las die Schrift an der Wand, und ich wechselte ganz schnell mein Hauptfach zu Elektrotechnik und Informatik.
DR: Aber Sie schlossen mit summa cum laude ab.
JB: Ich habe mit summa cum laude abgeschlossen.
DR: Phi Beta Kappa1.
JB: Phi Beta Kappa.
DR: Und dann gingen Sie in die höchste Berufung der Menschheit: Finanzen.
JB: Ja. Ich ging nach New York City und arbeitete schließlich für einen quantitativen Hedgefonds, der von einem brillanten Mann namens David Shaw geleitet wurde: D. E. Shaw and Company. Ich fing dort an, als es nur 30 Mitarbeiter gab. Als ich ging, waren es rund 300.
David ist immer noch einer der herausragendsten Menschen, denen ich jemals begegnet bin. Ich habe von ihm so viel gelernt. Viele seiner Ideen und Prinzipien in Dingen wie Personalfragen und Anwerben und in der Frage, welche Leute man einstellt, habe ich umgesetzt, als ich Amazon startete.
DR: Sie waren dort ein Star, wie ich das sehe. Was hat Sie veranlasst zu sagen: »Ich steige hier aus. Ich werde ein Unternehmen für den Verkauf von Büchern über das Internet gründen, und das mache ich von Seattle aus?« Wie kamen Sie auf diese Idee?
JB: Wir schreiben das Jahr 1994. Kein Mensch hat etwas vom Internet gehört. Nur ganz wenige Leute. Zu der Zeit wurde es von Wissenschaftlern und Physikern genutzt. Wir haben es bei D. E. Shaw für ein paar Arbeiten eingesetzt, aber nicht viele.
Ich stolperte über die Tatsache, dass das World Wide Web mit einer Geschwindigkeit von so um die 2300 Prozent jährlich wuchs. Und das im Jahr 1994. Alles, was so schnell wächst, wird irgendwann richtig groß sein. Ich schaute mir das an, und ich dachte etwa: »Ich sollte eine Geschäftsidee entwickeln und ins Internet bringen, und dann lass das Internet rings um uns wachsen. Und wir können weiter daran arbeiten.«
Ich erstellte eine Liste von Produkten, die ich online verkaufen könnte. Ich fing an, sie nach Erfolgschancen zu sortieren, und ich entschied mich für Bücher. In einer Hinsicht sind Bücher überaus ungewöhnlich, nämlich dass es mehr Produkte in der Kategorie Buch als in jeder anderen Kategorie gibt. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt werden weltweit drei Millionen verschiedene Bücher gedruckt. Folglich bestand die Gründungsidee für Amazon darin, eine universale Auswahl von Büchern aufzubauen. Die größten Buchhandlungen hatten lediglich 150 000 Titel.
Und das machte ich dann. Ich stellte ein kleines Team ein, wir entwickelten die Software, und ich zog nach Seattle um.
DR: Warum wählten Sie Seattle aus – wegen Microsoft?
JB: Es waren zwei Faktoren. Das größte Buchdepot auf der Welt befand sich damals nicht weit entfernt, in einer Stadt namens Roseburg, Oregon – und dazu kam der Rekrutierungspool, den Microsoft bot.
DR: Sie haben Ihren Eltern gesagt, dass Sie aus dem Hedgefonds aussteigen würden, wo Sie erfolgreich waren und vermutlich ganz ordentlich verdient haben. Sie haben Ihrer Frau MacKenzie gesagt, dass Sie ans andere Ende des Landes ziehen würden. Was haben sie alle dazu gesagt?
JB: Sie waren sofort hilfsbereit – gleich nach der Frage: »Was ist das Internet?« Bei den eigenen Liebsten, da setzt man auf sie. Man setzt nicht auf die Idee. Man setzt auf die Person.
Als ich meinem Boss, David Shaw, erzählte, dass ich dieses Projekt durchziehen wollte, machten wir einen langen Spaziergang im Central Park. Am Ende, nachdem er viel zugehört hatte, sagte er: »Ich denke, Sie haben da eine gute Idee. Aber das wäre eine bessere Idee für jemanden, der nicht schon einen guten Job hat.« Das klang für mich tatsächlich so vernünftig, dass er mich zwang, zwei Tage darüber nachzudenken, bevor ich mich endgültig entschied.
Das ist eine jener Entscheidungen, die ich mit dem Herzen und nicht mit dem Kopf traf. Ich sagte im Grunde: »Wenn ich 80 bin, dann will ich möglichst wenig zu bedauern haben in meinem Leben.« Der größte Teil des Bedauerns sind Versäumnisse. Es sind die Dinge, die wir nicht ausprobiert haben. Es ist der Pfad, den man nicht gegangen ist. Das sind die Dinge, die uns ein Leben lang verfolgen.
DR: Sie haben erwähnt, dass Sie am Anfang selbst die Bücher zum Postamt gebracht haben.
JB: Ja, das habe ich jahrelang gemacht. Im ersten Monat packte ich auf Händen und Knien auf dem harten Betonboden Kartons, mit noch einem neben mir auf den Knien. Ich sagte: »Weißt du, was wir brauchen? Knieschoner. Das ist Gift für meine Knie.« Der Mann, der neben mir packte, sagte: »Wir brauchen Packtische.« Ich war begeistert: »Das ist die beste Idee, die ich je gehört habe.« Am nächsten Tag kaufte ich Packtische, und das verdoppelte unsere Produktivität.
DR: Woher kam der Name Amazon?
JB: Der größte Fluss der Erde, die größte Vielfalt.
DR: Das klingt einfach. War es eine einfache Entscheidung oder gab es andere Kandidaten?
JB: Zuerst nannte ich es Cadabra. Es ist wirklich schwierig, Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, wie klein dieser Anfang wirklich war. Aber als ich nach Seattle fuhr, wollte ich, dass wir sofort loslegen konnten. Ich wollte ein amtlich registriertes Unternehmen, und ich wollte, dass bereits ein Bankkonto eröffnet war.
Also rief ich einen Freund an, und der empfahl mir seinen Anwalt. Es stellte sich heraus, dass der Mann in Wirklichkeit sein Scheidungsanwalt war. Aber er registrierte das Unternehmen für mich und eröffnete Bankkonten. Er sagte: »Ich muss für den Registrierungsantrag wissen, wie Sie das Unternehmen nennen wollen.«
Ich sagte – am Telefon wohlgemerkt – »Cadabra«. Wie Abracadabra. Er sagte: »Kadaver?« Und da war mir klar: Okay, das wird nicht funktionieren. Ich sagte: »Machen Sie fürs Erste mit Cadabra weiter, und ich werde ihn ändern.« Drei Monate danach änderte ich den Namen zu Amazon.
DR: Wenn Sie nur Bücher verkauft hätten, wären Sie heute vermutlich nicht der reichste Mann der Welt. Wann hatten Sie zum ersten Mal die Idee, andere Waren zu verkaufen?
JB: Nach den Büchern kamen Musik und schließlich Videos. Dann hatte ich eine gute Idee und verschickte an 1000 zufällig ausgewählte Kunden E-Mails und fragte sie: »Außer den Waren, die wir heute verkaufen, was würden Sie sich noch von uns wünschen?«
Die Antworten waren unglaublich. Im Grunde sollten wir, was immer die Kunden sich derzeit wünschten, anbieten. Ich weiß noch, dass eine Mail lautete: »Ich wünschte, ihr würdet Scheibenwischerblätter verkaufen, weil ich unbedingt Scheibenwischerblätter brauche.«
Wir können auf diese Weise alles verkauften, habe ich gedacht. Dann starteten wir Elektronikartikel und Spiele und im Laufe der Zeit viele andere Kategorien. Aber wenn man den ursprünglichen Geschäftsplan liest, sind es nur Bücher.
DR: Ihr Aktienkurs stieg einmal auf 100 Dollar, und fiel dann auf 6 Dollar, oder so um den Dreh.
JB: Auf dem Höhepunkt der Internet-Blase hatte unsere Aktie einen Höchststand von rund 113 Dollar. Dann, nachdem die Blase platzte, fiel unsere Aktie auf 6 Dollar. In nicht einmal einem Jahr stürzte der Kurs von 113 auf 6 Dollar ab. Mein Jahresbrief an die Aktionäre fing in diesem Jahr mit einem recht kurzen Satz an: »Autsch!«
DR: Die meisten Internetfirmen der Dotcomära sind nicht mehr im Geschäft. Was gab den Ausschlag dafür, dass Sie überlebten, während so gut wie alle anderen zumachten?
JB: Diese ganze Phase ist sehr interessant, weil die Aktie nicht das Unternehmen ist und das Unternehmen nicht die Aktie. Während ich zusah, wie der Kurs von 113 auf 6 Dollar fiel, beobachtete ich auch alle unsere internen Geschäftsdaten: Zahl der Kunden, Gewinn pro Einheit, was immer Sie sich vorstellen können. Jeder einzelne Koeffizient bei dem Geschäft verbesserte sich, und das schnell.
Während also der Aktienkurse in die falsche Richtung wies, entwickelte sich alles innerhalb des Unternehmens in die richtige Richtung. Wir mussten uns nicht wieder an die Kapitalmärkte wenden, wir brauchten nicht mehr Geld. Eine finanzielle Pleite wie das Platzen der Internet-Blase erschwert es unheimlich, Geld aufzutreiben, aber wir hatten bereits das Kapital, das wir brauchten. Wir mussten einfach nur weitermachen wie bisher.
DR: Die Wall Street sagte unablässig: »Amazon erwirtschaftet kein Geld. Sie gewinnen nur Kunden. Wo sind die Gewinne?« Die Wall Street rieb Ihnen das ständig unter die Nase. Ihre Antwort lautete: »Es ist mir völlig gleichgültig, was ihr denkt.«
JB: Ich war im Fernsehen mit Tom Brokaw [einem Moderator der NBC]. Er holte ein halbes Dutzend Internetunternehmer aus jener Ära ins Studio. Das war kurz vor dem Platzen der Blase, oder vielleicht gleich danach.
Er interviewte uns alle, und schließlich wandte er sich mir zu und sagte: »Mr. Bezos, können Sie Profit überhaupt buchstabieren?« Tom ist, nebenbei bemerkt, inzwischen ein guter Freund von mir. Er also: »Können Sie Profit überhaupt buchstabieren?« Ich sagte: »Klar. P-r-o-p-h-e-t.« Und er bekam einen Lachanfall.
Die Leute warfen uns immer vor, Dollarnoten für 90 Cent zu verkaufen, und sagten: »Na ja, das könnte jeder machen und damit Einnahmen erzielen.« Aber das ist nicht das, was wir machen. Wir hatten immer positive Handelsspannen. Es ist ein Fixkostengeschäft. Was ich an den internen Daten ablesen konnte, war, dass wir ab einem bestimmten Umsatz unsere Fixkosten decken würden und das Unternehmen rentabel war.
DR: Amazon Prime ist allem Anschein nach eine großartige Methode, Geld einzunehmen, bevor die Kunden tatsächlich Waren und Dienstleistungen erhalten. Wer hatte diese Idee?
JB: Wie viele Erfindungen kam sie in einem Team auf. Ich liebe Team-Innovationen; das ist mein Lieblingsprojekt. Ich lebe dann zwei oder drei Jahre in der Zukunft. Jemand hat eine Idee, dann verbessern andere Leute die Idee, andere haben Einwände, weshalb das nie funktionieren kann, dann zerstreuen wir diese Einwände. Das macht großen Spaß.
Bei Prime kamen mehrere Dinge zusammen. Ein Vorstandsmitglied, Bing Gordon, wollte immer, dass wir ein Treueprogramm anbieten. Wir fragten uns immer wieder: »Wie könnte ein Treueprogramm aussehen?« Ein Software-Ingenieur kam auf die Idee, dass wir den Leuten eine Art All-you-can-eat-Buffet schneller, kostenloser Warenlieferung anbieten könnten.
Das Finanzteam ging her und arbeitete ein Modell für die Idee aus. Die Ergebnisse waren schockierend. Transport ist kostspielig, aber Kunden lieben kostenlose Lieferungen. Es sollte keinen Mindestbestellwert geben. Man konnte ein einziges Produkt für 20 Dollar oder ein einziges Produkt für 10 Dollar kaufen und eine kostenlose Lieferung innerhalb von zwei Tagen bekommen. Als wir das Modell hatten, sah es gar nicht attraktiv aus. Aber eines war klar – einmal mehr zurück zu dem Gedanken, dass man Herz und Intuition befragen muss –, man muss ein gewisses Risiko eingehen, man muss dem Instinkt folgen. Alle guten Entscheidungen sollten auf diese Weise getroffen werden.
Wenn man das mit einer Gruppe macht, dann macht man es mit großer Bescheidenheit, weil es nicht ganz so schlimm ist, wenn es schiefgeht. Wir haben echte Knaller gehabt, wie das Fire Phone und viele andere Dinge, die einfach nicht funktioniert haben. Wir haben nicht genügend Zeit dafür, dass ich alle unsere gescheiterten Experimente aufzählen könnte. Aber die großen Gewinner bezahlen Tausende gescheiterter Experimente.
Also testet man etwas wie Prime. Am Anfang war es sehr teuer. Es kostete uns eine Menge Geld. Was passiert, wenn man ein kostenloses All-you-can-eat-Buffet anbietet? Wer taucht als Erster bei dem Buffet auf? Die großen Esser! Es ist beängstigend. »Oh, mein Gott, habe ich wirklich so viele Garnelen, wie ihr essen könnt, gesagt?«
Aber wir konnten die Trends erkennen. Wir sahen, dass alle möglichen Kunden kamen, und sie schätzten diesen Service sehr. So kam es zu Prime.
DR: Sie mögen keine Sitzungen vor 10 Uhr.
JB: Nein.
DR: Sie legen Wert auf acht Stunden Schlaf.
JB: Ich gehe früh ins Bett. Ich stehe früh auf. Ich trödle gerne am Morgen. Ich lese gerne die Zeitung, trinke Kaffee. Ich liebe es, mit den Kindern zu frühstücken, bevor sie in die Schule gehen.
Also habe ich meine Trödelzeit, die mir sehr wichtig ist. Aus diesem Grund lege ich meinen ersten Termin auf zehn. Meine sogenannten Hoch-IQ-Sitzungen erledige ich am liebsten vor dem Mittagessen. Alles, was mental richtig anstrengend sein wird, gehört in eine Sitzung um 10 Uhr.
Gegen 17 Uhr geht es mir so: »Ich kann heute nicht darüber nachdenken. Lasst uns morgen um zehn nochmal drangehen.« Ich brauche acht Stunden Schlaf. Dann kann ich besser denken. Ich habe mehr Energie. Meine Laune ist besser.
Und überlegen Sie mal: Als leitender Angestellter, wofür werden Sie denn wirklich bezahlt? Sie werden dafür bezahlt, eine kleine Anzahl sehr wichtiger Entscheidungen zu treffen. Ihr Job ist es nicht, täglich Tausende von Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie jeden Tag drei gute Entscheidungen treffen, dann reicht das. Warren Buffett sagt, er sei schon gut, wenn er drei richtige Entscheidungen im Jahr fällt. Ich kaufe ihm das wirklich ab.
Alle unsere leitenden Angestellten gehen genauso vor wie ich. Sie arbeiten in der Zukunft, sie leben in der Zukunft. Kein einziger Mitarbeiter, der mir unterstellt ist, sollte sich wirklich auf das aktuelle Quartal konzentrieren.
Wir werden eine gute vierteljährliche Pressekonferenz oder etwas in der Art veranstalten, und der Wall Street werden unsere Quartalszahlen gefallen. Leute werden mich anhalten und sagen: »Glückwunsch zu Ihrem Quartalsergebnis«, und ich sage: »Danke.« Aber was ich wirklich dabei denke, ist: »Dieses Quartal wurde schon vor drei Jahren vorbereitet.«
Momentan arbeite ich an einem Quartal, das sich irgendwann im Jahr 2022 erweisen wird. Genau das ist Ihr Job. Sie müssen zwei oder drei Jahre im Voraus arbeiten.
DR: Wenn Sie bei Amazon kaufen, bekommen Sie dann jemals eine falsche Ware? Rufen Sie an und beschweren Sie sich, oder haben Sie überhaupt keine Probleme?
JB:





























