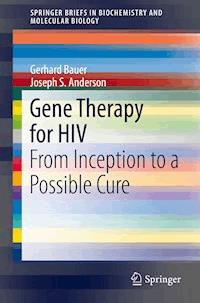Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der österreichische Musikjournalist Gerhard Bauer blickt zurück auf sein Leben. Welch herrliche Zeiten, die Bubenjahre damals in Wien! In der Nachkriegszeit am Gymnasium bildet sich sein Berufswunsch heraus: Irgendetwas, bei dem Musik vorkommt, soll es sein. 1955 wird die Wiener Staatsoper wiedereröffnet. 1956 schreibt Bauer seinen ersten Zeitungsartikel, ein fiktives Interview mit Mozart. Das Angebot einer großen deutschen Zeitung lockt. Von Wien geht es nach Köln. Bauer lernt die Schattenseiten des Journalismus kennen, muss als Kritiker oft mehr einstecken, als er austeilt. Aber auch die Schönheiten im Dasein der schreibenden Zunft warten auf ihn. Er reist, trifft Prominenz und erlebt viel Amüsantes in der bunten Opernwelt. „Schön war’s fast immer“, stellt er heute im Nachhinein fest.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Mit vier beginnt der Ernst des Lebens
Die Musik war die erste Liebe
Herrliche Zeiten mitten im Krieg
Von der Universität zum Militär
Abschied von Wien, Beginn in Köln
Erstes Familienleben in Köln
Die Manieren der Chefredakteure
Ein schönes Jahr im Norden: Flensburg
Erotische Intermezzi nach der Ehescheidung
Ursula tritt in mein Leben
Revolution im Zeitungswesen: Lichtsatz
Vom Redakteur zum freien Mitarbeiter
Die Parodie einer Musikkritik
Europa-Reisen zu Kunst und Kultur
Stirbt das Print-Medium der Tageszeitung aus?
Alfred lachte wie ein mährischer Viehhändler
Horst Ebenhöh, ein wunderbarer Musiklehrer
Hans Haselböck, Lateinlehrer und Organist
Umschwärmte Tenöre: Di Stefano und Dermota
Der Regisseur Günter Krämer und seine Rätsel
Friedrich Hebbels Gedanken und Läuse
Siziliens Gefahren und Reize
Wiedersehen mit Graziella Sciutti
Christian Schullers Kölner Kinderoper
Stimmenfängerei um Kölner Theaterbauten
Eröffnung der Kölner Philharmonie
Das große Wunder Dubrovnik
Opernprobleme in Bonn und Düsseldorf
Die alte und die neue Musik
Behagliches Altern in Kölns Schrebergärten
Gerhard Bauer
„Huch, ein Kritiker!“
Leben und Lieben
eines Wiener Journalisten in Köln
Autobiographie
AUGUST VON GOETHE LITERATURVERLAG
FRANKFURT A.M. • LONDON • NEW YORK
Die neue Literatur, die – in Erinnerung an die Zusammenarbeit Heinrich Heines und Annette von Droste-Hülshoffs mit der Herausgeberin Elise von Hohenhausen – ein Wagnis ist, steht im Mittelpunkt der Verlagsarbeit. Das Lektorat nimmt daher Manuskripte an, um deren Einsendung das gebildete Publikum gebeten wird.
©2018 FRANKFURTER LITERATURVERLAG
Ein Unternehmen der
FRANKFURTER VERLAGSGRUPPE GMBH
Mainstraße 143
D-63065 Offenbach
Tel. 069-40-894-0 ▪ Fax 069-40-894-194
E-Mail [email protected]
Medien- und Buchverlage
DR. VON HÄNSEL-HOHENHAUSEN
seit 1987
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.d-nb.de.
Websites der Verlagshäuser der
Frankfurter Verlagsgruppe:
www.frankfurter-verlagsgruppe.de
www.frankfurter-literaturverlag.de
www.frankfurter-taschenbuchverlag.de
www.publicbookmedia.de
www.august-goethe-von-literaturverlag.de
www.fouque-literaturverlag.de
www.weimarer-schiller-presse.de
www.deutsche-hochschulschriften.de
www.deutsche-bibliothek-der-wissenschaften.de
www.haensel-hohenhausen.de
www.prinz-von-hohenzollern-emden.de
Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, Speicherung, Sendung und Vervielfältigung in jeder Form, insbesondere Kopieren, Digitalisieren, Smoothing, Komprimierung, Konvertierung in andere Formate, Farbverfremdung sowie Bearbeitung und Übertragung des Werkes oder von Teilen desselben in andere Medien und Speicher sind ohne vorgehende schriftliche Zustimmung des Verlags unzulässig und werden auch strafrechtlich verfolgt.
Titelbilder: Markus Nanjoks/pixabay.de; Mohamed Hassan/pixabay.de & Gerfried Wagner/pixabay.de
Abbildungen im Texteil: Ursula Kronenberg Bauer und Gerhard Bauer
Lektorat: Dr. Annette Debold
ISBN 978-3-8372-2142-8
Ich widme dieses Buch Horst Ebenhöh, meinem Lehrer am Kremser Piaristengymnasium, der mir alle Tore zur Musik geöffnet hat, und Ursula Kronenberg-Bauer, meiner Frau, die mit mir durch all diese Tore gegangen ist.
Vorwort
Im Jahre 2004 gab es im Kölner Stadt-Anzeiger die Reportage-Serie „Mein Deutschland“. Mitarbeiter des Hauses waren aufgefordert, ihre Gedanken und Gefühle zum Land, in dem sie leben, unverblümt und subjektiv auszudrücken. Als die Reihe an mich, den Kulturredakteur mit dem Hauptfach „Klassische Musik“ kam, waren die Kollegen schon im Vorfeld sehr neugierig auf meine Auslassungen. Hatten sie mich doch immer wieder verwundert gefragt: Was macht denn ein Wiener ausgerechnet in Köln? Da legte ich los und erzählte, von meiner Liebe zur Musik und zur Zeitung, zu den Menschen und zum Leben. Als die Geschichte dann auf einer Doppelseite der Wochenend-Ausgabe erschienen war, erntete ich einiges Lob. Und eine mir im Grunde gar nicht sehr gewogene Kollegin beteuerte: „Ich habe mich köstlich amüsiert und sehr viel erfahren, ich könnte stundenlang weiter lesen.“
Da klickte es bei mir: Stundenlang?
Tagelang geb‘ ich euch zu lesen, Stoff habe ich genug. Und ich wühlte in den Erinnerungen und Erlebnissen von 47 Jahren als hauptberuflicher Journalist vor deutsch-österreichischem Horizont – immer mit dem Wunsch und dem Ziel, durch das Lesen zum Lachen und zum Lernen zu führen. Und mit der Hoffnung, mit diesem Buch auch ein Zeitbild und ein Panorama vom Musikbetrieb und vom Pressewesen all dieser Jahre geleistet zu haben.
Gerhard Bauer
Köln, im Februar 2018
Mit vier beginnt der Ernst des Lebens
„Schnaub dir die Nas’!“, sagte die alte Dorn. „Schnaub dir die Nas!“ Alle anderen hätten gesagt: „Schnaitz di!“ oder „Rotz ned umadum!“ Aber die alte Dorn sagte: „Schnaub dir die Nas!“ Und so erfuhr ich zum ersten Mal in meinem Leben, dass meine Muttersprache viele Tönungen kennt. Ich war damals, im Herbst 1944, vier Jahre alt und gerade von Himberg nach Wien gezogen, heute bin ich 77 und lebe seit 48 Jahren in Köln. Und was „deutsch“ – in Sprache, Denkungsart, Personalstil, Lokalkolorit – alles sein und bedeuten kann, habe ich in dieser Zeit verinnerlicht. Mit zunehmender Begeisterung, aber auch mit Abscheu, Belustigung, Lernfreude.
Die alte Dorn – so nannte meine Mutter sie – wohnte zwei Stockwerke über uns, in einer Mietskaserne im dritten Bezirk. Sie war aus dem „Reich“ – so hieß es damals in ganz Wien für Deutschland – zugezogen und stand der deutschen Tochter Helga Massak, dem amerikanischen Schwiegersohn Sigmund Kennedy und der österreichischen Enkelin Inge Massak als Familienoberhaupt vor. Sie neigte vernehmlich zum Kommandieren, doch wie sie die Mahnung, mir die „Nas’ zu schnauben“ gemeint hatte, konnte ich nicht unterscheiden: milder Rat, fürsorgliche Empfehlung, mürrischer Befehl? „De oide Piefkineserin schofft ollaweu au“, empfand meine Mutter, „huach ned auf sie“.
Aber ich horchte auf sie, immer wieder. So wundert es mich gar nicht so sehr, dass mir Person und Persönlichkeit der alten Dorn auch heute noch ganz klar in den Sinn kommen. Die Stimme war dunkel und etwas rau im Klang, ruhig im Sprechtempo, gelassen in der Emotion. Und ich sehe sie auch vor mir: mittelgroß, weißhaarig, etwas krumm in der Haltung, leicht stockend in der Bewegung. Insgesamt kam sie mir eher wie eine Respektsperson als ein Drachen vor – ein Monument des weisungsbefugten Erwachsenseins.
Es gab noch ein anderes visuelles Erlebnis aus meiner frühesten Kindheit und Deutschland-Erfahrung. Mein Vater kam schwer verletzt aus dem Zweiten Weltkrieg zurück und musste in Sachsen ins Lazarett. Erst in Nossen, dann in Bad Lausick. Oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr, jedenfalls hatten meine Mutter und ich Besuchserlaubnis. In einem der beiden Städtchen wurden wir in einem Wirtshaus einquartiert, an das ich mich genau erinnere. In der Gaststube aus dunklem Holz saß an einem Ecktisch am Fenster ein Junge, offenbar der Wirtssohn, und hantierte mit Wasserfarben. Als mich meine Mutter auf dem Arm eine Wendeltreppe hinauftrug, schaute uns der Bub genauso neugierig nach, wie ich, mit verdrehtem Hals, seinen Blick erwiderte.
4 Jahre alt beim ersten Deutsch-Unterricht:
Gerhard Bauer als er vergaß, sich die “Nas‘ zu schnauben“
Ich muss damals in einem Alter gewesen sein, in dem man noch keine bewahrende Empfindung haben kann, demzufolge auch keine Erinnerung. Und dennoch. Dennoch erscheint mir der sächsische Bub immer wieder und ohne jeden Anlass vor dem geistigen Auge, und zwar ohne die mindeste Abweichung im Detail: ein schmales, blasses Gesicht, hellblondes Haar mit Rechtsscheitel, blaues kurzärmeliges Hemd, gemusterter Pullover mit Halbarmel. Viel später, ich wohnte da schon seit längerer Zeit in Deutschland, forschte ich in den Amtsstuben von Nossen und Bad Lausick nach den Verhältnissen und Umständen von einst. Ich hoffte auf irgendwelche Überbleibsel von Spitalsakten mit Patientenlisten und Zeitangaben, von denen aus ich mich in die sozusagen gesunde Welt von heute vortasten hätte können. Wäre es nicht möglich gewesen, dass mir ein Veteran bedeutet hätte: „Sie können nur den gemeint haben, das muss der Tannen-Wirt gewesen sein, seine Kinder leben noch.“ Nichts dergleichen geschah, möglicherweise beargwöhnten mich die DDR-Amtsinhaber als einen suspekten, zumindest verschrobenen Westler. E-Mails und Briefe in beide Städte blieben unbeantwortet, und irgendwann verlor ich die Lust. Doch zurück zur alten Dorn.
Ich war nicht das einzige Kind im Haus, dem der ungewohnte Tonfall der alten Dorn auffiel, aber das einzige, das durch ihn irritiert war. Denn die Sylvia, genannt Silvi, war von ihren Eltern ausersehen, Burgschauspielerin zu werden, was sie übrigens tatsächlich wurde. Es war die wunderschöne und später hochdekorierte Sylvia Lukan. Sie übte immer schon eine, wie wir es insgeheim, aber auch liebevoll nannten, „geschwollene“ Ausdrucksweise – im Gegensatz zu ihrer jüngeren Schwester Regine, genannt Gini, einer eher volksnahen Maid, die mich aber immer irgendwie von oben herab behandelte. Als ich mit Silvi an die sechzig Jahre später einmal telefonierte, fragte ich sie: „Was hat denn die Gini eigentlich gegen mich gehabt, dass sie mich immer anschaute, als wäre ich ein seltenes Reptil, ein Basilisk gar?“ Aber Silvi meinte dazu nur: „Das bildest du dir nur ein. Sie war halt die Kleinste von uns im Haus und daher vielleicht ein bisschen scheu.“ Silvi, die ich nicht müde wurde als „meine älteste Freundin“ zu bezeichnen, ist die einzige Spielgefährtin, deren Leben ich halbwegs regelmäßig verfolgen kann. Ich sah sie bei gelegentlichen Wien-Reisen in Burg- und Akademietheater, erinnere mich aber keiner einzelnen Rolle; Stücke von Hofmannsthal und Nestroy werden sicherlich dabei gewesen sein. Auch ihre Film- und Fernseharbeit – ihr Ehemann war der ungemein produktive Regisseur Dieter Haugk – kommt mir nur ganz schemenhaft vor Augen. Die anderen Kinder im Haus waren von vergleichsweise unauffälligem Kaliber. Nebst dem Bauer-Gerhard gab es noch einen zweiten Gerhard, den Kronowetter-Gerhard. Sein Vater unterhielt eine große Firmenwäscherei und war von seiner Kundschaft her gehalten, vorsichtshalber hochdeutsch zu sprechen. Das färbte im Kundenverkehr auf den Sohn ab, auf uns Kinder wirkte er sonst aber durchaus „normal“. Dann kroch da noch ein meist unsichtbarer Michael herum, ein steifer Stiller, der in der Obhut sehr gemessener Großeltern, der Häkels, aufwuchs und deren Diktion automatisch übernommen hatte. Dann bemerkte man manchmal auch den Sohn vom alten Bergler, einem Hysteriker reinsten Wassers. Ob er keinen Namen hatte oder ob ich ihn vergessen habe, weiß ich nicht. Das Haus jedenfalls sprach von ihm nur als dem „Buam vom alten Bergler“. Er war durch den ewig keifenden und brüllenden Vater schweigsam geworden und kommunizierte nur mit Gesten, seufzte und brummte allenfalls. Mehrere Kinder hatten wir im Haus auch zu Gast. Denn ich wohnte in dem nach der Musiker- und Klavierbauer-Dynastie Streicher benannten Streicherhof, einem Altbau, in dessen Sälen einst Johannes Brahms konzertiert hat. Irgendwann hat sich der Konzertbetrieb aber erledigt, und die Räume wurden in eine Andachtsstätte für die Neuapostolische Kirche ungewandelt. Zweimal in der Woche kamen die „Ketzer“, wie sie schnell und unrichtig genannt wurden, zum Gottesdienst, darunter eine Schar von Kindern. Diese erschienen uns „merkwürdig“, vermutlich allein des Begriffes wegen, und es war schwer, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Erstens, weil sie beim Kommen wie beim Gehen immer in Eile waren, zweitens, weil sie uns unverständliche Wörter verwendeten. Bleibt jetzt nur noch der – früh gestorbenen – Inge zu gedenken, der Enkelin der alten Dorn. Ich habe sie später einmal aus der Entfernung gesehen und nicht wenig gestaunt, wie sich das dürre Mädchen von einer Hopfenstange in eine Femme fatale à la Jane Russell verwandelt hatte. Inge verwendete eine Mischform der Dialekte, schien mir in der Wahl ihrer Mittel aber stets darauf bedacht, wer gerade in der Nähe war.
Viel, viel später, als mein Denk- und Urteilsvermögen schon halbwegs gereift war, ist mir die Idee gekommen, dass die Menschen schon in der frühen Kindheit die Notwendigkeit lernen oder spüren, sich ihrer Umwelt anzupassen. Wittern sie dadurch einen Vorteil, sind sie ängstlich oder neugierig, oder wollen sie, kinderschlau und intuitiv, einfach nur lieb zu den Erwachsenen sein? Dies alles und noch vieles mehr kommt aber nicht nur im Kindesalter vor, das weiß ich heute zur Genüge. Was ich freilich noch immer nicht weiß, ist, wer die hierarchische Nummer eins im deutsch-österreichischen Geplänkel ist. Vielleicht kann ich zur Erforschung nur die Methode der kleinen Schritte probieren. Zunächst aber wage ich den großen Sprung, und zwar in den Herbst 1969, als ich, der aufmerksame Leser wird es wissen, gerade 29 Jahre alt geworden war.
In meinem Haus in der Ungargasse im dritten Wiener Gemeindebezirk herrschte einige Aufregung. „De Bauer wird narrisch“, erzählte die Hausmeisterin, die alte Fuchs. „Wos hod’s denn?“, fragte ihre Ziehtochter Hella. „Nau, ihr Bua, da aupritschte Gerhard, der wü noch Taitschlaund geh“, kam die Replik. „Auf den woatn’s jo scho, den Dodl“, ging es weiter. Kurz und gut: Ich hatte das Angebot einer großen deutschen Zeitung bekommen, so schnell wie möglich zu übersiedeln, um die Position des Musikredakteurs anzutreten. Ich sei von dem angesehenen Kollegen Horst Kögler empfohlen worden, und man erhoffe sich eine für beide Seiten ersprießliche Zusammenarbeit. Also: Nix wie hin nach Köln, zu, wie mir bedeutet wurde, einer der führenden Tageszeitungen des Rheinlands, zum „Kölner Stadt-Anzeiger“? Gemach, gemach – und ein Sprung wieder zurück.
Die Musik war die erste Liebe
Ich war mit dem Wunsch groß geworden, irgendetwas zum Beruf zu machen, in dem Musik vorkommt. Mein Vater unterrichtete Violine, hatte auch Fähigkeiten im Streichinstrumenten-Bau. Er führte ein offenes Haus, es kamen viele Musiker aus den Wiener Orchestern, es kamen Verleger, Komponisten, Geigenhändler, Sänger, Konzertagenten, Zigeuner – und sie alle spielten, sangen, soffen, tratschten, tanzten, machten Geschäfte. Ungefähr von meinem 16. Lebensjahr an war ich in dieser bunten Partie mitten drin und schnappte mit der Zeit dabei alles Mögliche auf. Ich hieb ins Klavier, wenn es um die klassischen Sonaten ging, schnitt für meinen Vater Stege und Stimmstöcke zu, lernte bei Professor Wrubel en passant ein bisschen singen, pfuschte auf der Oboe (Lehrer am Konservatorium Johannesgasse: Spurny von den Wiener Symphonikern), sang im Chor (Wiener Bach-Gemeinde, Leitung Professor Julius Peter).
Ich gab sogar kleinen, meist untalentierten Buben elementaren Unterricht im Klavierspiel, besonders gern hatte ich den dicken, faulen Joschi, dessen Vater ein florierendes Wirtshaus betrieb. Ich bekam nämlich für die Lektion das damals, Ende der Fünfzigerjahre, für einen Gymnasiasten sagenhafte Honorar von 25 Schilling, dazu ein Viertel Wein und ein, zwei Wurstsemmeln. (Zum Vergleich: Eine Stunde Arbeit im Weinberg brachte nur 10 Schilling.) Manchmal schaute der Wirt ins Zimmer und fragte: „Spüda eh schäi, da Joschi?“ Ich bejahte, ohne rot zu werden, denn die völlig unmusikalische Natur des Bengels spottete jeder Beschreibung. Als ich später den Film „Die Schönen der Nacht“ sah, in dem Gerard Philipe als Pädagoge wider Willen ein ähnliches Schicksal erleidet, erinnerte ich mich an den Joschi und bedauerte, reichlich verspätet, nicht – wie Gerard Philipe im Film – die Ausflucht des Einschlafens gefunden zu haben.
Schönes Geld verdiente ich auch als Handlanger von Musikern. Es besuchte uns die Zigeunerfamilie Schneeberger, ein fünf Generationen umfassender Clan, der auf Leiterwägen ganz Österreich durchzog und sammelte, kaufte, tauschte oder einfach mitnahm, was immer ihm besitzenswert erschien. Alle waren Musiker von Natur und Neigung, formierten sich auf Straßen, Plätzen, Höfen spontan zu Gruppen und ließen den Hut rumgehen. Ich lernte da eine Menge über Improvisation, ungewöhnliche Griff- und Bogentechnik der Geiger, klangliche Farbmischungen, exotische Tonarten, schräge Stimmungen und – vor allem – über die schier wahnsinnige Freude am Loslegen, am Drauflosspielen bis zur Bewusstlosigkeit.
Weil ich den Schneebergers bei ihren Darbietungen eine Art Clown, Mundschenk und Marktschreier abgab, bezog ich ein schönes Trinkgeld, nicht selten in Form von goldenen Ohrgehängen, Uhrketten, Broschen und Fingerringen. Meine Eltern wussten meine „Tüchtigkeit“ zu würdigen und zu nützen, der Vater konnte es aber dennoch nie lassen zu sticheln: „Ist das Gold auch echt, Ernö, schiacha oida Zigaina?“ Und der wieherte los: „Ferry, is echt, wie Gold kann sein echt!“ Man konnte damals so miteinander umgehen, denn den Zigeunern kam es auf eine – damals ohnehin stark vernachlässigte, wenn nicht sogar völlig unbekannte – politische Korrektheit den Sinti und Roma gegenüber nicht an. Vielleicht sah die Wiener Unter- und Mittelschicht in den Zigeunern auch eine Chance auf nützliche Zweckbündnisse und behandelte sie deshalb wie ihresgleichen. Diese Idee kam mir aber erst viel später, in den letzten Kriegs- und ersten Nachkriegsjahren gab es nur Verbrüderungen und Umarmungen. Keiner schalt auf die als „Hühnerdiebe“ beargwöhnten Zigeuner, denn jeder spekulierte, von einem Imre oder einer Zsuzsa ein Bein vom Huhn zu bekommen. „Mit solchen Leuten legt man sich doch nicht an!“, mag die eigennützige Motivation manches Wiener Zeitgenossen gewesen sein.
Vielleicht bin ich zu pessimistisch in der Beurteilung der menschlichen Natur, doch als mich eine erotische Marotte später, aber noch zu DDR-Zeiten, zu einer Lady in Thüringen verschlug, war ich schier himmelhoch begeistert von der Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen dort untereinander. Und dass es eine allgemeine und ziemlich spöttische Heiterkeit dem Regime gegenüber gab, erstaunte mich, denn es hatte sich bei den Westdeutschen ja vielerorts die Meinung festgesetzt, die Allgegenwart von Spitzeln habe ein Duckmäuser- und Denunziantentum bei der Bevölkerung erzeugt, zumindest aber eine besondere Vorsicht im Umgang untereinander. Man lachte über diese Einschätzung der Verhältnisse und klärte mich dahingehend auf, dass es Spitzel zwar gebe, unter diesen aber viele „falsche“, vorsätzlich vorgeschobene, wissentlich zur „Entdeckung“ abgestellte. Das Volk solle sich in Sicherheit wiegen, hinter die „echten“ komme es sein Lebtag nicht. Als ich weiterbohrte, versickerten die Erläuterungen aber ins Vage, die für den Augenblick lustigste war vielleicht: „Wer von der SED vermutet denn unter den Zwergen am Rennsteig schon Revolutionäre?“
Eine Episode, die diese Einschätzung möglicherweise unterstützt, wurde mir über zwei Wiener Kollegen erzählt. Das waren die Kulturjournalisten Heinz Sichrovsky (Theaterkritiker) und Paul Flieder (Musikkritiker, später Regielehrling bei Harry Kupfer an der Komischen Oper Berlin, Redakteur bei „Die deutsche Bühne“, eine Zeit lang Operndirektor in Tirana). Die beiden Burschen speisten in einem Selbstbedienungsrestaurant am Rennsteig, in erster Linie, weil sie neugierig waren, was denn unter dem in ganz Österreich verlachten Begriff „Goldbroiler“ zu verstehen sei. Als der – von Natur eher lautstarke – Sichrovsky nach vergeblichen Versuchen, das Hähnchen zu zerkleinern, zornig wurde, brüllte er durch das mit Einheimischen gut gefüllte Lokal: „Was ist denn das? Wenn bei uns in Wien jemand hundert Jahre alt wird, kommt der Bürgermeister, hält eine Rede und verleiht ihm ein Diplom. Aber hier wird der arme Alte in die Pfanne geworfen!“ Da konnte ihm – der von Natur aus eher ängstliche – Flieder zureden wie einem kranken Pferd, Sichrovsky ließ sich einfach nicht besänftigen. Und die Thüringer lachten im Chor, hieben sich auf die Schenkel und spendeten Beifall. Bis auf einen, der sich aus dem Saal stahl, von hämischen Rufen begleitet wie „Geh nur und melde“ oder „Jetzt hat er wieder was zu erzählen“. Sichrovsky und Flieder fanden sich dann in angenehmer Runde wieder, wo locker und unverblümt über alles, nur nicht über Politik hin und her erzählt wurde. Flieder machte später sogar eine DDR-Teilkarriere, als er an der Oper in Erfurt „Spielleiter“ (nicht etwa „Regisseur“) der Oper wurde, es dort aber nicht lange aushielt. Denn schon kurze Zeit nach der Wende zeichnete es sich ab, dass es nur die Not gewesen war, die die DDR-Bürger zusammengehalten hatte, und dass die deutsche Einheit ein auffällig und ungeniert umgesetztes Nachholbedürfnis an Neid, Rücksichtslosigkeit, Gier, Egoismus und anderen Verstößen gegen die Nächstenliebe provozierte. Ob die Liebe der Wiener zu den Zigeunern damals auch vom Opportunismus diktiert worden war? In meinen Bubenjahren war mir dieser Gedanke natürlich völlig fremd. Ich hockte auf dem Pferdewagen der Zigeuner, lernte Wien und Umgebung kennen – und tausend freundliche Leute. „Da schau her, da sans wieder, de Schneeberger“, riefen die Gassenbuben, Handwerker, Huren („de Huarna“), Geschäftsleute und Bettler („de Fechta“) einander zu. Welch herrliche Zeiten.
Herrliche Zeiten mitten im Krieg
Herrliche Zeiten also: Doch nicht nur bei den vazierenden Gesellen, sondern auch bei den Besatzungsmächten. Zuerst hatten wir die Russen im Haus. Während sich die Familie im Keller in die Waschküche pferchte, hockte der Herr Major mit seinen Gesellen in der Parterrewohnung und pries den Herrn zu Wodka und was weiß ich sonst noch was. Wir waren aber bei „Besuchen daheim“ immer gern gelitten, weil mein Vater auf der Geige die russischen Volkslieder draufhatte und vor allem mit den Wieniawski-Variationen zum „Roten Sarafan“ (geläufig als „Souvenir du Moscou“) das Heimweh der Russen zugleich weckte und beschwichtigte. Das verhalf der Familie zu Lebensmitteln, Wein und Tabak – und mir zu totaler Narrenfreiheit. So konnte ich den Major ungestraft fragen, ob es denn stimme, was über sein Volk überall gesagt wurde. Dass nämlich die Russen nur deshalb Knickerbocker trügen, weil sie in sie bequem hineinmachen konnten und zur Leerung dann nur die unteren Bünde ihrer Dreiviertelhose lockern mussten. Das fragte ich wirklich und bekam – nicht die Kugel, sondern, nachdem sich der Major von seinem gurgelnden Lachen erholt hatte, einen schmatzenden Kuss und ein paar Billionen Inflationsgeld.
Bald nach den Russen hatten die Engländer im dritten Wiener Gemeindebezirk die Oberhoheit – und mit ihnen kam eine dramatische Wendung. Denn John Douglas Pettitt aus London, Eltham SE9, Brenley Gardens 7, hatte auf meine Schwester Elfriede, genannt Fritzi, ein Auge geworfen. Die war damals 19 Jahre alt, konnte perfekt Englisch, sah – in meinen Augen – ganz ordentlich aus und benahm sich auch so. John, der bald bei uns ein und aus ging, gefiel sie nicht zuletzt, weil sie für mich, den Achtjährigen, eine wahnsinnig fürsorglich anmutende „zweite Mutter“ abgab. Allerdings zu ihrem Leidwesen, sie hätte viel lieber ihrem Zärtlichkeitsbedürfnis gehuldigt. Das verbarg sie aber schlau, als sie schnallte, dass John in ihr – possibly – die mütterlich begabte Frau für einen eigenen Nachwuchs sah. Wie auch immer. Es dauerte nicht lange, bis John in althergebrachter Form um Fritzis Hand anhielt und nach dem unverzüglich gewährten Zuschlag sofort begann, leuchtende Zukunftsbilder von einem Leben am Stadtrand von London zu entwerfen. Das Hindernis Mischehe, er war anglikanisch, sie römisch-katholisch, wurde von Johns Militärpfarrer Father Gibson elegant aus dem Weg geräumt, indem er Fritzi verpflichtete Johns Religion zu respektieren. Was freudig gelobt wurde, und weil von der katholischen Kirche niemand auf die Idee kam, John einen entsprechenden Schwur abzuverlangen, gab es in der Erdberger Kirche St. Othmar und nachher beim Färber-Wirt in der Ungargasse eine personen- und gefühlsreiche Hochzeit in Weiß, verbrämt und nobilitiert durch die Anwesenheit von britischem Militär und österreichischem Klerus. Ein Jahr später, am 22. November 1949, kam Denise auf die Welt – und John sah, dass alles, alles gut war – und auch gut bleiben sollte. Allerdings nur zu Johns Lebzeiten, denn Denise hatte, gerade eine Endzwanzigerin, einen kräftigen Umschwung in ihrer Weltanschauung unternommen. Bei der Barclay Bank in London in guter und ausbaufähiger Position tätig, entwickelte sie einen Hass auf ihre Kundschaft und deren hochfahrende, snobistische Haltung. Sie kündigte, begann eine Lehre als Chauffeurin für die berühmten zweistöckigen Autobusse – und hatte damit offenbar ihre wahre Bestimmung gefunden. Wenn ich mit ihr Kontakt hatte, sei es in Wien, London und später auch in Köln, erzählte sie von ihrer – mittlerweile berufslebenslänglichen – happiness als bus driver in London.
Doch mir scheint, ich muss nach dieser Abschweifung wieder zur Chronologie meiner Erinnerung an die Kinderjahre im Luftschutzkeller und die Flegeljahre der Nachkriegszeit zurückkehren – also zum zirzensischen Leben und zum Erwachsenwerden in Wien. Es gab damals ja nicht nur unkontrolliertes Raffen und Sammeln, sondern auch viele ernsthafte Zugänge zur Musik. Ich wurde protegiert für Arbeiten in der Universal Edition, ging einem Konzertagenten (Dr. Michel Fink, der Leute wie Friedrich Wührer, Antonio Janigro, Jörg Demus oder Paul Badura-Skoda vertrat) zur Hand, schrieb für Peter Weisers Wiener Konzerthausgesellschaft Programmeinführungen, bearbeitete für Orchestermusiker und Chorsänger die Noten. So tat sich zum Beispiel ein Violoncellist mit Noten über dem System schwer und erbat sich eine entsprechende Änderung der Notation. Und viele ausschließlich an Bass- und Violinschlüssel gewohnte Sänger fluchten über die gelegentlich vorkommenden C-Schlüssel. Eine Sopranistin empfand es als Zumutung und Psychoterror, ein hohes C vor Augen zu haben, und konnte auch durch die Erklärung der klanglichen Wahrheit (nämlich: eine Terz tiefer) nicht beruhigt werden. „Allein der Anblick eines hohen C macht mir den Hals eng“, jammerte sie, „auch wenn es nur ein A ist.“ So schrieb ich halt um, und diese Transkriptionen sollten noch wertvoll für mich werden.
Ich hatte nämlich an der Wiener Universität begonnen, Musikwissenschaft zu studieren, und fraß in mich hinein, was mir an Neuem geboten und abverlangt wurde. Erich Schenk war der im Historischen beheimatete Ordinarius, ein international angesehener, wenngleich nicht irrtumsfreier Barock- und Mozart-Spezialist. Leopold Nowak genoss Ruhm als Haydn- und Bruckner-Forscher, Othmar Wessely lehrte Paläografie, Hugo Zelzer und ein gewisser Schleiffelder vertraten die theoretischen Fächer (Harmonielehre, Kontrapunkt, Formenlehre, Instrumentenkunde), Franz Grasberger führte in die Arbeitstechnik ein, Walter Graf in die vergleichende Musikwissenschaft (Akustik und außereuropäische Musik), Franz Zagiba ins Osteuropäische.
Das war eine interessante, auch amüsante Gesellschaft zwischen Heiligkeit, Verschrobenheit, Imperialismus und Wurschtigkeit, immer gut für die Studenten, um Gerüchte, Anekdoten, Unterstellungen kursieren zu lassen. Nowak etwa ließ nicht das Mindeste ohne die Hilfe Gottes geschehen, Schleiffelder wohnte in einem Stundenhotel und galt dort als sein bester Kunde. Aber eben nur in der Studentenmeinung, denn tatsächlich gehörte ihm das Hotel, und er, ein Angehöriger einer berühmten Wiener Brillenmacherdynastie, bewohnte es trotz seines vermuteten Reichtums schlicht aus Kostengründen. Schenk hatte eine Wohnung, in der früher die übereinstimmend als die „weltbeste“ Sängerin der Salome gefeierte Operndiva Ljuba Welitsch gewohnt hatte, und war lange Zeit Telefonaten ausgesetzt, die verlangten: „Ljubachen, lass dich lieben.“ Graf hatte für die mündlichen Prüfungen einen Zettelkasten bereit, aus dem die Studenten Kärtchen ziehen konnten und solcherart „Herren ihres Schicksals“ (Graf) waren. Wer dann gebeten wurde, acht ghanesische Flöten zu nennen und in Klangcharakter, Tonumfang und musikalischer und ritueller Bestimmung zu beschreiben, der war – im gar nicht so seltenen Fall – an seinem „Schicksal“ selbst schuld. Leider konnten diese Wissensfallen nicht weitergegeben werden, denn Graf veränderte seine Formulierungen und Inhalte ständig – ein Modus, dem in ähnlicher Art auch Schenk huldigte, indem er seinen Vorlesungen Details einfügte, die naturgemäß in keiner früheren – und für gutes Geld verscherbelten – hektografierten Mitschrift vorhanden sein konnten. Da rasselte manchmal fast das ganze Semester durch.
Doch in toto war Erich Schenk ein guter Kerl und für mich die Zentralsonne. Dieser so wilde wie würdige Professor fiel durch seine bei jeder Gelegenheit zornig losgelassenen Flüche gegen eine neue Studienordnung auf, besonders verabscheuungswürdig empfand er die Einführung des akademischen Grades „Magister“. „Wissen die hohen Herrn im Wissenschaftsministerium nicht, dass magister Meister heißt? Und da darf sich einer, der nach vier Semestern die Brocken hinschmeißt, ‚Meister‘ nennen und ist in Wirklichkeit nichts als eine gescheiterte Existenz.“ Mir prognostizierte Schenk ob einer halb fertigen Dissertation (über den Brahms-Freund, Dirigenten und eigentlichen Gründer der Wiener Philharmonischen Konzerte Felix Otto Dessoff) eine musikwissenschaftliche Zukunft, aber ich konnte mich zur Fertigstellung trotz wiederholter Ermunterung – später auch durch andere Ordinarii als Schenk – nie wieder aufraffen. Dabei wäre der akademische Grad relativ billig zu haben gewesen. Ich bekam Offerten wie: „Zwei Semester Hauptseminar und Hauptvorlesung – und zum Rigorosum setzen wir uns dann zum Kaffee zusammen.“ Das wollte ich aber nicht, und so liegt das Dissertationsfragment heute noch irgendwo bei mir herum. Und im Archiv des Musikwissenschaftlichen Instituts der Wiener Universität frisst es ebenfalls Staub, wie mir Birgit Lodes, die heutige Institutsvorständin (mittlerweile ist dieses schier unglaubliche Wort auf Institutsvorstand geändert worden) erzählte. Sie betonte auch, dass das Opus „mir und nur mir gehöre“ und keinesfalls als Steinbruch für weiterführende Arbeiten herhalten dürfe. Ich muss bekennen, dass es mich schon immer wieder juckt, den Dessoff fertigzustellen, auch dass mich der Abschied aus der Wissenschaft manchmal schmerzt. Aber das Thema hängt total in der Luft, da es ja vor allem als Zuträgerstudie für ein Sammelwerk von Schenk über die Wiener Hofoper vergeben worden war. Und so gehöre ich halt auch zu jenen gescheiterten Existenzen, die Schenk so sehr verachtete. Die „Magister“-Prüfung habe ich aber nie abgelegt, solcherart das universitäre Schindluder wenigstens ein bisschen gemieden. Immerhin.
Von der Universität zum Militär