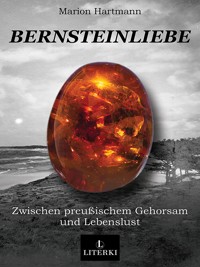9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Marion Hartmann begibt sich zuversichtlich ins Krankenhaus, um sich einer notwendigen Hüft-Operation zu unterziehen, eigentlich ein Routine-Eingriff. Sie hat sich nach einer schweren Sepsis und einer Woche im künstlichen Koma ins Leben zurückgekämpft. Sie verbrachte zwei Monate im Krankenhaus, einige Tage im Pflegeheim. Mit Hilfe ihrer Familie und ihres Freundeskreises, einem unbändigen Lebenswillen und eiserner Disziplin verbringt sie drei Monate im Rollstuhl in ihrer Wohnung ohne zu verzweifeln, um dann nach fünf Monaten die künstliche Hüfte eingesetzt zu bekommen. Auch mit einer Prise Humor beschreibt sie diese Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Marion Hartmann hat sich nach einer schweren Sepsis und einer Woche im künstlichen Koma ins Leben zurückgekämpft. Sie verbrachte zwei Monate im Krankenhaus, einige Tage im Pflegeheim. Mit der Hilfe ihres Freundeskreises, einem unbändigen Lebenswillen und eiserner Disziplin verbringt sie drei Monate im Rollstuhl in ihrer Wohnung ohne zu verzweifeln, um dann nach fünf Monaten die künstliche Hüfte eingesetzt zu bekommen. Auch mit einer Prise Humor beschreibt sie diese Zeit.
* * *
1966 in Paderborn geboren, wuchs sie auf dem Land auf. Nach dem Abitur studierte sie ihrer kreativen Neigung entsprechend Design und arbeitete danach als Innenarchitektin, Farbgestalterin und Spielplatzplanerin. 2005 bis 2010 absolvierte sie das Lehramtsstudium und ist seit 2010 als Grundschullehrerin in Berlin tätig. Als Ausgleich zur Berufstätigkeit entspannt sie bei der Gartenarbeit, fotografiert oder entdeckt die Hauptstadt per Rad.
Marion Hartmann
Hüft-OP … Sepsis … Koma:
Zurück ins Leben
nach dem Krankenhauskeim
© 2024 neu bearbeitete Auflage Marion Hartmann
Coverdesign von: Marion HartmannSatz & Layout von: Marion Hartmann
ISBN 978-3-384-13884-2 (Softcover)
ISBN 978-3-384-13885-9 (Hardcover)
ISBN 978-3-384-13886-6 (E-Book)
ISBN 978-3-384-13887-3 (Großdruck)
* * *
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5,
22926 Ahrensburg, Deutschland
* * *
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Hüftoperation 2015
Sepsis und künstliches Koma
Zurück ins Leben
Auf der Normalstation
Pflegezustände
Wohin mit mir? Umzug ins Pflegeheim
Zurück in die Klinik!
Endlich nach Hause!
Klinikgeschichten aus Hamburg
Kurgeschichten – Reha in Damp 2000
Kurende, zurück nach Berlin!
Zwischenbilanz – Jahresabschluss
Operationen 2015
Hüftoperationen als Kind 1967–1972
Erstluxation nach einem Jahr
Wie es dazu kam
Blick rückwärts – Besuch in der Intensivstation
Gemeinschaftsschule in Neukölln 2011–2014
Erste Festanstellung an einer Berliner Grundschule 2010/2011
Lehramtsstudium mit 39 Jahren 2005–2010
Berufstätigkeit als Designerin 1994–2001
Und die Moral von der Geschicht’ – ein Erklärungsversuch
Hüftoperation 2015
Ein Jahr lang, 2014, hatte ich mit Krankengymnastik und Sport versucht, meine Schmerzen in der Hüfte loszuwerden. Auch der Schulwechsel in Berlin von Neukölln nach Charlottenburg brachte nicht die Erleichterung, um eine Operation zu umgehen. Anhand der Röntgenaufnahme konnte man deutlich sehen, dass es keine Knorpelmasse mehr zwischen Hüftkopf und Gelenkpfanne gab und bei jeder Bewegung Knochen auf Knochen rieb. Mit der Zeit hatten sich dazu noch kleinste Knorpelteile entzündet und bereiteten mir Schmerzen. Ich hatte keine Wahl ob, sondern nur wann ich die Operation durchführen lassen würde. Die letzten Monate vor der OP nahm ich bereits Schmerzmittel, um wenigstens meine Arbeit als Grundschullehrerin weiter verrichten zu können. Zur Entlastung fuhr ich viel mit dem Fahrrad, statt zu laufen, und nutzte Wanderstöcke, wenn ich zu Fuß unterwegs war. Gleich, welcher Hilfsmittel ich mich auch bediente, mein Zustand und die Schmerzen wurden schlimmer, sodass ich mich nach zwei Monaten Bedenkzeit und einem frühen Gespräch mit der Schulleiterin zur Operation entschloss. Mitte Dezember 2014 hatte ich den Voruntersuchungstermin in einer Fachklinik. Mir wurde zunächst ein fester Termin für Ende Februar 2015 angeboten und ich wurde auf die Warteliste gesetzt, falls ein/e andere/r Patient/in, aus welchen Gründen auch immer, absagte. Ich hatte Glück im Unglück, als tatsächlich jemand ausfiel und ich schon Ende Januar einen OP-Termin bekam. Das war insofern günstig, da ich wenigstens für die Halbjahreszeugnisse die Noten für die Kolleg/innen zuarbeiten konnte. Ich arbeitete bis zum 23. Januar, ein Freitag, und packte samstags meinen Koffer für den Krankenhausaufenthalt und die direkt anschließende Reha. Den Koffer für die Reha ließ ich noch in der Wohnung stehen. Zwei Freundinnen aus meinem Haus hatten sich angeboten, mir den Koffer am Ende meines Krankenhausaufenthaltes zu bringen, sodass er mit dem Krankenhaustransport mit in die Rehaklinik ginge. Soweit die Theorie. Ausnahmsweise wurde ich sonntags aufgenommen, da mein OP-Termin auf einen Montag fiel. Ich fuhr mit Trolley, Rucksack und Handtasche ausgestattet an diesem Sonntagmorgen mit der Bahn in eine Klinik außerhalb Berlins. Ich bekam ein Bett zugewiesen, Blut wurde abgenommen und die üblichen Vorbereitungen für die Operation wurden getroffen. Ich richtete mich im Krankenzimmer ein, räumte meine Kleidung in den Schrank und musste vor allem vom Arbeits- in den Krankenmodus umschalten. Das brauchte einige Zeit, da ich ja bis kurz vorher noch gearbeitet hatte. Am Montag durfte ich dann nichts mehr essen und trinken, wie üblich vor jeder Operation. Mittags kam ich an die Reihe, ich war kaum aufgeregt und hatte keine Angst. Ich hatte mich für eine Spinalkanalnarkose entschieden, bei der die Narkose nah an die zu operierende Stelle ins Rückenmark gespritzt wird. Bei dieser Form der Narkose kann das Mittel besser dosiert werden. Und ich bekam begleitend Schlafmittel, die bei mir sehr schnell anschlugen. Die Operation dauerte ungefähr vier Stunden. Ich wurde danach in eine Aufwachstation in der Intensivstation verlegt und blieb dort zur Beobachtung über Nacht. Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück zurück in mein Zimmer. Hier waren in der Zwischenzeit zwei weitere Patientinnen aufgenommen worden. Wir verstanden uns auf Anhieb sehr gut und hatten alle eine Hüftoperation hinter uns.
Dass manche Menschen laut sind und manche Menschen leise, kennt vermutlich jede/r schon. Oftmals sind die Lauten auch gerne mal Frischluftfanatiker, wie hier in unserem Fall. So trug es sich zu, dass wir drei, etwas gestresst vom Tag, in unseren Betten lagen, um, in freudiger Erwartung auf unseren Besuch vorbereitet und ausgeruht zu sein, ein Mittagsschläfchen zu halten. Morgens hatten wir mit der lauten Bettnachbarin gesprochen, dass es Sinn machte, mehrmals am Tag eine Stoßlüftung durchzuführen. Gesagt, getan, alle waren einverstanden. Sinn macht es auch, das Fenster beim Lüften nicht nur zu öffnen, sondern es danach auch wieder zu schließen. Wir lagen also in unseren Betten und träumten vor uns hin. Da stand besagte Dame laut auf und riss, ohne zu fragen, die Balkontür sperrangelweit auf. Ich schummelte mich in Hab-Acht-Stellung tiefer unter meine vorgewärmte Schlafdecke und dachte: ‚Wir hatten ja beschlossen, dass Stoßlüften gut sei, also bitte Fenster auf und wieder zu!‘ Sie legte sich wieder hin. Das war ein ganz schlechtes Zeichen. Kurze Zeit später fing sie an zu schnarchen. Supi! Meine Nase fing langsam an zu gefrieren. Da stand ich doch auf, weil ich mir keine Erkältung holen wollte, und schloss die Balkontür wieder. Trotzdem! Musste das denn sein? Schön wäre es doch, wenn man wenigstens aus seinen Fehlern lernt. Aber es gibt da auch resistente Menschen, Frischluftfanatiker halt, die sich nicht ändern.
Sepsis und künstliches Koma
Dieser Teil des Buches ist für mich schwer zu schreiben, weil es dabei ans sogenannte „Eingemachte“ geht. Es wird eine Gratwanderung zwischen Ironie und Ernsthaftigkeit, Leichtigkeit und Schwere der Gedanken und Erinnerungen. Eine flapsige Schreibweise zieht das Ganze schnell ins Lachhafte und das war es wahrhaftig nicht. Manchmal blicke ich in ernste und immer noch sorgenvolle Gesichter meiner engsten Freunde, meiner kleinen WhatsApp-Gemeinde. Dann bin ich unsicher, sprachlos, ohne Bilder, und ahne nur, was ich durchgemacht haben muss. Es ist gut, dass das Bewusstsein scheinbar immer wieder abschaltet, um die Wucht der Wahrnehmung abzumildern und die Erkenntnis in erträglichen Dosen, Stück für Stück zuzulassen. Für die engsten Freunde war es fast noch schlimmer als für mich selbst, denn sie konnten „nur“ tatenlos zusehen und beten oder was auch immer, dass ich durchkomme und die Sepsis und den lebensbedrohlichen, kritischen Zustand durch- bzw. überstehen würde. Unendliche Geduld gepaart mit extremer Hilflosigkeit müssen sie an meinem Bett im Einzelzimmer aufgebracht und empfunden haben. Die Anspannung, jederzeit, Tag wie Nacht, von Ärzten angerufen werden zu können und ad hoc ins Krankenhaus zu müssen, gehörte für sie eine Woche lang dazu. Trotzdem haben so viele zu mir gestanden. Allen voran meine beste Freundin Kathi aus der Nähe von Marburg. Sie bekam von mir die letzte Kurznachricht per WhatsApp an dem Samstagabend, 7.02.15, an dem wir eigentlich zu einem Konzert von Peter Maffay in die O2-World gehen wollten. Durch den vorgezogenen OP-Termin Ende Januar fiel das Konzert für uns aus. So war sie zum Fasching feiern gegangen, während ich bereits auf der Intensivstation einer Klinik außerhalb Berlins lag, an besagtem Samstag, den 7.02.15.
Die Hüftoperation Ende Januar verlief eigentlich sehr gut. Sie dauerte vier Stunden, was aufgrund meiner speziellen Vorgeschichte, Hüftfehlstellung (Dysplasie) von Geburt an, zu erwarten war. Eine Nacht war ich zur Beobachtung auf der Intensivstation, ein Standard in der Klinik. Alles war unauffällig. Am nächsten Tag kam ich zurück in mein Dreibettzimmer, die Schmerzen waren normal erträglich für eine solche Operation. Die Physiotherapeutin kam und ich stand erfolgreich das erste Mal auf meiner neuen linken Hüfte. Tag für Tag erweiterte ich meinen Laufradius. Erst waren es ein paar Schritte durch das Zimmer bis zur Toilette. Im Laufe des Tages übte ich die paar Schritte weiter, noch von Schwestern begleitet. Am nächsten Tag ging es auf den Flur, eine kleine Runde laufen. Dann lief ich den ganzen Flur entlang bis zum Ende und das zunächst zweimal, dann dreimal am Tag. Später kamen Gymnastikübungen an der Stange im Flur dazu. Alles Standard nach einer solchen OP. Ich bekam viel Besuch. Alle waren genauso überrascht wie ich, wie gut ich nach so kurzer Zeit mit Krücken schon wieder laufen konnte. Am vierten Tag nach der OP kamen die zwei Freundinnen, die mir netterweise den Koffer für die Reha mitbrachten. Den beiden sagte ich schon, dass sich das linke operierte Bein doppelt so dick anfühle wie das andere Bein. Die beiden konnten nichts Derartiges erkennen. Die darauffolgende Nacht hatte ich starke Schmerzen, von daher wenig geschlafen und sprach dieses bei der Visite am nächsten Morgen an. Der Arzt nahm meine geschilderten Beschwerden sehr ernst und verordnete mir ein starkes Schmerzmittel für die Nacht und den nächsten Tag. Es war vermutlich ein Opiat, was extra in den Akten vermerkt und einzeln ausgegeben werden musste. Die Nacht schlief ich sehr gut. Am nächsten Tag ging es mir besser und ich hatte Energie, fühlte mich wie ausgewechselt. Mir machte das Laufen Freude und es klappte sehr gut. Die nachfolgende Nacht war wieder schlechter. Auf meine Nachfrage am nächsten Tag meinte die Physiotherapeutin, es gäbe auch mal Rückschläge und könnte an der Tagesform liegen. Ich lag mehr im Bett als mich zu bewegen und nahm es so hin. Während der nächsten Nacht hatte ich wieder verstärkt Schmerzen und konnte kaum schlafen. Bei der Visite am nächsten Morgen sprach ich meine Beschwerden erneut an und der Arzt, ein anderer als zu Wochenbeginn, meinte nur lapidar, bei meiner Vorgeschichte sollte ich mich nicht wundern, da müsste ich drei bis sechs Monate mit Schmerzen rechnen. Meine Bestürzung war wohl kaum zu übersehen. Selbst die beiden Bettnachbarinnen zuckten etwas zusammen. Da musste ich wohl durch, dachte ich. Ich fragte am nächsten Tag die Schwester, ob sie noch mal Blut abnehmen würden, mir ginge es nicht gut. Sie meinte, nach ein paar Tagen nach einer solchen Standard-OP würden sie die Untersuchungen einstellen. Ah ja, dachte ich, wunderte mich etwas und nahm es so hin, denn es blieb mir schließlich nichts anderes übrig.
Es wurde leider nicht besser. Am letzten Tag vor der Entlassung hatte ich kaum noch Lust bzw. Energie, überhaupt aus dem Bett aufzustehen. Eine Zimmernachbarin war am Tag zuvor entlassen worden und die übrig gebliebene fragte, ob ich deswegen so antriebslos sei. Ich wusste es einfach nicht, ging nur lustlos einmal den Flur entlang und aß ohne großen Appetit meine Mahlzeiten. Ich schlief viel, gerade tagsüber, und hoffte, dass es mit der Entlassung und der direkt anschließenden Reha besser würde. Weit gefehlt! Die Nacht war wieder furchtbar schmerzhaft, aber ich hoffte weiter. Dann wurden am nächsten, meinem Entlassungstag, die Klammern entfernt, und es fand für mich unverständlich kein Entlassungs- oder Abschlussgespräch mehr statt. Ich wollte einfach nur noch weg, hatte elende Schmerzen beim Laufen, beim Einsteigen in den Sammelbus. Mir ging es miserabel, aber laut Klinik war ja dieser Zustand nach meiner OP und der Vorgeschichte normal. Das einzig Erfreuliche war, dass an diesem Tag wenigstens die Sonne schien. Auf der Fahrt mit zwei anderen Patienten holten wir noch eine Frau aus ihrer Wohnung ab und dann ging es zur Kurklinik. Mir war einfach nur hundeelend und schlapp zumute. Angekommen in der Rehaklinik mussten wir im Empfangsbereich warten und bekamen nacheinander unsere Zimmer zugewiesen. Die Koffer wurden von Mitarbeitern der Klinik auf einen Transportwagen geladen, denn es war weit zu laufen. Endlich in meinem Zimmer angekommen, legte ich mich erst mal auf mein Bett. Ich hatte keine Kraft mehr, irgendetwas auszupacken, ich war nur schlapp. Eine Schwester kam zur Begrüßung in mein Zimmer und war besorgt, als sie mich so antraf. Sie maß erst den Blutdruck und war entsetzt, wie niedrig er war. Dann folgte die Pulskontrolle, wobei der Puls relativ hoch war. Sie blieb besorgt und sagte, ich solle nicht mehr laufen, sie würden mich im Rollstuhl zum Essen und zur ärztlichen Aufnahmeuntersuchung bringen. Ich ahnte nicht, was in mir bereits brodelte, wie auch, wenn die Ärzte in der Klinik mich doch als geheilt entlassen hatten. Das Essen war o. k., aber ich fühlte mich einfach nicht wohl. Die meisten Kurpatienten um mich herum waren zum größten Teil deutlich älter. Ich empfand alles, für meine sonst so positive Grundeinstellung ungewöhnlich, einfach nur furchtbar. Aber ich gab die Hoffnung nicht auf, dass es besser werden würde, am nächsten Tag bestimmt. Nach dem Essen wurde ich wieder mit dem Rollstuhl in mein Zimmer gefahren. Ich legte mich sofort hin und schlief tief und fest, kein Gedanke an Laufen, Bewegen oder irgendwelche Anwendungen. Aber am nächsten Tag würde es losgehen, da war ich sicher. Nachmittags um fünf Uhr hatte ich die Aufnahmeuntersuchung bei einer Ärztin. Eine Schwester fuhr mich hin. Elend lange Gänge, die Vorstellung, diese jetzt wochenlang laufen zu müssen, war mir ein Gräuel, wieder ungewöhnlich in Anbetracht meines sonstigen Optimismus. Aber ich gab die Hoffnung für den nächsten Tag wie immer nicht auf. Die Ärztin schüttelte den Kopf und sagte nach den ersten Untersuchungen nur: „Sie sind ja so schwach, man hätte Sie gar nicht aus der Klinik entlassen dürfen.“ Ich sah sie nur ratlos an und meinte: „Ich weiß es nicht, habe nicht die Erfahrung. Nun bin ich hier und wir müssen das Beste daraus machen.“ Die Ärztin wurde während der andauernden, sehr gründlichen Voruntersuchung zunehmend besorgter, wie ich ihrem Gesichtsausdruck entnehmen konnte. Was sollte ich tun? Ich konnte mich nur vertrauensvoll in die Hände der Ärzte und Schwestern begeben, was anderes blieb mir nicht übrig. Um sieben Uhr, nach zweistündigem Termin, fuhren mich die Schwestern in mein Zimmer zurück und brachten mir das Essen ans Bett. Die Ärztin sagte: „Sie bleiben erst mal über Nacht. Wenn sich Ihr Zustand bis morgen nicht bessert, kann ich Sie nicht hierbehalten. Dann müssten Sie zur Beobachtung in die nächstliegende Klinik. Das wollen wir aber nicht hoffen.“ Mir war einfach nur alles zu viel. Ich schlief vor lauter Erschöpfung sofort ein, ob ich Schmerzen hatte oder nicht, ob ich Sorgen hatte oder nicht, ich konnte einfach nicht mehr. Mein abgrundtiefer Optimismus ließ mich, wie immer, weiter an den besseren, nächsten Tag glauben. Aber am nächsten Tag wurde es leider nicht besser. Ich war schwach, war nass geschwitzt von der Morgentoilette, konnte mich kaum auf den Beinen halten und war völlig antriebslos. Jede Bewegung, die ich brauchte, um im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf die Beine zu kommen, war unvorstellbar schwer. Die Schwester maß einen nahezu nicht vorhandenen Blutdruck und einen steigenden Ruhepuls. Sie war besorgt, schüttelte den Kopf und meinte nur, ich müsse unbedingt zur Ärztin, das ginge so nicht weiter. Die Ärztin kam und schüttelte ebenfalls den Kopf über meinen Zustand. Sie war immer noch entsetzt darüber, dass man mich aus der Klinik entlassen hatte. Sie konnte auch gar nichts mit mir besprechen, selbst dafür war ich zu schwach. Sie hatte zu meinem Glück entschieden, mich in die nächstliegende Klinik einweisen zu lassen. Selbst da regte sich nichts mehr in mir. Ich hatte nur das Gefühl, sie meinte es gut mit mir und tat das Richtige. Zumindest das Urvertrauen in die Ärzte hatte ich noch nicht verloren, trotz der Entlassung und fehlenden Untersuchungen in der Klinik. Eine Schwester half mir, meine Koffer wieder zu packen und dann ging es in die empfohlene Klinik. Ich kam auf eine Normalstation in ein Zweibettzimmer. Ein Arzt sagte mir, ich sollte zunächst eine Woche zur Beobachtung bleiben. Ich war zu schwach und dachte nur, na super, meine Genesung hatte ich mir schon etwas anders vorgestellt. Aber gut, wenn sie es sagten, würde es wohl das Beste für mich sein. Ich legte mich ins Bett und schlief. Wird schon wieder, war mein letzter Gedanke.
Gegen frühen Abend maßen sie noch mal den Blutdruck, mir wurde Blut abgenommen, der Puls gemessen etc. und die Werte waren wieder schlechter. Ich wurde zur Sicherheit auf die Intensivstation verlegt mit Verdacht auf Nierenbecken- und Lungenentzündung. Das wunderte mich etwas, da ich gar nicht erkältet gewesen war. Aber gut, wenn sie es meinten, würde es das Beste für mich sein. Zwei Ärzte und ein Pfleger waren dauerhaft um mich herum. Das kam mir schon etwas komisch vor, aber der Ernst der Lage war mir immer noch nicht bewusst. Das war wohl auch gut so. Ich war die Einzige auf dieser Intensivstation, beobachtete selbst die Apparate und sah, dass der Blutdruck auf 80:55 gefallen war, aber gleichzeitig der Ruhepuls bei 136 lag. Ich fühlte mein Herz pochen, war aber gleichzeitig schwach und konnte mich nicht bewegen. Abends, gegen 21.00 Uhr, traten zwei Ärzte, der Pfleger und eine Schwester an mein Bett. Sie waren alle sehr ernst. Der zuständige Arzt erklärte mir, dass mein Zustand sich derart verschlechtert habe, dass sie mich hier nicht weiter adäquat behandeln könnten und sie mich in eine größere Klinik verlegen müssten. Halb zum anderen Arzt, dem Pfleger und der Schwester gedreht, meinte er, er hätte zwar etwas Bedenken wegen des Transports, aber sie hätten keine andere Wahl. Ich wäre soweit stabilisiert und damit wenigstens transportfähig. Er würde aber auf jeden Fall zur Beobachtung und für eine sichere Übergabe den zuständigen Pfleger oder sogar einen Arzt mitschicken, auch für einen Notfall während der Fahrt. Etwas suspekt erschien mir das Ganze schon, aber mein immerwährender Optimismus hielt mich aufrecht, sodass ich im Krankentransporter sogar noch Witze machte. Ein Fahrer, zwei Sanitäter und der Pfleger waren dabei. Die Sanitäter schlossen mich an den Sauerstoff und an ein automatisches Blutdruckmessgerät an und das Ganze wurde zur Kontrolle meiner Daten mit einem Laptop verbunden. Mein Pfleger und der Sanitäter machten sehr sorgenvolle Gesichter. Ich machte noch Scherze, wie, das Blaulicht wäre aber nicht nötig gewesen, und lachte dabei. Der Fahrer hatte das Blaulicht während der gesamten Fahrt über an. Und noch eine blöde Bemerkung meinerseits war: „Das ich das mal erleben darf, hätte ich auch nicht gedacht.“ Keiner von den beiden verzog auch nur eine Miene. Ich war die Einzige, die scherzte. Das Lachen sollte mir dann auch sehr schnell vergehen. Ich war immer noch bei vollem Bewusstsein, auch gut drauf, schickte noch fleißig Kurznachrichten/SMS und WhatsApp-Nachrichten und entschuldigte mich noch dafür bei den Sanitätern und dem Pfleger, da ich es eigentlich für unhöflich halte, in Gegenwart von Freunden oder anderen Menschen keine Konversation zu betreiben und stattdessen auf dem Handy herum zu tippen. Nach einer halben Stunde kamen wir in der Notaufnahme der größeren Klinik an. Ich wurde gleich in die Intensivstation gefahren und dort von einer Ärztin sehr freundlich begrüßt. Sie erklärte mir, dass ich operiert werden und sie mich dafür vorbereiten und an die entsprechenden Geräte anschließen würde. Dann sollte ich ein Schlafmittel bekommen, um nicht zu überanstrengt zu sein. Noch während der Fahrt hatte ich überlegt, welche zwei Telefonnummern ich angeben wollte, die sie informieren sollten. Die Telefonnummer einer Berliner Freundin, mit der ich es abgeklärt hatte, war klar, aber dann? Gefühlt war es meine beste Freundin Kathi, oder doch eher mein Bruder? Blutsbande sind stärker als …
Es wurde mein Bruder. Im Nachhinein war das für Kathi schwierig, denn sie kam als Erste aus der Ferne nach Berlin. Sie hatte sich berechtigterweise Sorgen um mich gemacht, da sie nach der Kurznachricht per WhatsApp nichts mehr von mir gehört hatte, was ich zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen konnte. Sie gaben mir zur Stabilisierung und Beruhigung ein Schlafmittel und ab da setzte mein Bewusstsein aus. Alle guten Geister bzw. Freunde begannen, sich zu kümmern. Hier zeigte sich für mich, wie wichtig es ist, gute Freunde und ein zuverlässiges soziales Netz zu haben. Aus den Arztberichten und Gesprächen mit meinen „guten Geistern“ weiß ich, dass sie bei der Notoperation keine Lungen- bzw. Nierenbeckenentzündung behandeln mussten, sondern dass sich der Wundbereich um das neue Hüftgelenk entzündet hatte und mittlerweile durch das beständige Ignorieren meiner Anfragen und schlechten Werte in eine schwere Blutvergiftung/Sepsis umgeschlagen war. Daraus resultierten der niedrige Blutdruck und gleichzeitig eine übermäßige Herztätigkeit. Zu meinem Glück schlossen sie gleich auf die Hüftoperation als Ursache für die Sepsis und öffneten die Wunde. Laut einem Operateur und dem OP-Bericht entnahmen sie fast einen Liter eitrige Flüssigkeit und entzündetes Gewebe. Sie spülten die Wunde, wechselten das Gelenk, in der Hoffnung, dass mein Körper es annehmen würde und sie die Entzündung mit Antibiotika in den Griff bekommen würden. Von diesem Zeitpunkt an begannen sie mit der Gabe von Antibiotika. Mein gesamter Zustand war durch den enormen Blutverlust und trotz Gabe von Blutkonserven so schlecht, dass sie entschieden, mich im Narkosezustand zu belassen. Sie legten mich also ins künstliche Koma. Im Hintergrund organisierten sich ab hier die soeben erwähnten guten Geister. Meine Berliner Freundin, deren Telefonnummer ich angegeben hatte, hatte als Erste von meinen Freunden den Kontakt zu den behandelnden Ärzten. Sie wurde auch noch in der Nacht auf ihren Wunsch hin über meinen kritischen, lebensbedrohlichen Zustand informiert. Ab dem OP-Tag besuchte sie mich dann, um sich mit eigenen Augen ein Bild von meinem Zustand zu machen. Mein Bruder, der in Frankfurt am Main lebt, hatte ebenfalls ständigen telefonischen Austausch mit den Ärzten. Er konnte nicht kommen, da sein Sohn zur selben Zeit erkrankt war und ebenfalls in der Klinik lag. Zu meinem Glück, sofern man davon im Koma liegend sprechen kann, hatte meine beste Freundin Kathi an diesem Sonntag aus Sorge bei meinem Bruder angerufen und hatte sich daraufhin am Montag mit ihrem Mann auf den Weg zu mir gemacht, um mich zu sehen. Sie war jeden Tag für eine Stunde an meinem Bett. Ich habe leider keine bewusste Erinnerung an ihre Besuche. Da sich mein Zustand im Verlaufe der Woche nicht besserte und die Antibiotika noch keine Wirkung zeigten, zogen die Ärzte in Betracht, das eingewechselte Gelenk doch herauszunehmen und die Wunde erneut zu reinigen und zu spülen. Dazu übernahm mein Bruder die gesetzliche Betreuung für mich, um diesen notwendigen Eingriff vornehmen zu lassen. Am Freitag, am Ende dieser Woche, wurde das Gelenk wieder herausgenommen, die Wunde erneut gereinigt und gespült und entzündetes Gewebe entfernt. Ab da erholte ich mich von Tag zu Tag und wachte immer wieder für kurze Augenblicke auf. Hier setzten meine ersten Erinnerungen und Bilder wieder ein, die ich wenig später in einem Skizzenbuch festhielt. Zum Beispiel konnte ich mich an einen gelben, waagerechten Streifen erinnern, einen lilafarbenen in der Fantasie, sowie Tapetenmuster auf grünlich-hellem Grund, schwarze Linien mit floralen Elementen, grafisch, senkrecht angeordnet, wie eine Tapete. Möbel, wie ein auf blasbarer, oranger Sessel, Lampen und Nierentische aus den Sechziger-, Siebzigerjahren tauchten auf. Türen konnte ich sehen, in dem gelb-violetten und von besagter Tapete eingerahmten Rahmen. Im Nachhinein stellte ich fest, dass die Türen vom Flur sein mussten und der gelbe Streifen war in meinem Zimmer in der Intensivstation tatsächlich an der Wand. Einmal musste ich abhusten und hatte das Gefühl, ich schaffe es nicht, ich ersticke und rief „Hallo!“ Eine Schwester oder Ärztin in blauer OP-Kleidung trat an mein Bett. Mein Bild war wieder der gelb und lilafarbene Rahmen mit dem grafischen Tapetenmuster und die Schwester/Ärztin wirkte wie weichgezeichnet. Der Rahmen und die Türen waren aufgehellt, die Ränder weichgezeichnet, nur die Schwester war klar zu sehen. Sie sprach mich mit meinem Namen an. Im Nachhinein weiß ich, dass dieses Bild eine Mischung aus Traum und Wirklichkeit war, da ich an den beiden Tagen nach Aussagen des Krankenhauspersonals der Intensivstation phasenweise wach war.
Zurück ins Leben
Am Samstag, genau eine Woche nach der Notoperation, ließen sie mich dann aus dem Koma aufwachen. Ich konnte zwar die Augen aufschlagen, aber ich konnte mich kaum bewegen und auch nicht sprechen. Sprechen durfte ich auch nicht, weil während der Narkose und des Komas ein Schlauch zur künstlichen Beatmung in meiner Luftröhre steckte und die Atemwege nach so langer Zeit sehr rau und ausgetrocknet waren. Als ich aufwachte hatte ich das Gefühl, es wäre erst ein Tag nach der OP vergangen. Das dazwischen aber eine Woche Zeit vergangen und es mir so schlecht ergangen war, das hatte ich nicht mitbekommen. Plötzlich, als ich an besagtem Samstagmittag die Augen öffnete, standen zwei Freunde aus Hannover an meinem Bett. Ich dachte nur: ‚Warum sind die beiden jetzt hier? Ich hatte doch nur eine OP und nun war ich ja wieder wach und fit. Da waren sie extra aus Hannover hergekommen, warum nur?‘ Ich ahnte und begriff ja nichts, versuchte immer, den Kopf anzuheben, aber es ging nicht, ich hatte keine Kraft. Ich wollte sprechen, aber auch das ging nicht. Die zwei schauten sehr berührt und besorgt und ich konnte das gar nicht verstehen. Dann müssen mir wohl die Augenlider immer wieder zugefallen sein, kraftlos, wie ich noch war. Ich bin wohl kurz darauf vor Erschöpfung einfach eingeschlafen und wurde erst spätnachmittags wieder wach. Ich hatte es gar nicht bemerkt, dass die beiden Freunde sich verabschiedet hatten und gegangen waren. Dann stand meine beste Freundin Kathi mit ihrem Bruder auf einmal an meinem Bett. Dass sie schon die ganze Woche da gewesen war, wusste ich ja nicht und ich fragte mich erneut, warum sie wohl gekommen war. Ihr standen die Tränen in den Augen, sie war ganz berührt, streichelte meinen Arm und beruhigte mich. Ich wollte immer den Kopf heben, wollte sprechen, aber das ging alles nicht. Ich hatte keine Kraft, riss die Augen weit auf und selbst die Augenlider fielen immer wieder zu, so kraftlos war ich von der Woche, die ich im künstlichen Koma gelegen hatte. Im Hintergrund stand der Bruder meiner Freundin, der in Berlin lebt. Es wunderte mich auch, dass er mit ihr zu Besuch da war. Auch er sah mich berührt an, hatte Tränen in den Augen. Ich war nach einer halben Stunde so müde, dass ich verwundert über die außergewöhnlichen Besuche wieder einschlief.
Als ich abends noch einmal kurz aufwachte, fragte ich nach etwas zu trinken. Beim ersten Aufwachen hatte ich mir sehnlichst etwas Wasser gewünscht. Ich hatte nach der Woche durch die künstliche Beatmung einen sehr trockenen Hals. Aber als ich jetzt voller Freude den ersten Schluck Wasser nahm, da brannte es wie Feuer im Mund und in der Speiseröhre, es war höllisch. Am nächsten Tag war ich dann schon für längere Phasen wach. Zum Frühstück fütterte mich der mir für die Woche zugeordnete Pfleger, der mich auch wusch und eincremte. Nach dem Frühstück stellten sie mein Spezialbett um, sodass ich fast aufrecht sitzen konnte. Mich aus eigener Kraft im Bett aufzusetzen, war mir nicht möglich, dazu war ich noch zu schwach. Die Visite kam, während ich aß, sogar am Sonntag. Sieben Ärzte, Schwestern und der Pfleger. Ich war überrascht, dass eine so große „Abordnung“ kam. Ein Oberarzt, der schon älter war, strich mir wohlwollend über die Beine und meinte, dass sie froh wären, dass es mir so gut ginge. Es wäre sehr knapp gewesen und es wäre fast ein Wunder, dass ich alles so gut überstanden hätte. Sie erklärten mir, was sie während der Notoperation alles gemacht hatten, die Hüfte entnommen, eine Behandlung mit Antibiotika begonnen und dass sie zwei Tage vor meinem Aufwachen die eingewechselte Hüfte leider wieder herausnehmen mussten, damit die Entzündung endgültig abklingen konnte. Ich müsste drei Monate ohne Gelenk bleiben, aber das Wichtigste sei, dass ich die Blutvergiftung überstanden und überlebt hätte. Das Einzige, was ich wohl geflissentlich anders verstanden hatte, war, dass ich nach drei Tagen (!!!) statt nach drei Monaten die Hüfte wiedereingesetzt bekäme. Kathi und die Berliner Freundin hatten sich gewundert, aber nichts dazu gesagt, als ich ihnen die frohe Kunde nachmittags erzählte, als sie zu Besuch kamen. Sie wollten mich wohl nicht bloßstellen.
Die beiden fragten mich, was ich denn gern zu essen hätte. Ich antwortete tatsächlich: „Ich hätte gern ein Steak.“ Da wussten sie zumindest, dass es mir wieder ganz gut ging, den Umständen entsprechend natürlich. Statt Steak konnte ich wenigstens ein paar Löffel Vanillepudding essen. Kathi fütterte mich, da ich weder aufrecht sitzen noch selbst einen Löffel halten konnte. Der Pudding war cremig und süß, also genau das Richtige für mich. Nach einer Stunde war ich erschöpft und die beiden gingen wieder, denn sie wussten, dass mein Bruder noch kommen wollte. Ich muss wohl direkt eingeschlafen sein. Als ich nach einer Weile die Augen wieder aufschlug, saß auf einmal mein Bruder an meinem Bett. Ich habe mich im Rahmen meiner Möglichkeiten überschlagen vor Freude, ihn zu sehen. Und er war total gerührt, hatte feuchte Augen, war sprachlos und glücklich, dass ich das Schlimmste überstanden hatte. Er hielt einfach nur meine Hand und wir sahen uns eine halbe Ewigkeit an, so fühlte es sich jedenfalls für mich an. Nach dem Pudding konnte ich auch langsam wieder trinken. Er reichte mir auf meinen Wunsch eine rosafarbene Schnabeltasse mit Wasser und ließ mich trinken. Dann fragte der Pfleger, ob ich noch Hunger hätte, noch einen Pudding wollte, und mein Bruder fütterte mich. „Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich dich mal füttern würde“, sagte er nur leise lächelnd. Ich lächelte auch. Und dann sahen wir uns wieder eine ganze Weile an. Irgendwann wurde ich wieder müde, mir fielen die Augenlider zu. Er musste auch wieder nach Frankfurt zurück und montags wieder arbeiten. Er drückte mich, war immer noch gerührt und glücklich, dass ich überlebt hatte, winkte an der Zimmertür noch mal und ging. Ich schlief vor Erschöpfung gleich ein, wachte nur kurz auf, als der Pfleger mir die Zähne putzte, denn auch dazu fehlte mir noch die Kraft.
Am nächsten Morgen wachte ich schon von selbst auf. Ich beobachtete erst mal die doppelte Türschleuse zu meinem Zimmer. Durch einen Spalt konnte ich den Flur sehen, die Theke mit Monitoren, Schwestern, Pfleger und Ärzte, die kamen und gingen. Irgendwann kam mein Pfleger und wusch mich von Kopf bis Fuß. Es war bei den Genitalien kurz etwas unangenehm, aber ich konnte noch nichts selbst tun, halten oder helfen. Er cremte mich ein und es duftete nach Blaubeere. Da dachte ich noch: ‚Die haben ja einen guten Geschmack, genau wie ich.‘ Nach ein, zwei Tagen begriff ich erst, dass der Pfleger meine Waschutensilien verwendete. Nach der Morgentoilette war ich geschafft und schläfrig, obwohl ich selbst nichts getan hatte, im Nachhinein selbst für mich kaum mehr nachvollziehbar. Der Pfleger räumte Waschschüssel, Lappen, Cremes, Duschgel, Zahnputzsachen weg und fragte mich, was ich gern zum Frühstück hätte. Ich wünschte mir Weißbrot mit Käse. Er bestrich mir eine Scheibe und schnitt sie in sehr kleine Stücke. Ich dachte noch, ich habe doch Zähne, so klein muss er das Brot wirklich nicht schneiden. Aber ich hätte die ganze Scheibe Brot gar nicht halten können. So saß ich da mit einem Lätzchen um den Hals und versuchte überhaupt erst mal, die Gabel in die Hand zu nehmen, festzuhalten und den Teller mit der Gabel anzusteuern. Schon das schien mir fast unmöglich. Nach einigen Versuchen kam ich an den Teller heran und zielte auf ein kleines Stückchen Brot. Ich musste mehrere Versuche unternehmen. Als die Gabel endlich über einem Stück Brot schwebte, musste ich sie nur absenken und etwas hineindrücken, eigentlich ein ganz normaler Vorgang, aber für mich in diesem Moment fast unerreichbar schwer. Endlich hatte ich ein Stückchen Brot aufgespießt, hob es langsam an, es schwang hin und her und fiel … auf mein Lätzchen! Ich war völlig er-schöpft, legte meinen Kopf ab und schloss einen Moment die Augen. Neuer Versuch: Gabel anheben, zum Teller führen, absenken, in ein Stück Brot mit Käse stechen, wieder anheben und ganz vorsichtig zum Mund führen. Dieses Mal war es von Erfolg gekrönt. Ich hatte schließlich Hunger! Noch einige Stücke landeten auf meinem Bauch statt in ihm, aber ich wurde langsam besser. Irgendwann konnte ich nicht mehr und der Pfleger räumte ab, lobte mich, dass ich schon geschafft hatte, selbst zu essen. Er reichte mir die rosafarbene Schnabeltasse mit Pfefferminztee, denn dafür hatte ich keine Energie mehr. Gerade fertig gegessen, der Pfleger hatte das Frühstück abgeräumt, die Augen fielen mir zu, kam die Visite, wieder in großer Besetzung. Sie machten sich wirklich Sorgen um mich. Der Chefarzt strich mir über die Beine und sah mich zufrieden und sichtlich erleichtert an. Ein Arzt meinte wieder, es sei ein Wunder, dass ich das überlebt hätte, es hätte sehr knapp ausgesehen und dass ich auch hätte sterben können. Im Nachhinein bin ich heilfroh, dass ich die ganze Dramatik meiner Situation zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht ermessen konnte. Da scheint die Natur dem Menschen eine Art Schutzschirm eingebaut zu haben, der einem nur kleine, verdaubare Häppchen von Verständnis zugesteht. Sonst würde man wahrscheinlich die Situation gar nicht aushalten können. Die Medikamente werden ihr Übriges dazu beigetragen haben, mich zu beruhigen. Wieder müde, wie es schien nur vom Liegen und Essen, schlief ich wieder ein. Dann kam die Physiotherapeutin. Noch fühlte sich mein linkes Bein wie ein Fremdkörper, wie ein kaltes Stück Fleisch an, das leblos an mir hing. Daran, mich selbst zu bewegen, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu denken. Umso verwunderlicher war es, dass ich auf das Kommando der Physiotherapeutin langsam und nur ein bisschen, aber immerhin, die Zehen bewegen und sogar zu mir heranziehen konnte. Ein seltsames Gefühl! Dass es von hier an noch ein elend langer Weg werden würde, mit vielen, vielen Rückschlägen, dass konnte ich zum Glück nicht ermessen. Ich hätte vielleicht aufgegeben. Aber so ging es sehr, sehr langsam wieder aufwärts. Die Physiotherapeutin strich das Bein aus, massierte und bewegte es durch.
Auch sie bemerkte immer mal wieder, nicht nur an diesem Tag, was für ein Wunder es sei, dass ich das alles überlebt hätte und schon in dieser kurzen Zeit sichtbare Fortschritte machen würde. Nach einer halben Stunde Arbeit an mir war ich völlig erschöpft und döste wieder ein. Ich schlief und schaute, wenn ich wach war, herum, nahm das Zimmer wahr, im Grunde wie ein Kind, dass mehr und mehr von seiner Umgebung mitbekommt. Die Bilder und das, was ich um mich herum sehen, beobachten und wahrnehmen konnte, wie Gerüche, z. B. meine Body Butter Heidelbeere, den Geschmack beim Essen, zu Anfang von den Medikamenten verfälscht, konnte ich langsam, Schritt für Schritt wieder wahrnehmen. Mittags gab es dann ein paar Kartoffelstückchen mit etwas Sauce und eine kleine Portion Gemüse zu essen. Es dauerte, bis ich alles aufgegessen hatte. Der Pfleger half, aber ein paar Gabeln voll probierte ich alleine, mit Lätzchen, versteht sich, sonst hätte nach jeder Mahlzeit das Bett abgezogen werden müssen. Ich kam mir so unbeholfen schon etwas komisch vor. Dann kam das Mittagsschläfchen, brauchte mir niemand anzusagen, mir fielen die Augen schon von selbst zu. Kaffee zum Kaffee reizte mich noch nicht. Morgens hatte ich zwischendrin schon angefangen und geübt, die rosafarbene Schnabeltasse selbst vom Nachttisch zu greifen, zu mir heranzuholen und mit beiden Händen zum Mund zu führen. In der Schwebephase wackelte sie schon sehr, aber es gelang. Dann traf ich auch meinen Mund immer besser. Ich hatte mir schließlich vorgenommen, meine Freundin Kathi, die mich ja jeden Tag besuchte, wofür ich sehr dankbar war und noch immer bin, mit diesem Stückchen Selbstständigkeit zu überraschen. Als sie zur Kaffeezeit kam und mich fragte, ob ich was trinken wollte, antwortete ich mit Ja. Sie wollte mir gerade die Schnabeltasse anreichen, da sagte ich zu ihr: „Kunststück, warte!“ Ich hob langsam meinen Arm, führte die Hand zum Becher, musste den Griff gut umgreifen. Glücklicherweise konnte sie es aushalten, zuckte nur kurz, als der Becher auf seinem Weg zu meinem Mund etwas schwankte, aber ich hatte es geschafft, trank und strahlte sie an wie ein kleines Kind, das etwas Tolles, Neues gelernt hatte. Sie freute sich mit mir. Unendliche Geduld brauchte sie vor allem, mit anzusehen, wie ich langsam wieder auf die Beine kam. Und es gibt kaum eine Möglichkeit, auszudrücken, wie dankbar ich ihr dafür bin, dass sie so lange, fünf Wochen, jeden Tag für mich da war und die Hilflosigkeit und die Ängste, die sie verspürte, aushielt. Sie war mir eine riesengroße Unterstützung. Daran sehe ich immer wieder, wie wichtig es ist, in der Not gute Freunde, Familie und ein festes, tragendes soziales Netz zu haben. Nach ein, zwei Stunden war ich langsam wieder müde und meine Freundin auch. Sie verabschiedete sich, wir umarmten uns mit ein paar Tränen der Rührung in den Augen. Dann gab es Abendbrot, selbst mit der Gabel aufgepickt, das erste Mal, und es ging ganz gut (hatte ich ja morgens mit dem Frühstück geübt!). Dann probierte ich das erste Mal, mir selbst die Zähne zu putzen, was wider Erwarten schon einigermaßen unfallfrei gelang. Ich hatte viel geschafft an diesem zweiten Tag in meinem neuen Leben!