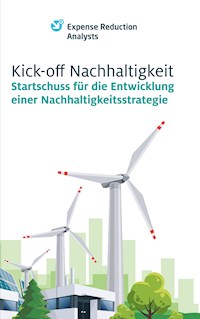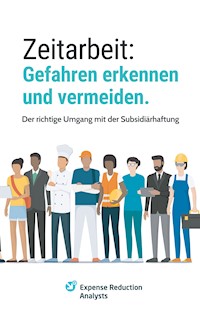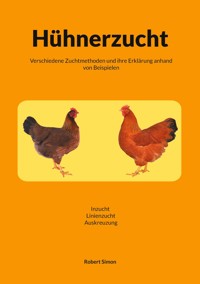
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Frage nach den Methoden zur Zucht unserer Hühner bereitet so manchem Hobbyzüchter Kopfzerbrechen. Vor allem das Thema Inzucht wird in der Hühnerzucht - und auch anderswo - oft kontrovers diskutiert. Da die tatsächliche Wirkungsweise dieser Zuchtform dennoch viel zu selten beleuchtet wird, führt dies mitunter zu einiger Unsicherheit unter den Züchtern und nimmt ihnen damit vielleicht die Möglichkeit, effektiver zu züchten und ihre Ziele schneller zu erreichen. Eine Erklärung des grundlegenden Sachverhaltes ist vonnöten. In diesem Buch sollen die Chancen, aber auch die Risiken dieser Zuchtform näher beleuchtet werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt:
Schreckgespenst Inzucht
Allgemeines
Was ist Inzucht?
Möglichkeiten
Gründe für positive und negative Ergebnisse
Sinn der Inzucht
Die Effekte der Inzucht
Variation
Vor- und Nachteile
Inzuchtdepression und Degeneration
Zuchtziele
Linienzucht
Vorteile der Linienzucht
Was kann schief gehen?
Hahn oder Henne?
Auskreuzung (Outcrossing) in der Linienzucht
Begriffsdefinition
Sinn und Notwendigkeit des Auskreuzens
Die Notwendigkeit mehrerer Linien
Wann ist es Zeit für eine Auskreuzung?
Heterosiseffekt
Auskreuzung im Vergleich zur Kreuzungszucht
Vor- und Nachteile des Kreuzens
Mögliche Ergebnisse aus Kreuzung
Kreuzungen und ihre Auswirkungen
Der Zuchtwert eines Hybriden für andere
Die Einführung neuen Blutes
Risiken und Tipps
Zusammenfassung
Beispielhafte Übersicht über dominant-rezessive Verhältnisse zwischen vererbbaren Merkmalen
Erklärung einiger Begriffe
Schreckgespenst Inzucht
Allgemeines:
Wenn es um das Thema Inzucht geht, sind die Ansichten der Züchter ebenso vielfältig wie ihre Argumente. Die einen lehnen diese Zuchtform als schlicht unnatürlich und krank ab, für andere ist sie ein fester Bestandteil ihrer Zuchtausführung.
Es geht mir in diesem Buch weniger um die Antwort auf die Frage, wer nun diesbezüglich recht hat oder eben nicht, wenn sich auch im Laufe der Kapitel ein Statement abzeichnen wird.
Vielmehr möchte ich einen Überblick über das Thema und die Möglichkeiten und Risiken, die diese Zuchtmethode mit sich bringt, geben. Viele kennen zwar den Begriff Inzucht, wissen aber nicht genau, um was es sich in Bezug auf die Tierzucht wirklich handelt. Hier sehe ich Erklärungsbedarf und möchte dem im Folgenden gerecht werden.
Weiterhin werde ich auf die Themen Linienzucht und Auskreuzung eingehen, die Bestandteil einer langfristigen Inzuchtstrategie sind und demnach Hand in Hand mit ihr gehen. Es geht also nicht allein um die Erklärung, was Inzucht an sich bedeutet, sondern um eine komplette Zuchtstrategie, die Linienzucht und Auskreuzung beinhalten muss. Diese sind unerlässliche Teile davon.
Zu alle dem gehören grundlegende Kenntnisse zur Vererbung. Wenn auch der ein oder andere ein wenig auf Kriegsfuß mit den Vererbungsregeln stehen mag, so sind sie, ebenso wie ein grundsätzliches Wissen zur Genetik, für das Verständnis der Materie Zucht entscheidend. Zu Erklärungszwecken werde ich immer wieder, möglichst verständlich formuliert, auf sie zurückgreifen. Doch dies soll ein Überblick über Inzucht und ihre Ausführungsmethoden werden, keine tiefgründige Einführung in die Genetik. Darüber sind bereits genügend Bücher geschrieben worden.
Was ist Inzucht?
Inzucht bedeutet die Verpaarung eng verwandter Individuen. Beispiele sind Onkel-Nichte- und Großmutter-Enkel-Verpaarungen, aber auch engere wie etwa Eltern-Kinder oder Vollgeschwister-Paarungen.
Die Idee hinter dieser Zuchtmethode - und damit der Grund dafür - ist es, bestimmte gewünschte genetische Informationen zu sichern und zu verstärken (Farbe, Kammform oder ähnliches) und gleichzeitig unerwünschte Merkmale in einer Zuchtfamilie zu beseitigen. Das wird erreicht, indem der Züchter die Reinerbigkeit (Homozygotie) der Individuen für bestimmte genetische Informationen erhöht. Dazu später mehr.
Inzucht führt auf längere Sicht zu einer Isolation, einer Festigung des Auftretens sozusagen, bestimmter Gene in einer Linie oder Zuchtfamilie. Ob die Ergebnisse zur Verbesserung der Familie oder zu einem Desaster führen, hängt maßgeblich von den Ausgangstieren, noch mehr aber vom Züchter selbst ab.
Bei Inzucht als Zuchtform ist für gewöhnlich nicht die Rede von einer einmaligen Verpaarung verwandter Tiere. Vielmehr ist sie in den meisten Fällen eine längerfristige Zuchtstrategie, die bei bewusster und kluger Auslese verhältnismäßig schnell zum gewünschten Erfolg führen kann. Hierzu gehören wie erwähnt unbedingt die Bestandteile Linienzucht und Auskreuzung.
Das Entstehen praktisch jeder erfolgreichen Geflügelfamilie oder auch das Herauszüchten von Rassen wurde erst mit einem hohen Anteil von Inzucht möglich gemacht. Züchtungen von Leistungslinien, wie zum Beispiel denen von Legehühnern, wären ohne Inzucht nicht möglich gewesen. Auch bei anderen Tieren wie Rindern und Pferden hatte Inzucht ihren Anteil am Heranziehen besonders leistungsfähiger oder an neue Bedürfnisse angepasste Linien oder Rassen.
Möglichkeiten:
Inzucht bietet die Möglichkeit, sich bei intelligenter Selektion in relativ kurzer Zeit eine Linie aufzubauen, die viele erwünschte Merkmale in reinerbiger (homozygoter) Form in sich vereint. Dafür ist es natürlich vonnöten, dass die Ausgangstiere, also die, mit denen man sein Programm startet, diese Merkmale zumindest in heterozygotem (mischerbigem) Zustand mitbringen. Hier ist es nicht unbedingt Voraussetzung, dass jedes der Ausgangstiere alle gewünschten Merkmale trägt.
Sagen wir, es würde sich um insgesamt drei Merkmale handeln, die in einer Linie dahingehend gefestigt werden sollen, dass alle Tiere sie in homozygotem Zustand tragen, wie etwa eine bestimmte Kammform, Lauffarbe oder Gefiederfarbe. Dabei kann es ausreichen, dass etwa der Hahn eines, die Ausgangshenne die anderen zwei Merkmale in heterozygotem Zustand trägt. Durch Inzucht und jeweils gut überlegte Auswahl der Nachkommenschaft, erhält man am Ende Tiere, die alle drei Merkmale in reinerbigem Zustand in sich vereinen.
Wie das funktionieren soll?
Zuerst einmal klären wir, was genau es mit homozygot bzw. heterozygot auf sich hat:
Wie beispielsweise auch beim Menschen, so hat jedes Huhn zwei Ausführungen eines jeden Genes, genannt Allele, auf jedem Genort. Das liegt ganz einfach daran, dass wir alle einen doppelten Chromosomensatz besitzen. Dieser doppelte Chromosomensatz wird zur Fortpflanzung auf einen einzelnen Satz reduziert. Das bedeutet, dass die Keimzellen (Spermien, weibliche Eizelle) jeweils nur einen Chromosomensatz beinhalten. Durch die Verschmelzung mit der anderen Keimzelle entsteht dann wieder ein kompletter, doppelter Chromosomensatz. Somit ererbt das Küken je die Hälfte seiner Gene vom Vater, die anderen von der Mutter. Einzige Ausnahme sind geschlechtsgebundene Gene, wie etwa der Sperberfaktor, der eine Querbänderung der einzelnen Feder bewirkt. Dies ist für das folgende Beispiel allerdings nicht relevant.
Homozygot bedeutet, wie gesagt, dass auf einem Genort zwei gleiche Allele zu finden sind, also die gleiche Erbinformation auf beiden Chromosomen. Das Tier ist damit reinerbig für ein bestimmtes Merkmal. Im Fall der Heterozygotie besitzt ein Tier zwei unterschiedliche Allele, es ist mischerbig, kann also sowohl das eine als auch das andere Gen weitervererben. Im Fall der Mischerbigkeit entscheiden die Dominanzverhältnisse über die phänotypische Ausprägung des Merkmals.
Nehmen wir als Beispiel die Kammvarianten. Trägt ein Tier sowohl das Gen für den Einfachkamm (auch Stehkamm genannt) als auch für den Erbsenkamm, so wird es phänotypisch, also „sichtbar“, den Erbsenkamm ausprägen (wenn auch mitunter die mittlere Perlenreihe des Kammes erhöht sein kann). Das liegt daran, dass das Gen für den Erbsenkamm gegenüber dem für den Einfach- oder Stehkamm dominant ist. Genotypisch, also von der genetischen Zusammensetzung her, ist das Tier also mischerbig (heterozygot) für das Merkmal Einfachkamm. Phänotypisch wird allerdings der Erbsenkamm ausgeprägt.
Um die Dominanzverhältnisse der Gene auszudrücken, werden diese mit Groß- und Kleinbuchstaben bezeichnet - dominante Gene groß, rezessive Gene klein.
Nehmen wir an, wir möchten in unserer Linie den Erbsenkamm festigen, es steht aber nur ein einziges passendes Tier zur Verfügung, dass dieses Merkmal zudem nur in heterozygotem Zustand trägt. Ansonsten haben wir nur Tiere mit Einfachkamm zur Verfügung.
Der genetische Code für den Erbsenkamm lautet rrPP, der für den Einfachkamm rrpp. RRpp wäre zum Beispiel die Kombination für einen Rosenkamm, RRPP die für den Wulstkamm (Walnusskamm), wie er etwa typisch für die Malaien ist. Die Buchstaben sind jeweils doppelt, da, wie bereits gesagt, durch den doppelten Chromosomensatz des Tieres jedes Gen zweimal vorkommt (zwei Allele), mitunter allerdings in unterschiedlicher Ausprägung (Mischerbigkeit).
Bei der Bildung der Keimzellen wird dieser doppelte Chromosomensatz zu einem einfachen reduziert, da die andere Hälfte vom anderen Elternteil beigesteuert wird.
Im oben genannten Fall, wenn ein Ausgangstier den Erbsenkamm phänotypisch zeigt, aber mischerbig für Einfachkamm ist, hat es, in Buchstaben ausgedrückt, die genetische Information rrPp. Die daraus entstehenden Keimzellen beinhalten demnach die möglichen Erbinformationen rP oder rp.
Das zweite Tier, nehmen wir an, die Henne, trägt also einen Einfach- oder Stehkamm und damit die Erbinformation rrpp.
Wie lässt sich nun aus diesen Tieren auf lange Sicht eine Nachkommenschaft erzeugen, die das Merkmal Erbsenkamm reinerbig trägt und in Zukunft ausschließlich erbsenkämmige Individuen hervorbringt, also die genetische Information rrPP trägt?
Die Antwort lautet wie folgt:
Hahn ♂
Henne ♀
rrPp
rrpp
Daraus ergeben sich, durch die erwähnte Reduktion zu einem einfachen Chromosomensatz die Keimzellen:
des Hahnes:
der Henne:
und
Diese bilden dann wieder neue Individuen mit einem kompletten, doppelten Chromosomensatz:
rrPp
Erbsenkamm (mischerbig)
25% *
rrPp
Erbsenkamm (mischerbig)
25% *
rrpp
Einfachkamm (reinerbig)
25% *
rrpp
Einfachkamm (reinerbig)
25% *
* Die Prozentangabe bezeichnet die rechnerische Wahrscheinlichkeit des Auftretens
Wie wir sehen, erhalten wir in der Nachzucht im Mittel 50 Prozent Tiere mit Erbsenkamm, die dafür heterozygot sind. Die restlichen 50 Prozent tragen einen Einfachkamm, für den sie, ebenso wie die Mutter, homozygot sind.
Im zweiten Schritt können wir nun die erbsenkämmigen Tiere entweder untereinander oder auch mit dem Ausgangshahn verpaaren. Dies bedeutet für diesen nächsten Zuchtschritt zweimal die genetische Kombination rrPp und dementsprechend folgende Keimzellen:
Hahn:
Henne:
und
Die Nachkommenschaft hieraus spaltet sich nun wie folgt auf:
rrPP
Erbsenkamm (reinerbig)
25% *
rrPp
Erbsenkamm (mischerbig)
25% *
rrPp
Erbsenkamm (mischerbig)
25% *
rrpp
Einfachkamm (reinerbig)
25% *
* Die Prozentangabe bezeichnet die rechnerische Wahrscheinlichkeit des Auftretens
(Da für die Ausprägung des Einfachkammes rezessive Gene verantwortlich sind, ist jedes Tier, das phänotypisch den Einfachkamm zeigt, hierfür auch homozygot.)
Wir sehen, dass nun schon in der zweiten Generation aus lediglich einem mischerbigen Tier mit Erbsenkamm in der Ausgangspopulation reinerbige Tiere für das gewünschte Merkmal fallen. Werden nun ausschließlich diese Tiere für die Weiterzucht ausgewählt, werden in Zukunft auch nur erbsenkämmige Individuen fallen.
Die einzige Frage, die sich nun stellt, ist die, welche der Tiere mit Erbsenkamm nun jene sind, auf die wir hin gezüchtet haben, die reinerbigen für dieses Merkmal also. Schließlich trägt drei Viertel der
Nachkommenschaft einen Erbsenkamm, aber nur ein Viertel ist hierfür reinerbig.
Die Lösung bietet ein Nachkommenstest:
Man verpaart die erbsenkämmigen Tiere mit solchen, die einen Einfachkamm tragen. Ist ein Tier nämlich reinerbig für den Erbsenkamm, so muss die Nachkommenschaft aus einer solchen Verpaarung ausschließlich erbsenkämmig sein:
Tester: (rrPP)
einfachkämmiges Tier: (rrpp)
und
Nachzucht:
rrPp
Erbsenkamm (mischerbig)
100% *
* Die Prozentangabe bezeichnet die rechnerische Wahrscheinlichkeit des Auftretens
Alle Tiere sind mischerbig für Einfachkamm, zeigen aber aufgrund des dominanten Genes den Erbsenkamm. Zeigt auch nur eines der Nachkommen einen Einfachkamm, so ist dies ein eindeutiges Indiz dafür, dass das getestete Tier lediglich mischerbig ist.
Theoretisch müsste sich in diesem Fall die Nachkommenschaft in 50 Prozent erbsenkämmige und 50 Prozent einfachkämmige Individuen aufspalten:
Tester: (rrPp)
einfachkämmiges Tier: (rrpp)
und
Nachzucht:
rrPp
Erbsenkamm (mischerbig)
50% *
rrpp
Einfachkamm (reinerbig)
50% *
* Die Prozentangabe bezeichnet die rechnerische Wahrscheinlichkeit des Auftretens