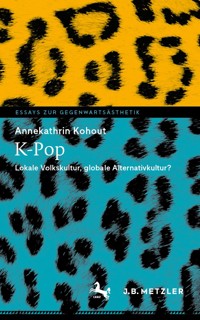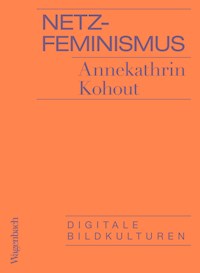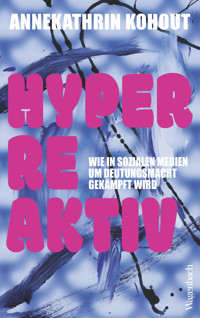
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum ist Online-Kommunikation geprägt von Überreizung, Missverständnissen und gegenseitigem Misstrauen? Wie wird online mit Bildern und ihrer Interpretation Politik gemacht? Und mit welchen Methoden wird in den Sozialen Medien um Deutungsmacht gekämpft? Die Kulturwissenschaftlerin Annekathrin Kohout erkundet die Sozialen Medien als eine Welt, in der alles auf möglichst starke Reaktionen ausgelegt ist. Nur wer permanent beurteilt, kommentiert, teilt oder mit seinen Beiträgen selbst starke Interaktionen hervorruft, wird hier von den Algorithmen belohnt – mit fatalen Konsequenzen, auch für die Debatte außerhalb der Plattformen. Anhand persönlicher Erfahrungen, prägnanter Fallbeispiele und theoretischer Reflexionen legt Kohout anschaulich offen, wie in den Sozialen Medien analytische, forensische und investigative Methoden imitiert werden, um gezielt Desinformation zu verbreiten und Stoff für Polarisierung zu bieten. Und sie zeigt, welche Verantwortung jeder einzelne User dabei trägt. Wer einen glaubwürdigen demokratischen Diskurs noch nicht aufgeben möchte, sollte diese Bestandsaufnahme der digitalen Gegenwart dringend lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Likes, Shares und Eskalationsspiralen: Willkommen in der Reaktionskultur! Die Kulturwissenschaftlerin Annekathrin Kohout wirft einen Blick hinter die Erregungsdynamiken der Sozialen Medien –auf die Strukturen und Methoden, die öffentliche Debatten längst weit über das Netz hinaus bestimmen.
ANNEKATHRIN KOHOUT
HYPER REAKTIV
WIE IN SOZIALEN MEDIEN UM DEUTUNGSMACHT GEKÄMPFT WIRD
Verlag Klaus Wagenbach Berlin
Vorwort: Reaction is King!
IWILLKOMMEN IN DER REAKTIONSKULTUR!
Antwort ohne Rede
Get Feedback or it didn’t happen
Die Reaktionskultur der Sozialen Medien
Plattformspezifische Reaktionskulturen
Die Gunst und Missgunst der Interpretation
Verhängnisvolle Sichtbarkeit
Digitale Gegnerschaft
You can obviously see it’s fake
IIHYPERINTERPRETATION
Greta Thunberg und der forensische Blick
Das Problem der hermeneutischen Willkür
Formen der Hyperinterpretation
Wie Hyperinterpretation scheitern kann
Die Kunst der schnellen Evidenzerlebnisse
Die Umverteilung der Deutungsmacht
Deutungsgemeinschaften
Das aufgeklärte falsche Bewusstsein im digitalen Zeitalter
Reagieren, ohne zu kommunizieren
The left can’t meme – und auch nicht hyperinterpretieren?
Hyperinterpretation in real life
IIIHYPERREAKTIVITÄT
Der hyperreaktive Mensch
Lost in Interpretation
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
VORWORT: REACTION IS KING!
Wer kennt es nicht: Kaum hat der Tag begonnen, schon hat man zig Posts und Storys durchgeklickt, ein Meme gelikt, gezögert, ob man ein Meme liken soll, viel zu viele Kommentare und Nachrichten gelesen (manche gelikt), sich über einen wildfremden Menschen und sämtliche Live-Ticker-Meldungen geärgert und aus Versehen eine Werbung geklickt, weswegen einem nun monatelang Thermomix-Zubehör angezeigt wird. Wir User reagieren, bevor wir denken. Wir liken, bevor wir fühlen. Wir empören uns, weil es nun mal alle tun. Die tägliche Masse an Informationen erscheint oft belanglos und überfordernd zugleich. So, als wäre man nur noch im Reaktionsmodus – unfähig, wirklich autonom und gestalterisch zu handeln.
Willkommen in der Reaktionskultur! In der digitalen Welt sind Reaktionen zur primären Form der Kommunikation geworden. Wir liken, teilen, kommentieren und bewerten – ständig, überall und meist innerhalb von Sekunden. Nicht mehr der Inhalt selbst, sondern die Resonanz auf den Inhalt bestimmt, was sichtbar wird, welche Debatten eskalieren und welche Narrative dominieren.
Natürlich waren Reaktionen schon immer Teil kultureller, politischer und wirtschaftlicher Dynamiken. Gesellschaften reagieren auf Krisen, Bewegungen formen sich als Antwort auf Missstände, und auch Kunst und Popkultur sind oft Gegenentwürfe und Reaktionen auf ihre Vorgänger. Der maßgebliche Unterschied liegt in der beispiellosen Beschleunigung und Intensivierung dieser Prozesse durch digitale Technologien. Soziale Medien haben einen permanenten Rückkopplungskreislauf geschaffen, in dem jede Handlung unmittelbare, weltweite Reaktionen provozieren kann. Die frühere räumliche und zeitliche Begrenzung von Reaktionen ist aufgehoben: Ein lokales Ereignis kann binnen Stunden globale Protestwellen auslösen, kulturelle Trends verbreiten sich in Echtzeit über Kontinente hinweg. Diese Dynamik wird durch Algorithmen systematisch verstärkt, die gezielt reaktionsintensive Inhalte priorisieren. So ist aus der menschlichen Neigung zu reagieren ein kommerzielles Prinzip geworden: In der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie sind Reaktionen zur wichtigsten Währung avanciert: Reaction is King!
Die Reaktionskultur manifestiert sich in charakteristischen Formaten wie Memes, Stitches, Reaction-Videos oder -GIFs. Sie alle folgen einem ähnlichen Prinzip: Statt ausschließlich Originalinhalte zu schaffen, greifen die Producer auf Bestehendes zurück, das sie variieren und kommentieren. Was in der Kunst des 20. Jahrhunderts – von den Readymades Marcel Duchamps über die affirmative Pop Art von Andy Warhol bis zur Appropriation Art à la Richard Prince – noch als avantgardistische Strategie galt, ist zum Standardmodus der Kommunikation geworden.1
Sah man in der Möglichkeit zur Partizipation in der Anfangszeit der Kommentarkultur Ende der neunziger Jahre, auf Nachrichten- und Magazin-Websites oder in eigens dafür vorgesehenen Foren, noch ein Empowerment der User, geht mit dem Gefühl, sich im ständigen Reaktionsmodus zu befinden, nun zunehmend ein negatives Selbstverständnis einher: Viele User betrachten sich als passiv, ohnmächtig, im Kreislauf des Reagierens gefangen – individuell, aber auch auf kollektiver und gesellschaftlicher Ebene. Persönlich und politisch: So wird Parteien und Regierungen mittlerweile häufig vorgeworfen, nicht mehr selbst Themen auf die Tagesordnung zu setzen, sondern nur noch auf Entwicklungen und Stimmungen zu reagieren, die sich in der digitalen Öffentlichkeit formieren – ob diese nun durch zivilgesellschaftliche Gruppen angestoßen oder von populistischen Strömungen lanciert wurden. Beispiele hierfür reichen von identitätspolitischen Debatten, die von Aktivisten in den Fokus gerückt wurden, bis hin zur Verschärfung der Migrationspolitik als Reaktion auf den Druck rechter Parteien. In diesem Gefühl zeigt sich mehr als nur digitale Überforderung. Es ist Symptom einer gesellschaftlichen Verunsicherung. Was als »Transformationsmüdigkeit«2 beschrieben wird, ist Ausdruck eines Konflikts zwischen dem Zwang zur ständigen Anpassung und dem Bedürfnis nach selbstbestimmtem Handeln.
Ich möchte in diesem Buch deutlich machen, dass das, was ich im Folgenden als Reaktionskultur beschreiben werde, mehr als nur ein Nebeneffekt digitaler Beschleunigung ist. Diese Reaktionskultur hat sich zu einem strukturellen Problem entwickelt, das tief in der Architektur der Plattformen verankert ist. Soziale Medien haben grundlegend verändert, wie wir Informationen konsumieren, bewerten und verbreiten. Plattformen wie TikTok, Instagram, LinkedIn, Bluesky oder Twitter/X prägen den Alltag ihrer User, immer öfter aber auch kulturelle und politische Debatten, die früher in anderen Medien wie Zeitungen und Fernsehen entstanden, ausgefochten und formatiert worden wären. Likes, Shares und Kommentare sind längst nicht mehr nur beiläufige Handlungen – sie forcieren und gestalten digitale Kommunikation. Dabei sind Reaktionen mehr als bloße Klicks. In ihnen spiegeln sich Macht, individuelle und kollektive Identität wider.
Die klassischen Arenen politischer und gesellschaftlicher Auseinandersetzung haben sich in den digitalen Raum verlagert: Die Kämpfe um Deutungsmacht – nicht selten als ›Informationskriege‹ bezeichnet – werden heute in Timelines, Kommentarspalten und Chatgruppen ausgetragen. Daran beteiligt sind keinesfalls nur einige wenige Experten aus Politik oder Journalismus – sondern potenziell wir alle. Denn wer likt, teilt oder kommentiert, nimmt aktiv an den Aushandlungsprozessen der digitalen Öffentlichkeit teil. Ob bewusst oder unbewusst – wir User prägen durch unsere Reaktionen die Diskurse unserer Zeit mit. Wie der Autor Friedemann Karig im Kontext terroristischer Bildpropaganda einmal treffend formulierte: »Mit jedem Like, jedem Retweet, jedem sorgenvollen Kommentar bestimmen wir, wie groß der Erfolg der psychologischen Kriegsführung des Terrors ist.«3
Wenn über User gesprochen und geschrieben wird, dominieren häufig zwei extreme Sichtweisen. Auf der einen Seite das Bild der passiven, leicht beeinflussbaren Masse – »ähnlich unterkomplex wie Schwärme oder Horden«:4 Dieses Bild stellt User als empfängliche Konsumenten dar, die willenlos Informationen und Inhalte aufnehmen und durch Algorithmen, Werbung oder Fake News sowie durch emotionale oder reißerische Inhalte leicht gelenkt werden können. Auf der anderen Seite steht die Vorstellung vom manipulativen (Einzel-)Akteur, der gezielt Desinformation verbreitet, um Diskurse zu stören oder zu beeinflussen. In diesem Bild agiert ein User nicht als Teil eines reaktiven, steuerbaren Schwarms, sondern als proaktives Individuum, das gemäß seiner Agenda bewusst Narrative formt und politische Auseinandersetzungen im digitalen Raum vorantreibt.
Diese beiden Bilder prägen viele Debatten um Fake News, Trolle und rechtspopulistische Bewegungen in Sozialen Medien. Doch als kaum zu vereinbarende Extreme verstellen sie den Blick auf die Realität. Die meisten von uns, die tagtäglich ihre Instagram-, X- oder TikTok-Feeds durchforsten oder eigene Inhalte erstellen, würden sich wohl keinem dieser beiden Extreme zuordnen. Wir gewöhnliche User sind weder willenlose Opfer der Algorithmen noch perfide Desinformanten.
Viele Nutzer begegnen Social Media sogar reflektiert und kritisch. Sie stellen Algorithmen infrage, durchschauen Clickbait und erkennen Falschinformationen – manchmal mit spielerischer Leichtigkeit. Eine durchaus solide Medienkompetenz lässt sich zudem leicht an alltäglichem Content erkennen. Formate wie Vorher-Nachher-Bilder, Instagram vs. Real Life-Memes, Filter- und Bearbeitungsanalysen oder Parody-Accounts zeugen von einem relativ aufgeklärten Umgang mit manipulativen Inhalten. Auch die Frage, inwiefern man Algorithmen beeinflussen kann oder nicht, taucht immer wieder in Netzdiskussionen auf.
Dieses Bewusstsein für Manipulation endet jedoch häufig dort, wo es um die eigene Rolle geht. Wie verantwortlich sind wir für das, was wir liken, teilen, kommentieren, interpretieren? Im Bild der passiven User wird deutlich, wann wir es versäumen, Verantwortung zu übernehmen. Im Bild der manipulativen User zeigt sich, wie eine gewisse Verantwortung von vornherein aktiv verweigert wird. Für diejenigen, die sich keinem dieser Typen zugehörig fühlen, stellt sich die Frage nach der eigenen Verantwortlichkeit jedoch kaum – aus meiner Sicht zu Unrecht. Denn nicht nur geldgierige Unternehmen oder machthungrige Parteien, nicht nur PR-Leute, Troll-Armeen oder Bots sind mitverantwortlich für die »Verrohung«5 der Debattenkultur, für die »große Gereiztheit«6 und »Vertrauenskrise«,7 ja für die »polarisierte Gesellschaft«.8 Auch wir User sind es. Mit diesem Befund möchte ich niemandem Schuld zuweisen oder eine Anklageschrift formulieren. Im Gegenteil! Diese Erkenntnis ist nicht nur eine Bürde, sondern auch eine Chance. Denn wer Teil des Problems ist, kann auch Teil der Lösung sein. Auch wenn sich das Setting und die Bedingungen der individuellen Kontrolle entziehen: Wir User sind nicht nur Beobachtende, sondern agieren durch unsere Reaktionen gestaltend – manchmal, ohne es zu merken, manchmal bewusst, ja strategisch.
Soziale Medien sind zu einem Kampfplatz um die Deutungshoheit geworden. Das mag sich heftig anhören, aber es beschreibt das Verhalten vieler im Netz doch sehr treffend. Ob es um die Bewertung aktueller Kriegsgeschehnisse, den »richtigen« Feminismus oder neueste Lifestyle-Trends geht – jede Debatte wird durch Reaktionen weitergetrieben oder abgewürgt. Wenn Elon Musk Fake News mit seinen mehr als 200 Millionen Followern teilt, die ihm wiederum nacheifern und seine Inhalte durch ihre Reaktionen unterstützen und weitertragen, wird Bullshit zum Volkssport.
Diese Dynamik ist es, die ich im ersten Teil des Buches untersuche. Ich möchte zeigen, wie sich in der Reaktionskultur Diskurse formen und warum Missverständnisse, Misstrauen und Empörung zu festen Bestandteilen der digitalen Öffentlichkeit geworden sind. Warum fühlen sich so viele Menschen permanent getriggert? Weshalb wird jede Nachricht sofort zum Anlass für Positionierung und Gegenpositionierung? Wie kommt es, dass ein einzelner Like zum Karriereende führen kann? Im zweiten Teil widme ich mich der nächsten Eskalationsstufe: einer besonders problematischen Form der Reaktion, die ich Hyperinterpretation nenne.9 Mit Hyperinterpretation bezeichne ich eine Technik, die hermeneutische, forensische und investigative Methoden nachahmt, um Inhalte gezielt zu instrumentalisieren. Wenn Greta Thunbergs Kuscheltier plötzlich als antisemitisches Symbol gedeutet, wenn jede Handbewegung eines Politikers auf versteckte Botschaften hin analysiert, wenn aus einem Werbeplakat eine Verschwörungstheorie konstruiert wird – dann sind das keine harmlosen Missverständnisse mehr. Reaktionen können auf diese Weise zu einer extrem wirksamen Waffe im digitalen Kampf um Deutungsmacht werden.
Hyperinterpretation arbeitet nicht mit Inhalten, sondern gegen sie und beschädigt nicht nur das, was absichtlich falsch interpretiert wird, sondern auch die Werkzeuge der Erkenntnis selbst. Die Grenzen zwischen ernsthafter Analyse und gezielter Verzerrung verschwimmen. Was früher als kritisches Hinterfragen galt, wird heute leicht zur Grundlage von Verschwörungstheorien oder destruktiven Narrativen. Und einmal hyperinterpretierte Inhalte lassen sich selten vollständig rehabilitieren – selbst nachträgliche Richtigstellungen oder Kontextualisierungen haben gegen die emotionalisierende Wirkmacht der ursprünglichen Fehlinterpretation meist keine Chance auf Sichtbarkeit in der öffentlichen Wahrnehmung.
In dieser Atmosphäre wird Misstrauen zum Standardmodus der Rezeption. Nichts darf mehr für sich stehen – jedes Bild, jeder Text, jedes Video wird zum möglichen Schauplatz für Projektionen, Lesarten und Verdachtsmomente. Sosehr die Reaktionskultur Kreativität und »Engagement« fördern kann, ist sie doch zugleich für eine Kultur der permanenten Infragestellung und Gegnerschaft verantwortlich. Während User sich mit oder aufgrund von Hyperinterpretation gegenseitig bekriegen oder Gemeinschaften formieren, untergraben sie unbewusst die Grundlagen einer gemeinsamen Realität. Was entsteht, ist ein perfider Kreislauf: Erst wird alles in Zweifel gezogen, dann werden neue ›Wahrheiten‹ verkauft. Je brüchiger die Bedeutungen werden, desto größer wird der Hunger nach simplifizierenden Lesarten – und desto mehr floriert ein Markt, der genau solche Deutungen anbietet.
Einst hieß es, Werbung erzeuge künstlich Bedürfnisse, um dann Produkte als Lösung zu präsentieren. Heute werden auf Social-Media-Plattformen systematisch Bedeutungsverluste produziert – durch Misstrauen, Zweifel, Skandalisierung –, um im nächsten Schritt genau dort neue Interpretationen, Influencer-Wahrheiten oder Verschwörungserzählungen zu platzieren.
Wie konnte es so weit kommen? Wie lassen sich die Mechanismen dieser neuen Reaktionskultur durchschauen? Und gibt es Wege, von der zerstörerischen Hyperinterpretation wieder zu einer produktiveren Form des digitalen Austauschs zu finden?
Diesen Fragen möchte ich in diesem Buch nachgehen.
IWILLKOMMEN IN DER REAKTIONSKULTUR!
ANTWORT OHNE REDE
Neulich stieß ich bei Instagram auf einen Kommentar, den ich direkt liken musste. Er stand unter einem Reel nach dem »Instagram vs. Real Life«-Muster: Eine junge Frau führt in einer U-Bahn einen viralen Tanz auf. Der erste Teil des Videos zeigt die Szene durch die Linse ihrer Smartphonekamera – perfekt choreografiert, gefilmt und geschnitten. Im zweiten Teil wird die Aufnahmesituation selbst enthüllt: Wir sehen die Creatorin nun aus einem gewissen Abstand und schauen ihr beim Dreh des Videos zu. Der Reiz solcher Reels liegt darin, einen Blick hinter die Fassade der professionell inszenierten Social-Media-Inhalte zu werfen. Und obwohl uns natürlich bewusst ist, dass solche Szenen irgendwo in der realen Welt gedreht werden, ist es doch immer wieder skurril und faszinierend, jemanden in der Öffentlichkeit tanzen zu sehen – nicht für die Menschen in der analogen real life-Situation, sondern allein für die Kamera und die unsichtbare Zuschauermenge im Netz.
Im Kommentarbereich entwickelte sich eine aufschlussreiche Diskussion. Die User zeigten sich begeistert – allerdings nicht so sehr von der Tänzerin, sondern von der Teilnahmslosigkeit der Fahrgäste: Sie heben nicht einmal den Kopf, als Musik und Performance einsetzen; sie bleiben in ihre Smartphones vertieft und verweilen gedanklich ebenfalls im digitalen Raum. Wie ungestört man doch in einer New Yorker U-Bahn Reels drehen kann – ohne neugierige Blicke, ohne genervte Kommentare! Die Erstellerin des Reels kommentierte ihre Euphorie über diese Tatsache mit einer bemerkenswerten Beobachtung, die mich zum Schmunzeln brachte: »Im echten Leben stört sich niemand an sowas. Keiner würde euch negativ bewerten oder beschimpfen. Warum also auf die Online-Kommentare hören? Macht einfach weiter euer Ding!«
Ein erfrischender Appell, der mich an eine umgekehrte Version erinnerte, die zu meiner Jugendzeit galt: »Im Internet stört sich niemand an sowas …« Denn in der Anfangszeit des Internets verhielt es sich genau andersherum: Nicht das »reale Leben« diente als Safe Space, sondern die Netzwelt war der Freiraum, der Ort ohne unmittelbare soziale Kontrolle. Als Teenager der Millennial-Generation waren wir in der Schule ständig Kommentaren über unser Aussehen oder unser Verhalten ausgesetzt. In den frühen Foren und Sozialen Netzwerken hingegen konnten wir unbeschwert sein – zumindest einige von uns. Wie die New Yorker Künstlerin, Schriftstellerin und Kuratorin Legacy Russell es in ihrem Kultbuch Glitch Feminism treffend beschreibt: »Ich war jung: Schwarz, weiblich, feminin, queer. Dieser Druck ließ nie nach, es gab keine Atempause; die Welt um mich herum ließ mich diese Identitätsmerkmale nie vergessen. Doch online konnte ich sein, was immer ich wollte.«1 Das Internet bot einen Raum für Experimente, für spielerische Identitätsentwürfe, für das Austesten sozialer Grenzen. Seitdem hat sich einiges verändert.
Diese frühe Netzkultur übt bis heute eine gewisse Faszination aus. Vor Kurzem schrieb mir eine Followerin auf Instagram: »Bin leider 05er Jahrgang, weswegen ich viele coole Portale wie SchülerVZ gar nicht miterlebt habe … hasse Insta, Snapchat etc. Würde viel lieber das alte Facebook-Feeling mal haben.« Das hat mich zum Nachdenken angeregt – über die Entwicklung, die Soziale Medien in den letzten Jahren genommen haben. Da ich nichts verklären wollte, zögerte ich, darauf zu antworten, dass ich diese Zeit manchmal wirklich vermisse, diese Unbeschwertheit, die mit den noch entstehenden Sozialen Medien verbunden war. Das Ausprobieren, spielerische Vernetzen mit Unbekannten, stets überraschende Surfen durch völlig unerwartete Inhalte (Erinnert sich noch jemand an Tumblr?). Da war noch relativ wenig Politik oder Aktivismus in den alltäglichen Feeds – doch vor allem waren noch nicht dutzende oder hunderte von Kommentaren unter den Postings, und wenn, dann deutlich weniger missgünstige, bösartige, wutentbrannte. Mittlerweile herrscht eine andere Stimmung, die von Unsicherheit, Empörung, Frustration, Angst geprägt ist – auch wenn es natürlich immer wieder herausragende Content-Creatoren, großartige Memes und schlaue TikToks gibt, die man sich vor fünfzehn Jahren in seinen schönsten Träumen nicht hätte vorstellen können.
Im Social Web ist der »Homo narrans zum Turboerzähler« geworden, »der so viele Geschichten wie nie zuvor über sich produzieren kann«,2 haben Samira El Ouassil und Friedemann Karig in ihrem Buch Erzählende Affen geschrieben. Doch dieser »Homo narrans« bleibt nicht bei bloßen Selbsterzählungen. Mehr denn je und selbstbewusster denn je arbeitet er auch an den kulturellen, gesellschaftlichen oder politischen kleineren und größeren Erzählungen der Gegenwart mit. Die Macht über prägende Narrative liegt längst nicht mehr bloß bei einigen wenigen in entsprechenden Gatekeeper-Positionen. Jeder kann theoretisch an ihnen mitwirken – und das hat nicht nur zu einer Demokratisierung geführt, gleichermaßen ist zu beobachten, wie diese Macht aus verschiedenen Gründen und zu verschiedenen Zwecken missbraucht wird. Die damit verbundene aktive Mitgestaltung von Diskursen erfolgt dabei seltener durch das eigene Erzählen, sondern in den meisten Fällen durch konstruktive oder destruktive Reaktionen auf bereits Bestehendes.3
»Rede ohne Antwort«,4 so hat Jean Baudrillard die Massenmedien des 20. Jahrhunderts beschrieben. Gemeint war eine Form der Kommunikation, die keine Rückkopplung zulässt – linear, einseitig, von oben nach unten. Die Zuschauer konsumieren, bleiben passiv, sie interagieren nicht. Kommunikation, so seine Diagnose, ist in dieser Medienarchitektur strukturell ausgeschlossen. Die Sozialen Medien waren dazu der große Gegenentwurf: Endlich war Antwort möglich! Jeder konnte reagieren, kommentieren, sich einbringen – scheinbar ein Triumph der Partizipation.
Doch was als vermeintlicher Befreiungsschlag begann, hat sich in sein Gegenteil verkehrt. Die heutige Online-Kommunikation lässt sich als Antwort ohne Rede beschreiben – eine Kultur, in der Inhalte »un-freezable«,5 nicht festzuhalten sind und hinter der Lawine ihrer Reaktionen verschwinden, ja die durch ihre Rezeption regelrecht entkernt werden, während die Antworten darauf ein Eigenleben entwickeln. Sie ersetzen das, worauf sie ursprünglich reagiert haben, und werden selbst zum neuen Gegenstand der Aufmerksamkeit. Die ursprüngliche »Rede« – ein Video, ein Text, ein Bild – wird zur reinen Projektionsfläche, zur Auslösevorrichtung. Was gesagt wurde, spielt kaum mehr eine Rolle. Es zählt nur noch, dass etwas gesagt wurde – damit man endlich reagieren kann.
GET FEEDBACK OR IT DIDN’T HAPPEN
Viele Menschen sammeln etwas – einige sehr ernsthaft und systematisch, andere eher intuitiv. Oft hängt das davon ab, was gesammelt wird. Ich sammle Screenshots. Wo andere Briefmarken, Münzen oder Vintage-Platten anhäufen, archiviere ich digitale Momentaufnahmen: einen absurden Kommentar, ein virales Meme, eine bizarre Diskussion. Schon lange. Die Motive haben sich mit den Jahren stark verändert. Kein Wunder, schließlich haben sich auch Benutzeroberflächen, Designs und Inhalte unserer digitalen Geräte gewandelt. Ich habe zum Beispiel Miley Cyrus’ 420-Weed-Phase auf Instagram dokumentarisch festgehalten. Und es gab mal diese Livestreaming-Plattform namens Periscope: Ich habe unzählige Screenshots von US-amerikanischen Selbstdarstellern, die singen, tanzen oder einfach reden – in ihren Betten, Autos, auf der Straße oder im Kindergarten. Heute ist das natürlich nichts Besonderes mehr. Heute gibt es ja TikTok.
Meine Sammlungen aus jüngerer Zeit stammen überwiegend von Instagram. Sie sind für mich ein anschauliches Archiv einer zunehmend politisierten Plattform. Besonders faszinieren mich Storys, in denen sich Nutzer für ihre Posts rechtfertigen. Irgendjemand – vielleicht auch mehrere Follower oder zufällig Rezipierende – hat Anstoß genommen: an einer unbedachten Formulierung, einer vermeintlich problematischen Haltung, einer übersehenen Sensibilität. Nun gibt es Klärungsbedarf. Diese Storys nehmen zu. Anfangs entschuldigend, sachlich, heute eher als Statement: »Ich habe folgende Kommentare erhalten, hier erkläre ich, warum sie unberechtigt sind!«
Dabei sind Storys eines der wenigen Formate im Social Web, bei denen Kommentare nicht für Außenstehende sichtbar sind. Wer eine Story postet, könnte negative Reaktionen also einfach ignorieren – niemand außer den Beteiligten würde davon erfahren. Doch genau das geschieht oft nicht. Stattdessen wird proaktiv geklärt, richtiggestellt und verteidigt. Diese ständige Selbstverteidigung ließe sich natürlich erstmal damit erklären, dass man sich in der Gegenwart anderer beobachtet und dadurch objektiviert fühlt – das Selbstbild wird schließlich durch den Blick von außen geformt. Die Rechtfertigung im digitalen Raum kann insofern als Versuch gelesen werden, das Bild, das sich andere von einem machen, aktiv zu gestalten. Solche Rechtfertigungs-Storys sind somit zunächst einmal ein Ausdruck des Wunsches, die Kontrolle über die eigene Identität beziehungsweise die eigenen Selbsterzählungen zu bewahren. Im Rechtfertigungsdruck zeigt sich aber ebenso, wie exponiert und verletzlich sich User online fühlen, wie hoch der soziale Druck ist, wie spannungsgeladen zwischenmenschliche Beziehungen, wie groß die Sorge, nicht akzeptiert zu werden, und welche emotionalen Herausforderungen der digitale Alltag mit sich bringt. Hinzu kommt: Wer viel von sich preisgibt und aktiv am Online-Diskurs teilnimmt, sieht sich einer permanenten Erwartungshaltung ausgesetzt. Und zwar nicht nur selbst Inhalte zu produzieren, sondern auch auf jede Reaktion einzugehen, jeden Kommentar zu würdigen, jede Kritik zu adressieren. Niemand bleibt von negativen Rückmeldungen unberührt – ob öffentlich oder privat.
Dieser Rechtfertigungsdruck hat durch Soziale Medien enorm zugenommen. Nie war es einfacher, Meinungen und Entscheidungen vor großem Publikum zu teilen. Viele User sind zu semi-öffentlichen Personen geworden.6 Doch noch entscheidender für den Anstieg dieses Drucks scheint mir die Möglichkeit zu sein, permanent sofortiges Feedback zu geben und zu erhalten. Dieses Feedback, das in vordigitalen Zeiten meistens dosiert verteilt wurde, ist im Social Web regelrecht zur Grundlage einer jeden digitalen Existenz geworden: Get Feedback or it didn’t happen.
Ursprünglich stammt der Begriff Feedback aus der Regelungstechnik. Er bezeichnet dort einen Mechanismus, bei dem das Ergebnis einer Aktion auf ihren Ausgang zurückgeführt wird, um zukünftige Aktionen anzupassen. Betrachtet man Feedback online als entscheidenden Faktor für Entwicklungen verschiedenster Art – wie es mittlerweile in vielen Bereichen der Fall ist –, hat man es zunächst mit einem positiven Mechanismus zu tun. Durch zahlreiche Feedbacks wird so viel und so schnell gelernt wie selten zuvor. Natürlich gibt es auch die gegenteilige Perspektive, dass die menschliche Intelligenz bedroht sei, weil Wissen und Fähigkeiten zunehmend von digitalen Geräten übernommen werden7 – die Rede ist von »digitaler Amnesie« oder »Google-Effekt«.8 Doch die Fähigkeit zu lernen hat nicht nachgelassen – im Gegenteil: Die Allgegenwart von Feedbacks in Form von Likes, Kommentaren, Bewertungen oder Reaktionen hat eine gewisse Form des Lernens enorm beschleunigt. Das zeigt sich besonders deutlich in der Entwicklung von Diskursen: Argumente werden aufgrund von Echtzeit-Feedback rasch angepasst, entkräftet, verworfen oder neu formuliert. Allerdings spielt die Qualität des Feedbacks nicht immer eine Rolle. So kann es passieren, dass Menschen etwas verinnerlichen, das bei näherer Betrachtung gar nicht wert gewesen wäre, gelernt zu werden. Etwa wenn sie Gesundheitstipps von Influencern übernehmen, nur weil diese viral gehen und positives Feedback erhalten – obwohl sie medizinisch fragwürdig sind. Oder wenn sie glauben, komplexe politische Zusammenhänge durch vereinfachende Memes begriffen zu haben, oder wissenschaftliche Erkenntnisse über knackige Infokacheln verinnerlichen, die bei genauerer Prüfung grob verkürzt oder sogar falsch sind. Feedback ist also nicht nur positiv – es kann Lernprozesse auch verzerren.
Feedback ist unabhängig von seinem Inhalt eine grundlegende und treibende Kraft im Social Web, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Auf technischer Ebene bestimmt Feedback, was Algorithmen für Nutzer sichtbar und unsichtbar werden lassen: Jeder Like, jeder Kommentar, jede Verweildauer wird gemessen und fließt in komplexe Berechnungen ein, die entscheiden, welche Inhalte bei wie vielen Nutzern auftauchen. Die Plattformen sind darauf programmiert, jene Inhalte zu bevorzugen, die viel »Engagement« erzeugen (ein euphemistischer Begriff für alles, was User dazu bringt, zu klicken, zu tippen, zu reagieren) – unabhängig davon, ob dieses »Engagement« positiv oder negativ ist. Ein empörender Post, der hunderte wütende Kommentare provoziert, wird vom Algorithmus als »erfolgreich« eingestuft und entsprechend weiterverbreitet. Auch von Künstlicher Intelligenz gesteuerte Systeme und maschinelles Lernen hängen fundamental von diesen Feedback-Schleifen ab: Sie lernen aus den Reaktionen der User, was ›funktioniert‹, und optimieren ihre Empfehlungen entsprechend. Diese technische Logik hat weitreichende Folgen: Sie belohnt nicht Qualität oder Wahrheit, sondern Reaktionstauglichkeit. Inhalte, die starke Emotionen auslösen – Empörung, Angst, Begeisterung –, werden systematisch bevorzugt, während nuancierte, ausgewogene Beiträge in der Versenkung verschwinden.
Auf wirtschaftlicher Ebene nutzen Unternehmen und Organisationen diese Feedback-Daten, um Entscheidungen zu treffen, Trends vorherzusagen und Strategien anzupassen. Sie analysieren, welche Produktankündigungen viral gehen, welche Werbekampagnen Shitstorms auslösen, welche Influencer-Kooperationen die meisten Reaktionen generieren. Für die Plattformen selbst sind diese Daten wiederum ebenfalls eine Währung: Je mehr Reaktionen ein Inhalt erzeugt, desto länger bleiben User online, desto mehr Werbung können sie ihnen zeigen, desto höher sind ihre Einnahmen. Das erklärt, warum Algorithmen systematisch auf »Engagement« optimiert sind – nicht auf schwer messbare Werte wie Wahrheit, Qualität oder gesellschaftlichen Nutzen.
Und als kulturelle Kraft beeinflussen und prägen Feedbacks die Kommunikation, die Inhaltsproduktion und nicht zuletzt die Gemeinschaftsbildung. Feedbacks gestalten die Art und Weise, wie Individuen und Kollektive interagieren, Werte teilen und Kultur online gestalten. Auch was als wünschenswert oder akzeptabel angesehen wird, ist von Feedbacks in Form von Likes, Kommentaren und Shares beeinflusst. Positive Rückmeldungen verstärken bestimmte Verhaltensweisen, negative Reaktionen schwächen sie ab. Auf diese Weise werden soziales Verhalten und kultureller Content unterstützt oder sanktioniert. Nicht zuletzt ist der vielfach naserümpfend kritisierte, in der Influencer- und Selfiekultur vermeintlich vorherrschende Narzissmus im Netz ein performativer Nebeneffekt solcher Feedbackmechanismen. Je mehr Gesicht im Bild oder Video, desto mehr Likes, desto mehr Reichweite, desto mehr Anerkennung, desto mehr Selbstbewusstsein. So spielen diese Mechanismen auch bei der digitalen Identitätsbildung eine große Rolle und beeinflussen somit das Selbstbild und die Selbstwertgefühle enorm – auch in real life (IRL). Da die meisten Menschen im Netz selbst Erfahrungen mit den genannten Feedback-Mechanismen machen, sind sie sich deren Bedeutung und Kraft durchaus bewusst und setzen sie als Werkzeug ein – mal intuitiv, mal strategisch.
Denn umgekehrt transportiert jedes Feedback auch eine Haltung: Zustimmung, Distanz, Solidarität, Empörung. Feedback ist nicht nur auf Inhalte bezogen, es ist ebenso sehr Ausdrucksmedium. Wer Feedback gibt, sagt auch: Ich habe gesehen, ich lehne das ab, ich gehöre dazu, ich durchschaue das. Feedbacks sind verkürzte Formen der Selbstauskunft, Mini-Selbstdarstellungen, Kleinstinterventionen: flüchtig, aber nicht folgenlos.
Die technischen Systeme des Feedbacks haben sich so zu sozialen Systemen entwickelt, die unsere Online-Kommunikation fundamental prägen. Sie haben eine neue Form der digitalen Sozialität geschaffen, in der das Geben und Empfangen von Feedback nicht mehr optional, sondern zur Grundbedingung der Teilhabe geworden ist.
DIE REAKTIONSKULTUR DER SOZIALEN MEDIEN
Ich habe die manchmal lästige Eigenschaft, in Memes, Reels oder TikToks zu denken. Da erscheint plötzlich die »Confused Lady« vor meinem inneren Auge, wenn ich etwas nicht verstehe; oder Homer Simpson, wie er langsam in der Hecke verschwindet, wenn mich etwas schrecklich verlegen macht. Vor Kurzem habe ich mir vorgestellt, wie es wäre, wenn man sich im echten Leben genauso verhielte wie online. Aus dieser Vorstellung wurde schnell eine konkrete Idee für einen TikTok-Channel mit dem Leitmotiv: permanent auf alles reagieren!
Ein Video dieses Kanals könnte etwa so aussehen: Erst startet der Song »Love You So« von The King Khan & BBQ Show. Ich laufe über die Straße, bleibe vor einem Obstbaum stehen, deute darauf und sage beiläufig: »Like!« Schnitt. An der Kreuzung kommt mir jemand entgegen – »Outfit 6/10, Make-up 10/10!« Schnitt. Zwei Fremde unterhalten sich, und natürlich mische ich mich ein, unterbreche sie und weiß irgendetwas so richtig nervig besser. Schnitt. Ein Frühlingsblümchen bekommt von mir zwei süße Fingerherzchen. Schnitt. Dann drehe ich mich um und sehe gepumpte Andrew-Tate-Jünger, die einer Frau hinterherpfeifen. Schnitt. Ich reagiere, indem ich mein Gesicht zum Munch’schen Schrei verziehe. The End.
Dieses TikTok – und bestimmt findet man in den Tiefen der Sozialen Medien längst ein ähnliches – würde perfekt illustrieren, wie allgegenwärtig und prägend Feedback in der Digitalkultur geworden ist. Sind Kommentare nicht von Anfang an das heimliche Herzstück Sozialer Medien gewesen? War es nicht gerade die Möglichkeit, jederzeit zu reagieren und zu interagieren, die einst als Verheißung einer demokratisierten Kommunikation galt? Die Evolution dieser Feedback-Kultur lässt sich gut nachzeichnen: Zunächst fristeten Kommentare ein unauffälliges Dasein am unteren Rand langer, umständlicher Blogbeiträge.9 Doch bald schon waren sie das eigentliche Highlight – man denke an die legendären Kommentare-Kommentier-Videos des Comedytrios Y-Titty oder die gleichnamige Adaption von Jan Böhmermann in den frühen Tagen des Neo Magazin Royale bis hin zu den Promis, die negative Kommentare über sich selbst bei Jimmy Kimmel vorlasen. Die Kontrolle über die Rezeption ihrer Videos oder Blogposts, die Creatoren im und durch den Kommentarbereich verloren hatten, versuchten sie durch geschickte Aneignung – vor allem von Nonsens- oder Hasskommentaren – zurückzugewinnen. Es ging darum, die Deutungshoheit wiederzuerlangen, damit Kommentare wie »Ey dis Wideo is foll schwuuuul!!!«10 nicht das letzte Wort behielten – so cute war Hatespeech noch im Jahr 2010, gepostet unter ein Video des damaligen Lieblings-YouTubers LeFloid (genau, der, der Angela Merkel interviewen durfte).
Die Kommentarspalten unter YouTube-Videos oder Online-Artikeln wie denen auf Spiegel Online waren in gewisser Weise die Vorläufer für heutige Grabenkämpfe in den Sozialen Medien. Auch hier versammelten sich, der sogenannten »Netiquette« zum Trotz, bereits zunehmend unsachliche und provozierende Kommentare – von Verschwörungstheorien bis hin zu persönlichen Beleidigungen. Die Redaktionen sahen sich irgendwann in der Rolle von Schiedsrichtern, die zwischen demokratischem Dialog und digitalem Mob moderieren mussten. Viele Medien zogen schließlich die Reißleine, schalteten die Kommentarfunktion ganz ab oder versteckten sie auf den Websites zusehends – ein erster Hinweis darauf, dass das Versprechen der partizipativen Kommunikation nicht unbedingt zu besseren Diskursen führte.
Bereits die frühen, oft dilettantisch produzierten Kommentare- Kommentiervideos offenbarten ein charakteristisches Muster: Ihre Creatoren strebten zwar nach möglichst vielen Likes und Kommentaren, empfanden negative Rückmeldungen aber als zutiefst kränkend. Sie fühlten sich unverstanden oder missverstanden; der respektlose und unverblümte Umgang einzelner Kommentierer hinterließ sichtlich Spuren. Man sah YouTubern förmlich an, wie sehr sie unter böswilligen Kommentaren litten – trotz aller Bemühungen, cool und distanziert zu wirken. Manche entwickelten elaborierte Strategien, um mit dem Hass umzugehen: Sie lasen die schlimmsten Kommentare ironisch vor, machten sich über die schlechte Rechtschreibung der Trolle lustig oder appellierten direkt an ihre Community, sie zu verteidigen. Auf Instagram schrieben sich Frauen die Hasskommentare auf ihren Körper oder einen Spiegel, um die Texte zu verbildlichen und ihre Autonomie zurückzugewinnen.11 Doch diese Bewältigungsstrategien zeigten zugleich, wie mächtig die Kommentarspalten bereits geworden waren. Creatoren, die eigentlich die Kontrolle über ihre Inhalte haben sollten, sahen sich gezwungen, auf jeden zweifelhaften Kommentar zu reagieren.
Was einst individuelle Kränkungen waren, ist heute ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Denn mittlerweile ist praktisch jeder, der sich digital äußert, mit ähnlichen Dynamiken konfrontiert. Der Druck, auf Kritik zu reagieren, das Gefühl, permanent erklären zu müssen, was man gesagt oder geteilt hat, die Angst vor Missverständnissen – das beschränkt sich längst nicht mehr auf Content Creatoren mit hunderttausenden Followern. Auch Personen mit überschaubarer Reichweite kennen das mulmige Gefühl, wenn ein harmloses Posting plötzlich kritische Reaktionen auslöst. Lehrer fürchten um ihre Reputation, wenn Schüler ihre privaten Social-Media-Profile durchforsten. Angestellte überlegen dreimal, bevor sie politische Meinungen teilen, aus Angst vor beruflichen Konsequenzen. Die emotionale Verletzlichkeit, die früher Privileg und Bürde von Prominenten war, ist zur Grunderfahrung digitaler Teilhabe geworden.
Es geht bei Feedback also häufig um Emotionen. Wenn Feedbacks im Spiel sind, dann werden Gefühle wie Scham, Angst, Druck zu einer echten Herausforderung. Daher empfinde ich die Rede von Feedback an dieser Stelle auch als irreführend. Der Feedback-Begriff gewinnt leicht den Anschein, dass es sich dabei um etwas Konstruktives handelt. Zu stark assoziiert man damit eine vermeintlich sachliche Rückmeldung, die gegenseitige und gemeinschaftliche Weiterentwicklung forciert. Doch viele Phänomene, die heute unter Feedback fallen – von unbedachten Likes bis hin zu verschwörungstheoretischen Reaction- Videos –, sind alles andere als konstruktiv. Deshalb bevorzuge ich den Begriff der Reaktionen. Er trägt die emotionale Komponente in sich, die Feedbacks oft überhaupt erst auslösen. Am liebsten würde ich sogar den englischen Begriff Reaction verwenden, da er sich gewissermaßen als Genrebegriff (zum Beispiel sogenannte Reaction-Videos) etabliert hat und dementsprechend auch eine Formgebung, eine Gestaltung der Emotionen beinhaltet.