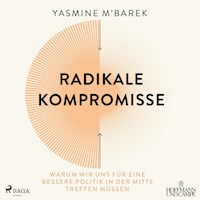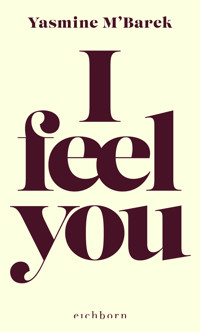
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Empathie gilt als höchste Kunst des Miteinanders. Trotzdem scheint sie der gegenwärtigen Debattenkultur abhanden gekommen zu sein. Im digitalen survival of the fittest beschäftigen sich alle mit allem, vorrangig jedoch mit sich selbst. Meinungen werden absolut, Zwischentöne unmöglich.
Warum wir wieder lernen müssen, empathisch zu sein - oder zumindest mehr empathische Egoisten brauchen -, erzählt Yasmine M’Barek in I FEEL YOU. Von relatable content auf Instagram über den Zusammenhang von Empathie und Kapitalismus bis zum Tod der Kritik: Mit Schärfe, Humor und analytischer Klarheit plädiert Yasmine M’Barek für ein gesellschaftliches Wiederentdecken der Empathie - politisch, privat und popkulturell.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber die AutorinÜber dieses BuchTitelImpressumWidmungZitatVorwortKapitel 1TextanfangKapitel 2TextanfangKapitel 3TextanfangKapitel 4TextanfangKapitel 5TextanfangDanksagungLiteraturAnmerkungen und QuellenÜber dieses Buch
Empathie gilt als höchste Kunst des Miteinanders. Trotzdem scheint sie der gegenwärtigen Debattenkultur abhanden gekommen zu sein. Im digitalen survival of the fittest beschäftigen sich alle mit allem, vorrangig jedoch mit sich selbst. Meinungen werden absolut, Zwischentöne unmöglich.
Warum wir wieder lernen müssen, empathisch zu sein – oder zumindest mehr empathische Egoisten brauchen –, erzählt Yasmine M’Barek in I FEEL YOU. Von relatable content auf Instagram über den Zusammenhang von Empathie und Kapitalismus bis zum Tod der Kritik: Mit Schärfe, Humor und analytischer Klarheit plädiert Yasmine M’Barek für ein gesellschaftliches Wiederentdecken der Empathie – politisch, privat und popkulturell.
Über die Autorin
Yasmine M’Barek, geboren 1999, ist Journalistin, Podcasterin und Autorin. Sie hat die Kölner Journalistenschule besucht und ist Redakteurin bei ZEIT Online. Regelmäßig ist sie in politischen Talkshows zu Gast und hostet den ZEIT-Podcast Ehrlich jetzt. Yasmine M’Barek lebt in Köln und Berlin.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag
Originalausgabe
Copyright © 2025 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten. Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Umschlaggestaltung: Kristin Pang
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-8389-7
eichborn.de
FürLéon, Eva,Noah, Angela, Samir,Alicem, Britt-Marie
»For me forgiveness and compassion are always linked: how do we hold people accountable for wrongdoing and yet at the same time remain in touch with their humanity enough to believe in their capacity to be transformed?«
bell hooks im Gespräch mit Maya Angelou
»Love has never been a popular movement. And no one has ever wanted, really, to be free. The world is held together … by the love and passion of a very few people. Otherwise, of course, you can despair. You can walk down the street of any city … and look around you. What you’ve got to remember is what you’re looking at is also you … You could be that monster, you could be that cop. And you’ve got to decide in yourself not to be.«
James Baldwin in Meeting the Man
Vorwort
Es ist wahnsinnig selbstgerecht, über Empathie zu schreiben, weil man sich dann anmaßt, halbwegs zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Man denkt dann ja vermutlich auch, dass man empathisch sei. Das ist immer eine 50/50-Chance, dass das tatsächlich so ist und man sich nicht nur selbst darstellt. Es ist ein wenig verblendet und zeugt vielleicht auch von Naivität. Das hier ist kein Appell, sondern ein unterschwelliger Dauerbeweis, wie schön Empathie ist, wenn man ihr eben nicht verblendet entgegensteht, voller Erwartung und Gutgläubigkeit. Die empathische Haltung ist nicht die Lösung, sondern der Anfang. Halten sich Autoren für unglaublich reflektiert und sind dauernd in der wehleidigen Auseinandersetzung mit sich selbst, sind Ich-bezogene Essays bestimmt das Richtige dafür. Ich möchte mich selbst ermahnen, diese Grundhaltung der Empathie beizubehalten. Auch wenn es nach 513-mal-gelikter LinkedIn-Kachel klingt: Empathie fängt schon bei einem selbst an. Wenn James Baldwin sagt, dass die Welt durch die Liebe von wenigen Menschen zusammengehalten wird, dann glaube ich, dass dazu vor allem auch die willigen Empathen zählen, die nicht damit aufhören, verstehen zu wollen. Empathie ist liebevoll, weil sie uns als Menschen nicht aufgibt. bell hooks schreibt: »Wir alle sehnen uns nach einem Ende der Lieblosigkeit, die in unserer Gesellschaft immer weiter um sich greift.«1 Der Versuch, empathisch zu sein, ist gleichzeitig auch der Versuch, Menschen zu lieben. Nicht etwa, weil ich großer Verfechter davon bin, diese durchaus anstrengende Spezies so lange wie möglich auf der Erde zu halten und zu zelebrieren. Aber der Gedanke an die Gemeinschaft, an das empathische Miteinander, an (selbst gewählte) Familie und Freunde, an das Gesehenwerden – das halte ich für erstrebenswert. Natürlich darf man dabei den Spaß nicht vergessen und die Lust daran, das Unmoralische zu tun. Genauso verstehen sich auch diese Essays. Sie erzählen von Bitches und dem Bösen, feiern das Lästern und das Kritisieren und vergessen dabei nie die Empathie. Ich hoffentlich auch nicht, wenn mich der nächste Hate-Kommentar erreicht.
xoxo
Kapitel 1
Die Yogabitch
»Definitions are vital starting points for the imagination. What we cannot imagine cannot come into being.«1
bell hooks, All About Love
Das Yogastudio sieht ästhetisch und clean aus. Auch die Besucher des Studios fügen sich nahtlos in dieses Bild ein. Outfits in Beige, Grau und Schwarz, identische Stanley Cups, Lammfell-Slipper von UGG oder Salomon-Sneaker in Lachsfarben, die sich wie Legosteine im Eingangsbereich sammeln. Wir alle sind gemeinsam im generischen Ruheraum des Kapitalismus. Ein Ort, an dem man in der Großstadt Frieden und Selbstachtung finden soll. Ich stehe auf der Matte, der Kurs beginnt in drei Minuten. Immer wieder ziehe ich meine Leggings zurecht, weil sie nie richtig sitzt und gezuppelt werden muss. Und da sehe ich sie. Prüfend schaut sie in den Spiegel. Streicht sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht, zupft ihren Sport-BH zurecht, dessen Gummiband sich immer wieder verdreht. Die stereotypische Yogabitch. Ihr Blick schweift von oben nach unten, irgendwann nicht mehr an ihrem eigenen Körper entlang, sondern an meinem. Unsere Blicke treffen sich, sie schaut verächtlich – denke ich zumindest –, dann kommt die Trainerin. Zeit für den herabschauenden Hund. Namaste! Bloß nicht vergessen, mir und allen anderen Liebe zu schenken. Das ist natürlich eine Selbsttäuschung, ein Absolutismus, der mit der Lebensrealität nicht weniger zu tun haben könnte. Beim Yoga soll man bei sich sein, sich selbst Zeit schenken und sich von äußeren Einflüssen befreien. Genau das ist nur fünf Minuten zuvor weder der Yogabitch noch mir gelungen, als ich mir insgeheim gewünscht habe, dass der mich musternden Frau alles Schlechte der Welt widerfahren solle.
Es geht natürlich nicht um DIE Yogabitch. Ihr Auftreten in der freien Wildbahn ist selbstverständlich wesentlich vielschichtiger, als das hier den Anschein haben mag. Sie muss herhalten, in ihrer popkulturellen Signifikanz. Denn jeder kennt eine Yogabitch, eine Person, die man einfach scheiße findet, für die man am liebsten nichts übrig haben möchte, die aber trotzdem so viel mit uns selbst macht. Und vielleicht lohnt es sich, genau diesem Gefühl nachzugehen. Kann man in dieser Situation vielleicht nicht nur Empathie für mich empfinden – also für die Person, die angestarrt wird –, sondern vielleicht auch nachsichtig mit der Yogabitch sein? In dieser ganz konkreten Situation im Yogastudio wäre es mit etwas Muße möglich zu erkennen: Vielleicht interpretiert man einfach zu viel rein, in den Blick der Yogabitch. Möglicherweise hat man lediglich Probleme mit sich selbst und seiner Wahrnehmung. Oder die Yogabitch war einfach unsicher und ihr Blick gar nicht bewusst abschätzend gemeint. Das ist selbst in einer Welt voller Selbstoptimierer und Perfektionisten denkbar. Dann wäre sie auch gar keine Bitch mehr, sondern einfach eine Frau, die auch im Yogakurs war. Ein bisschen lost, aber sicherlich nicht bösartig, und komplexer als ein zweisekündiger Blick zu entschlüsseln vermag. Was kann es also konkret bedeuten, Empathie mit der Yogabitch zu haben?
Ich würde sagen, dass es am schwersten fällt, Empathie für Menschen aufzubringen, die für uns desirable sind; die erstrebenswerte Eigenschaften haben, aber gleichzeitig unnahbar bleiben und uns das Gefühl vermitteln, ihnen unterlegen zu sein. Vielleicht sind sie schöner, erfolgreicher, normaler – und fallen dadurch in der Mehrheitsgesellschaft weniger auf. Allein die sprachliche Herabwürdigung, die in dem Begriff Yogabitch steckt, lässt tief blicken. Denn ich unterstelle meinem Gegenüber in meiner moralischen Erhöhung eine Verfehlung, nämlich: Sie ist die Böse. Ich sehe, dass sie mich herabwürdigt, und kategorisiere sie deshalb als Bitch. Indem ich hier dennoch dafür plädiere, ihre Perspektive zu verstehen – how open-minded of me –, beweise ich umso mehr, dass ich ihr überlegen bin. Denn ich würde ja niemals jemanden so anschauen (wirklich?), nie der Versuchung erliegen, mich am Anblick anderer zu ergötzen (sicher?). Schon gar nicht am Anblick der Yogabitch. (Der Kapitalismus hat uns nämlich gelehrt: Sie gilt in der Perspektive der westlichen Gesellschaft als besser, entspricht stets den klassischen Schönheitsidealen und ist eben niemand, den die Normgesellschaft anzugucken hat – außer vielleicht, um ihre perfekten Wangenknochen und die in Raten abbezahlte Bottega-Veneta-Tasche zu bewundern.) Und gerade, weil ich im Gegensatz zur Yogabitch der Verlockung widerstehe, die andere Frau kritisch zu begutachten, bin letztendlich ich die Gute. Auch das wurde uns immer schon beigebracht: Die Verbitterten, die moralisch Unterlegenen, sind immer die Bösen. Insbesondere, wenn ihnen vermeintlich gutes, moralisch »richtiges« Verhalten gegenübergestellt wird. Und was sich dabei auch zeigt: Bodypositivity hin oder her, in dem Moment wo es moralisch und inhaltlich hässlich wird, reduzieren wir Menschen immer auf ihr Aussehen oder ihre Makel. So wie im Disneyfilm Cinderella.
In Cinderella (ich spreche natürlich vom echten Disneyfilm aus dem Jahr 1950) hat die Protagonistin das Glück – beziehungsweise die gute Fee – auf ihrer Seite. Cinderella wird nach dem Tod ihres Vaters von der bösen Stiefmutter und den Stiefschwestern Anastasia und Drizella ausgebeutet und seelisch missbraucht. Dabei ist sie doch eigentlich diejenige, der das Haus mitsamt all den singenden Tieren erblich zusteht. Cinderella ist den anderen Frauen überlegen und wird beneidet. Sie ist normschön und besitzt damit – anders als ihre Stiefschwestern – ein Kapital, das im Kapitalismus immer zieht: den eigenen Körper. Normsozialisiert, wie die meisten von uns sind, verurteilen wir Ausbeutung und Missbrauch und schlagen uns auf die Seite von Cinderella. Weil sie schön ist und lieb und alles, was wir von ihrem Leben sehen, schlecht zu sein scheint. Unter der Prämisse, dass die Stiefschwestern also Böses tun, weil sie sich gegen die gute Cinderella stellen, zeichnet der Film – genau wie die Gesellschaft – das grässliche Feindbild: Die Stiefschwestern sind nicht einfach nur Menschen, die fies zu Cinderella sind. Sie sind dödelig, hochnäsig, unattraktiv und zu nichts zu gebrauchen – und schon gar nicht zu bemitleiden. Aber ihr Verhalten ist nicht völlig motivationslos.
Als eines Tages ein Brief aus dem Schloss des Königs ankommt, ist Cinderella überglücklich: Alle Mädchen im Lande sind zu einem Ball eingeladen, um sich dort dem Prinzen vorzustellen. Dafür braucht es natürlich ein neues Kleid. Cinderella ist die Mother of Camp und beeinflusst bis heute die Modeszene. 2019 etwa führte die Schauspielerin Zendaya bei der Met Gala, die in jenem Jahr unter dem Motto Camp stand, eine Hommage auf Cinderellas Brautkleid vor. Im Film findet Cinderella ein passendes Schnittmuster, aber bei all der Hausarbeit, die ihr die Stiefmutter aufdrückt, einfach keine Zeit, um zu nähen. Doch zum Glück kommen ihr Mäuse und Vögel zu Hilfe und legen Pfote und Flügel an, um einen rosa Traum aus Perlen und Schleifen zu erschaffen. Vor Neid ganz blass zerfetzen die Stiefschwestern Cinderellas Kleid. Sie selbst tragen, wie ich finde, eigentlich ganz geile trashige Designs in pink und einer türkis-grün Kombination, die aber eben nicht dem zärtlich-femininen, pastelligen Moodboard der Disneynarrative entsprechen. Ganz im Gegensatz zu dem legendären blauen Kleid, das die gute Fee der völlig aufgelösten Cinderella herbeizaubert und in dem sie schlussendlich doch zum Ball fahren kann.
Ich sage nicht, dass es richtig von den Stiefschwestern ist, Cinderellas Ballkleid zu zerstören. Doch was, wenn es sich dabei einfach nur um den letzten Versuch handelt, nicht völlig in der Bedeutungslosigkeit des eigenen Lebens unterzugehen? Die Stiefschwestern wissen um ihre Irrelevanz, sie wissen, dass sie ihr Glück im Gegensatz zur vermeintlich schöneren, überlegenen Cinderella nicht in einer Hochzeit und den damit verbundenen finanziellen Benefits finden können. Sie wissen um den Unmut der eigenen Mutter, die mithilfe von Klavierstunden und pompöser Kleidung zwanghaft versucht, irgendein Potenzial aus ihren beiden Töchtern herauszukitzeln, irgendetwas zu finden, was ihnen im normativen schönen Leben Halt und Sinn geben kann.
Dieser Perspektivwechsel lohnt sich auch mit Blick auf die böse Stiefmutter selbst, die als alleinerziehende Mutter zwei Mädchen durchbringen musste. Auch ihr hat sicherlich schon mal irgendjemand wahnsinnig wehgetan. Doch wie den Stiefschwestern fehlt ihr die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Sie überträgt ihr Unglück auf eine andere Person, über die sie Macht ausüben kann: auf Cinderella. Lady Tremaine (legendärer Name übrigens) ist sich des Kapitals ihrer schönen Stieftochter bewusst und stiftet ihre beiden Kinder (die von ihr im Übrigen genauso niederträchtig behandelt werden wie Cinderella) dazu an, das Kleid zu zerstören. Kein Wunder, dass die beiden Stiefschwestern die Ablehnung, die sie von ihrer eigenen Mutter erfahren, auf Cinderella projizieren. Sie haben es nicht anders gelernt. Die Stiefmutter vielleicht auch nicht. Übertragen auf die Yogabitch: Hat sie eine narzisstische Mutter? Oder vielleicht gar keine? Ist sie ohne Eltern aufgewachsen? War sie auf dem Internat? Hat ihr Vater sie mit Sprüchen über ihren Körper in die Essstörung getrieben? Irgendeinen Grund wird ihr Blick haben.
In Anbetracht solcher Beobachtungen und Projektionen könnte man sagen: Die Leute sind immer weniger empathisch. Empathie mit anderen zu haben, bedeutet, eben nicht die Art von Bitterkeit auszustrahlen, die man seinem Gegenüber umgekehrt übelnehmen würde. Und es bedeutet, die Probleme der anderen in Betracht zu ziehen, in dem Maße, in dem man sich selbst Verständnis für die eigene Situation erhofft. Die anderen müssen meine Probleme nicht für mich lösen. Aber außerhalb der eigenen Eindimensionalität, der individuellen starren Wahrnehmung zu denken, ist sicherlich ein Anfang. Natürlich bin ich nicht so naiv, davon auszugehen, dass die Welt ein ganz harmonischer Ort wird, wenn wir nur fest daran glauben. Im Gegenteil: Ich fürchte, besser wird der Bumms hier nicht mehr. Aber wenn man das Leben eh einfach ertragen muss, kann zumindest im Umgang mit dem Gegenüber Hoffnung entstehen, dass ein anderes Miteinander möglich ist.
Auch wenn es den weitaus weniger spannenden Plot liefert, wäre es doch zumindest ein Anfang gewesen, wenn Cinderella einfach mal in die Trickkiste der Tiefenpsychologie gegriffen hätte, um dem Verhalten der Stiefschwestern auf den Grund zu gehen. Behandelt ihr mich vielleicht nur so schäbig, weil ihr euch selbst so schlecht fühlt? Das ist nämlich auch für Vierjährige verständlich, hört, hört. Genauso wäre es ein erster Schritt gewesen, im Yogastudio einfach mal ins Gespräch zu kommen, ganz direkt zu fragen: »Gibt’s was? Alles okay?« Aber nicht passiv-aggressiv, ich meine das hier schon aufrichtig. Denn vielleicht hat die Yogabitch gar nicht gemerkt, dass sie so geschaut hat. Oder ihr wird durch die Nachfrage überhaupt erst bewusst, dass ihre Attitüde von anderen nicht toleriert wird. Vielleicht erzählt sie ihrem Therapeuten dann endlich mal die Wahrheit darüber, weshalb sie in der anonymen Großstadt keine Freunde findet.