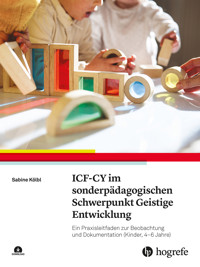
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Strukturiertes Konzept zur Beobachtung von Vorschulkindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf Deutschlandweit gibt es Einrichtungen, die Kinder im sonderpädagogischem Schwer-punkt Geistige Entwicklung im Kindergartenalter betreuen. Neben inklusiven Angeboten sind häufig an Förderzentren mit dem entsprechenden Förderschwerpunkt vorschulische Gruppen angegliedert, die von multiprofessionellen Teams betreut werden. Die individuelle Beobachtung und Diagnostik des einzelnen Kindes, um eine Förderplanung erstellen zu können, ist in einigen Bundesländern gesetzlich vorgesehen. Um den Entwicklungsstand der Kinder beschreiben und Förderziele formulieren zu können, ist das pädagogische Personal auf Beobachtungen angewiesen, die es in der Arbeit mit den Kindern macht. Dieser Leitfaden bietet ein grafisch aufbereitetes und didaktisch strukturiertes Konzept zur Beobachtung von Kindern (4–6 Jahre) im sonderpädagogischem Schwerpunkt Geistige Entwicklung. Ausgehend von einer theoretischen Fundierung zu den Bereichen ICF-CY, Beobachtung und Förderplanung wird das Beobachtungskonzept praxisnah dargestellt. Die Beobachtungsbögen sind im Buch integriert und können als Zusatzmaterial heruntergeladen werden. Die konkrete Umsetzbarkeit der hier benutzten Bögen wurde im Rahmen einer Promotionsarbeit einer explorativen Evaluation mit großer Zustimmung unterzogen. Dieses Buch richtet sich an pädagogisches Personal der elementaren Bildungseinrichtungen in inklusiven Settings oder sonderpädagogischen Vorschuleinrichtungen, ohne testtheoretische Ausbildung (z. B. Erzieher*innen; Kinderpfleger*innen; Heilpädago-gische Förderlehrer*innen).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sabine Kölbl
ICF-CY im sonderpädagogischen Schwerpunkt Geistige Entwicklung
Ein Praxisleitfaden zur Beobachtung und Dokumentation (Kinder, 4–6 Jahre)
ICF-CY im sonderpädagogischen Schwerpunkt Geistige Entwicklung
Sabine Kölbl
Dr. Sabine Kölbl
Universität Regensburg
Fakultät für Humanwissenschaften
Lehrstuhl für Pädagogik bei geistiger Behinderung einschließlich inklusiver Pädagogik
Sedanstraße 1
93055 Regensburg
Deutschland
E-Mail: [email protected]
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
All rights, including for text and data mining (TDM), Artificial Intelligence (AI) training, and similar technologies, are reserved.
Alle Rechte, auch für Text- und Data-Mining (TDM), Training für künstliche Intelligenz (KI) und ähnliche Technologien, sind vorbehalten.
Verantwortliche Person in der EU: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Merkelstraße 3, 37085 Göttingen, [email protected]
Anregungen und Zuschriften bitte an den Hersteller:
Hogrefe AG
Lektorat Gesundheit
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Susanne Ristea
Bearbeitung: Elisabeth Dominik, Allendorf
Herstellung: René Tschirren
Umschlagabbildung: Getty Images/Lourdes Balduque
Umschlaggestaltung: Hogrefe AG, Bern
Illustration (Innenteil): Eva Poxleitner, Ringelai
Satz: Claudia Wild, Konstanz
Format: EPUB
1. Auflage 2025
© 2025 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96252-8)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76252-4)
ISBN 978-3-456-86252-1
https://doi.org/10.1024/86252-000
Nutzungsbedingungen
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Geleitwort
Danke für die Unterstützung
Zum Praxisleitfaden
Teil I Theoretische Grundlagen
1 Einleitung
2 Die ICF-CY
2.1 Entstehung der ICF-CY
2.2 Das bio-psycho-soziale Modell und die Funktionsfähigkeit
2.3 Aufbau der ICF-CY
2.4 Bedeutung für den sonderpädagogischen Bereich und Kritik
3 Beobachtung im pädagogischen Alltag
3.1 Einführung
3.2 Merkmale diagnostischer Beobachtung
3.3 Verschiedene Beobachtungsarten
3.4 Fehlerquellen beim Beobachten und Möglichkeiten, diese abzumildern
3.4.1 Beobachtungs- und Bewertungsfehler, die durch die Person des Beobachters verursacht sind
3.4.2 Beobachtungs- und Bewertungsfehler, die in der Situation liegen
3.4.3 Beobachtungs- und Bewertungsfehler, die in der Person des Beobachteten verortet sind
3.4.4 Wie können Beobachtungs- und Bewertungsfehler abgemildert werden?
3.5 Beobachtungen dokumentieren
3.6 Exemplarische Beobachtungssysteme für den sonderpädagogischen Schwerpunkt GE
4 Individuelle Förderplanung
4.1 Einführung
4.2 Der Weg und das Ziel: „Förderplanung“ und „Förderplan“
4.3 Aufbau eines Förderplans
4.3.1 Ausgangssituation, Entwicklungsstand, Ist-Stand
4.3.2 Förderziele und -maßnahmen
4.3.3 Evaluation
5 Partizipation – eine sonderpädagogische Leitidee
5.1 Partizipation – zum Begriff
5.2 Partizipation (Teilhabe) in der ICF-CY
Zusammenfassung Teil I
Teil II Die Beobachtungsbögen – Inhalt und Aufbau
6 Grundlage der Beobachtungsbögen in der ICF-CY
6.1 Aktivitäten und Teilhabe
6.2 Aktivitäten und Teilhabe in den ICF-CY-Checklisten
7 Vorstellung der Beobachtungsbögen
7.1 Bogen zur ersten Beobachtungsphase
7.1.1 Theoretischer Bezug
7.1.2 Aufbau und Inhalt
7.2 Bögen zur zweiten Beobachtungsphase: Aufbau
7.2.1 Theoretischer Bezug
7.2.2 Aufbau der Vorderseite der Bögen der zweiten Beobachtungsphase
7.2.3 Aufbau der Rückseite der Bögen der zweiten Beobachtungsphase
7.3 Bögen zur zweiten Beobachtungsphase: Inhalte
7.3.1 Lernen und Wissensanwendung
7.3.2 Allgemeine Aufgaben und Anforderungen
7.3.3 Kommunikation als Sender
7.3.4 Kommunikation als Empfänger
7.3.5 Mobilität
7.3.6 Selbstversorgung
7.3.7 Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen; Häusliches Leben
7.3.8 Bedeutende Lebensbereiche
Teil III Anwendung der Beobachtungsbögen
8 Nötige Vorbereitungen und Ressourcen
9 Beobachtungsphasen
9.1 Erste Phase: einen Überblick verschaffen
9.1.1 Ziel
9.1.2 Theoretische Fundierung
9.1.3 Start und Verlauf der ersten Phase
9.1.4 Ende der ersten Phase
9.2 Zweite Phase: einzelne Bereiche genauer beobachten
9.2.1 Ziel
9.2.2 Theoretische Fundierung
9.2.3 Start und Verlauf der zweiten Phase
9.2.4 Ende der zweiten Phase
10 Von den Beobachtungen zu den Förderzielen
10.1 SMARTe Ziele
10.2 Förderziele formulieren
10.3 Kinder einbeziehen
10.3.1 … bei der Findung der Förderziele
10.3.2 … bei der Bewertung des Fortschritts
11 Mögliche Störmomente und Vorschläge zur Behebung
11.1 Die Zeit beim Beobachten wird zu knapp bzw. das Beobachtungssystem ist zu umfangreich
11.2 Die personelle Decke ist zu dünn
11.3 Unbehagen, „die Kinder“ würden kodiert werden
11.4 Die Förderzielformulierung fällt schwer
11.5 Das Beobachtungssystem „passt“ nicht auf einzelne Kinder
12 Fallbeispiel
12.1 Die Einrichtung
12.2 Die Gruppe
12.3 Das Team
12.4 Das Kind
12.5 Die erste Beobachtungsphase
12.5.1 Vorbereitungen
12.5.2 Beobachtungen der ersten Woche
12.5.3 Nachbesprechung
12.6 Die zweite Beobachtungsphase
12.6.1 Vorbereitungen
12.6.2 Beobachtungen der zweiten Woche
12.6.3 Besprechung der Förderziele
Anhang
Checklisten und Bögen: Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung
Hinweise zu Zusatzmaterialien
Kurzvita der Autorin
Sachwortverzeichnis
|9|Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie haben eine Lesereise durch einen kompakten Theorieteil (Teil I) vor sich, werden sich eine Vielzahl an Inhalten der ICF-CY (Teil II) erarbeiten und dann die Zusammenführung aller vorher erarbeiteten Informationen in einem praktischen Teil (Teil III) nachvollziehen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihrer pädagogischen Beobachtungspraxis, Geduld und Freude am Neuen! Wenn Sie zurechtkommen und die ICF-Ideen verinnerlicht haben, wagen Sie unter Umständen einen nächsten Schritt und beziehen die Erziehungsberechtigten auch im Vorfeld der Förderplanung verstärkt ein. So könnte der Blick noch intensiver auf die Rolle der Umweltfaktoren gerichtet werden und die Erziehungspartnerschaft vielleicht Impulse für die Förderung liefern. Das Thema Beobachtung und Förderplanung ist ein herausforderndes und anspruchsvolles, vermutlich wird es das auch immer bleiben. Zu wenig ist die Arbeit mit Kindern schematisch planbar, zu schnell verändern sich Rahmenbedingungen. Mit Ihrer Bereitschaft, sich auf das Thema überhaupt in der Tiefe einzulassen, tragen Sie aber sicher einen Teil dazu bei, dass Kinder und ihr Recht auf Teilhabe wahrgenommen und unterstützt werden.
Vielen Dank an Sie und Ihr Engagement!
Sabine Kölbl, Dezember 2024
|11|Geleitwort
Beobachtung und Dokumentation von Verhalten sowie die anschließende Förderplanung stellen eine wichtige Grundlage der pädagogischen Begleitung und Förderung von Kindern im Elementarbereich dar. Nimmt man den Elementarbereich im sonderpädagogischen Schwerpunkt Geistige Entwicklung in den Blick, so ist zu konstatieren, dass für diesen Bereich bislang keine praxistauglichen Instrumente zur Beobachtung und Förderplanung durch Personal ohne testpsychologische Ausbildung vorliegen, obwohl diese Personengruppe in dem Bereich dominiert. Hier setzt die Publikation von Frau Dr. Kölbl an, die ausgehend von ihrer Dissertationsschrift den vorliegenden Praxisleitfaden zur Beobachtung und Dokumentation auf Grundlage der ICF-CY im sonderpädagogischen Schwerpunkt Geistige Behinderung (4–6 Jahre) entwickelt hat. Dieses Vorhaben sieht sich gleich mehreren herausfordernden Rahmenbedingungen gegenüber:
Die ICF bzw. die ICF-CY nehmen seit ihrer Einführung im Jahr 2005 bzw. 2011 (in deutscher Sprache) in der sozial- und bildungspolitischen Diskussion in Deutschland immer breiteren Raum ein. Während die Klassifikationen in theoretisch-konzeptionellen Zusammenhängen wertvolle Impulse setzen konnten und sich das bio-psycho-soziale Modell von Behinderung zu einem Standard entwickelt hat, finden sich bisher nur wenige Implementationen und praxistaugliche Anwendungsformen.
Der Elementarbereich im sonderpädagogischen Schwerpunkt Geistige Entwicklung ist ein bis dato von der Forschung kaum beachtetes Praxisfeld. Dort verantworten überwiegend nicht universitär ausgebildete (Fach-)Kräfte die pädagogische Arbeit, was weitreichende Implikationen für die Förderdiagnostik und Förderplanung hat. So hat diese Personengruppe im Gegensatz zu Lehrkräften für Sonderpädagogik keine testpsychologische Ausbildung und damit keine Möglichkeit, den Entwicklungsstand eines Kindes durch Entwicklungstests festzustellen. Nichtsdestotrotz gehört die individuelle Förderplanung zu ihren Aufgaben, womit der Aspekt der Beobachtung und Dokumentation in den Fokus rückt. Für den sonderpädagogischen Schwerpunkt Geistige Entwicklung finden sich dabei nur vereinzelte Verfahren, die durch ungeschultes Personal über Beobachtungen angewendet werden können.
Zudem stellt sich im Kontext Förderdiagnostik und Förderplanung die Frage der Bezugsnorm als zentrale Herausforderung. Während diagnostische Materialien für den sogenannten Regelbereich allesamt mit interindividuellen Bezugsnormen arbeiten, stellen diese für den sonderpädagogischen Schwerpunkt Geistige Entwicklung keine Hilfe, sondern im Gegenteil sogar eine starke Begrenzung dar. Dies liegt in den zum Teil sehr starken Abweichungen bzw. Einschränkungen auf Seiten der Kinder begründet, da die zu beobachtenden bzw. einzuschätzenden Skills oder Fähigkeiten zum Teil nicht im messbaren bzw. beobachtbaren Bereich liegen. Daher gilt es im sonderpädagogischen Schwerpunkt Geistige Entwicklung, möglichst mit einer intraindividuellen Bezugsnorm zu arbeiten. Hierzu liegen bislang kaum Verfahren vor.
Diese herausfordernden Rahmenbedingungen greift der Praxisleitfaden von Frau Dr. Kölbl auf. Ausgehend von ihrer langjährigen Erfahrung im Elementarbereich des sonderpädagogischen Schwerpunkts Geistige Entwicklung konzipiert sie auf der Grundlage der ICF-CY ein Beobachtungs- und Dokumentationsinstrument mit intraindividueller Bezugsnorm im Hinblick auf die Förderplanung im sonderpädagogischen Schwerpunkt Geistige Entwicklung. Dabei stehen für sie die Aspekte der Praxistauglichkeit bzw. Usability durchgängig im Vordergrund.
Ich freue mich sehr, dass Frau Dr. Kölbl ausgehend von ihrer Dissertationsschrift, die ich betreuen durfte, diesen Praxisleitfaden entwickelt hat. Mit einem kompetenten und konsequenten Blick auf die Praxis bietet er eine wichtige Hilfestellung bei der pädagogischen Begleitung und Förderung von Kindern im sonderpädagogischen Schwerpunkt Geistige Entwicklung im Elementarbereich.
Prof. Dr. Wolfgang Dworschak
Dezember 2024
Regensburg
|13|Danke für die Unterstützung
Professor Markus Scholz, Danke für alles!
Danke an Professor Wolfgang Dworschak für die Ideen bei der Entwicklung der Bögen, die Betreuung während der Promotion und das Geleitwort.
Danke an Judith und alle Kolleginnen und Kollegen, die im Elementarbereich arbeiten.
Und das, bzw. die Beste zum Schluss … Danke an Eva Poxleitner, für die Umsetzung der Tesa-Bleistift-Kritzeleien in Beobachtungsbögen!
|15|Zum Praxisleitfaden
Für wen dieses Buch geschrieben wurde
Dieses Buch wurde geschrieben, um die Praktikerinnen und Praktiker bei der Beobachtung der ihnen anvertrauten Kinder zu unterstützen. Wenn Sie also als Erzieherin oder Erzieher, Kinderpflegerin oder Kinderpfleger, Sonderpädagogische Fachkraft oder Ähnliches arbeiten und in Ihrer Wirkungsstätte Kinder mit Intelligenzminderung betreuen, dann sind Sie die Zielgruppe dieses Praxisleitfadens.
Der Arbeitsalltag lässt nicht immer genügend Platz für die Einarbeitung in neue theoretische Konzepte, gleichzeitig bringen Sie durch Ihre Ausbildung reichhaltiges Wissen mit und verfügen wahrscheinlich bereits über eine gewisse Berufserfahrung. Hier soll Sie dieses Buch abholen. Die theoretischen Grundlagen sind verständlich und knapp erläutert, sodass Sie mit Ihrem Vorwissen gut anknüpfen können. Die Inhalte sind im besten Fall für alle Teammitglieder von Interesse, Sie können sich also hier mit Ihrem Team gemeinsam die theoretischen Grundlagen aneignen. Viel Raum erhält die praktische Anwendung des Beobachtungsbogens. Aus eigener Erfahrung und der langjährigen Arbeit mit Kindern mit Intelligenzminderung heraus habe ich versucht, das Beobachtungsverfahren so praxistauglich wie möglich zu gestalten, sodass Sie und die Kinder schnell davon profitieren können. Die Betonung der Praktikabilität und der Arbeit mit vier- bis sechsjährigen Kindern lässt andere Aspekte in den Hintergrund rücken. So werden Forschende die Tiefe und Breite der fachwissenschaftlichen Ausführungen vermissen, wie sie im universitären Kontext üblich sind. Mitarbeitende der interdisziplinären Frühförderung, die oft mit Kindern im Eins-zu-Eins-Setting arbeiten, erwarten unter Umständen von einem Beobachtungssystem einen höheren Differenzierungsgrad. Diese Beispiele verdeutlichen, dass das vor Ihnen liegende Buch kein Alleskönner ist und das auch nicht zu sein vorgibt. Aber es hilft hoffentlich, in Gruppen der Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) oder in inklusiven Kindertagesstätten (Kitas) Kinder mit (vermuteter) Intelligenzminderung zu beobachten, ihre Entwicklung einzuschätzen und daraus Förderziele zu formulieren.
Warum die Beobachtungsbögen entwickelt wurden
Im vorschulischen Alter, somit im Alter von vier bis sechs Jahren, ist vieles in Bewegung in der kindlichen Entwicklung. Nicht immer liegt schon eine ärztliche Diagnose vor, die eine Intelligenzminderung festschreibt. Oft liest man die Ausdrücke Entwicklungsverzögerung bzw. Entwicklungsstörung in medizinischen Dokumenten, die unter Umständen aber im Lauf der Zeit zu anderen, genaueren Diagnosen umkodiert werden. Diese Kinder eint, dass sie zum momentanen Zeitpunkt von einer altersentsprechenden Entwicklung negativ abweichen; ihre jetzigen Fähigkeiten entsprechen also in einem oder mehreren Bereichen nicht denen, wie sie der Großteil der Gleichaltrigen vorweist.
Ergänzende Informationen
Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren haben häufig noch keine ärztliche Diagnose, die den medizinischen Hintergrund der Entwicklungsstörung erklärt. Es stellt sich die Frage, wie die Kinder, die hier als Zielgruppe der Beobachteten angesprochen sind, begrifflich gefasst werden können. Der Ausdruck „sonderpädagogischer Schwerpunkt Geistige Entwicklung“ ist der Sonderpädagogik entnommen, genauer den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK, 2021). Die Begriffe „Intelligenzminderung“ und „Entwicklungsstörung“ haben eine medizinisch-psychologische Konnotation, sie entstammen der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision“, ICD-101 (https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-10-GM/_node.html).
Viele weitere Begriffe finden in der Fachliteratur Verwendung: „Kinder mit schwerster Beeinträchtigung“ (Schäfer et al., 2022), Kinder mit „geistiger Behinderung“ (Speck, 2018) oder Kinder mit „zugeschriebener geistiger Behinderung“ (Schuppener, Schlichting, Goldbach & Hauser, 2021) und viele mehr. Da das Feld, |16|in dem die Beobachtungen und Förderung stattfinden, ein pädagogisches ist, wird in diesem Buch der Begriff des sonderpädagogischen Schwerpunkts Geistige Entwicklung verwendet, um die Zielgruppe zu beschreiben – wohl wissend, dass die Festlegung dieses Schwerpunkts unter Umständen noch nicht erfolgte zum Zeitpunkt der Beobachtung. Der Begriff stellt eine Art Hilfskonstrukt dar, um die Personengruppe zu verdeutlichen und bringt verschiedenste (sonder)pädagogische Implikationen mit sich, von einer lebenslangen Entwicklungsfähigkeit bis hin zu individueller Förderung. Bitte achten Sie bei der pädagogischen Begleitung darauf, die Entwicklungsoffenheit eines Kindes weiterhin nicht aus den Augen zu verlieren, auch wenn es zuvor und auch in diesem Buch mit einem sonderpädagogischen Schwerpunkt belegt wurde. „Entwicklung ist ein Prozess mit unendlich vielen Freiheitsgraden“ (Oerter, 1987, S. 15) und es soll ergänzt werden: lebenslang.
Gleichzeitig ist der Großteil der erhältlichen Beobachtungshilfen eher auf eben die Kinder ausgerichtet, deren Entwicklung ohne besondere Verzögerungen verläuft. Oder die Beobachtungshilfen sind darauf angelegt, Abweichungen vom Mittelwert, also Entwicklungsverzögerungen oder -störungen zu finden, um daraus Hilfemaßnahmen abzuleiten. Diese Verfahren haben ihren Wert und bringen oft großen Nutzen, indem Kindern frühzeitig geeignete Fördermaßnahmen angeboten werden, um Rückstände so vielleicht kompensieren zu können. Zugleich sind aber manche Kinder mit diesen Verfahren schwer erfassbar, ihr Entwicklungsprofil ist so weit unterhalb des Mittelwerts angesiedelt, dass die Aussagekraft für die individuelle Förderung gering ist. Das kann dreifach frustrieren:
die Beobachtenden, die die Entwicklung des Kindes durchgängig negativ beurteilen müssen,
die Eltern, die die grafische Darstellung dieses (weit) unterdurchschnittlichen Kompetenzprofils sehen und oft eine analoge Darstellung der individuellen Stärken ihres Kindes vermissen,
und das Kind selbst, wenn inadäquate Förderziele angelegt werden, die sich am Großteil der Kinder orientieren, aber nicht an dem betreffenden Kind.
Eine intraindividuelle Bewertung der Entwicklung, also ausschließlich in Bezug auf das Kind selbst und die Fortschritte, die das Kind macht, ohne Vergleich mit den Gleichaltrigen, könnte hier Entspannung bringen und den Blick für das einzelne Kind wieder öffnen.
Intraindividuelle Bewertung
Intraindividuell meint hier, dass die Entwicklungsfortschritte eines Kindes nur an seinem eigenen Entwicklungsverlauf gemessen werden. Der Vergleich bezieht sich also nur auf das Stärken- und Schwächen-Profil des einzelnen Kindes, ohne diese Stärken und Schwächen in Beziehung zu anderen Kindern oder einer erwartungsgemäßen Entwicklung zu setzen.
Es gibt gute Beobachtungsverfahren, die Teilbereiche der Entwicklung fokussieren oder speziell Kinder mit schwersten Beeinträchtigungen (Kap. 3.6). Das Ihnen vorliegende Beobachtungsverfahren versucht, mehrere Entwicklungsaspekte zu beschreiben und soll für alle Kinder anwendbar sein. Das bedeutet, es beurteilt die Entwicklung voraussetzungsfrei und intraindividuell. Zugleich bedient es sich eines theoretischen Rahmens, der global Anwendung findet und medizinische, therapeutische und (sonder)pädagogische Blicke auf die Lebenssituation eines Kindes erlaubt: die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen ICF-CY (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2022). Das macht es zu einem für Sie hoffentlich attraktiven Angebot. Gleichzeitig soll aber auch klar formuliert werden, wo die Grenzen dieses Praxisleitfadens liegen.
Was dieses Buch kann – und was nicht
Dieses Buch kann Ihnen und Ihrem Team eine Hilfe sein, die (entwicklungsverzögerten) Kinder Ihrer SVE- oder Kitagruppe strukturiert zu beobachten und aufgrund der beobachtungsbasierten Beschreibung der individuellen Entwicklung geeignete Förderziele zu formulieren. Der Beobachtungsbogen wurde in einer kleinen, explorativen Studie (Kölbl, 2021) von wenigen Gruppen eingesetzt, ihre Erfahrungen und Anregungen daraus wurden in das Ihnen nun vorliegende Buch eingearbeitet. Werte dazu, inwieweit die verschiedenen Beobachtenden in ihren Urteilen übereinstimmen (Interrater-Reliabilität) finden sich aber beispielsweise nicht. Das kann zu Ungenauigkeiten und Verzerrungen im Ergebnis führen. Es handelt sich also nicht um ein standardisiertes und normiertes Verfahren, das den hohen Anforderungen eines Testverfahrens im psychometrischen Sinn genügt. Daher ist dieses Beobachtungsverfahren nicht geeignet, um einen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf festzustellen. Aus Ihren Beobachtungsnotizen lassen sich |17|keine Aussagen dazu treffen, ob und inwieweit die Entwicklung des Kindes altersgerecht verläuft. Sollten Sie den kleinen Beitrag dieses Praxisleitfadens zu einer systematischen Beobachtung dennoch schätzen und sich für die entsprechenden theoretischen Grundlagen interessieren, stelle ich Ihnen im Folgenden den Aufbau des Buches vor.
Überblick über den Aufbau
Den ersten Teil bilden theoretische Grundlagen rund um die Themen ICF-CY, Beobachtung und Förderplanung. Dieser Teil soll für Sie relevante Hintergründe abbilden, die Ihnen zu einem tieferen Verständnis des Aufbaus und der Durchführung des Beobachtungsverfahrens helfen werden.
Am Ende des ersten Teils finden Sie eine Doppelseite mit einem zusammenfassenden Überblick über die theoretischen Grundlagen, sodass Sie hier noch einmal kompakt das theoretische Wissen vor sich haben, bevor Sie zu Teil II übergehen.
Die Teile II und III sind eng miteinander verknüpft. Während zunächst das Beobachtungsverfahren inhaltlich dargestellt wird (Teil II), folgt anschließend die konkrete Umsetzung in der Gruppe, einschließlich Checklisten zur Vor- und Nachbereitung und der Besprechung möglicherweise auftretender Probleme (Teil III).
Außerdem finden Sie an geeigneten Stellen Hinweise im Buch zu:
Weiterführende Literatur
Interessanten Weblinks2
Zusammenfassungen jeweils am Kapitelende
Ergänzende Informationen mit nützlichen Hinweisen auf vertiefende Aspekte oder weitere Begriffe.
Die jeweiligen Quellen aus der Fachliteratur finden Sie am Ende jedes der drei Buchteile.
Und so sind Sie jetzt herzlich eingeladen, sich auf die theoretischen Grundlagen, auf denen die Konzeption des Beobachtungsverfahrens (Bögen und Durchführung) beruht, einzulassen.
Eine elfte Revision der ICD (ICD-11) existiert schon, war in Deutschland aber zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Praxisleitfadens noch nicht verpflichtend. Deshalb wird hier noch mit der ICD-10 gearbeitet.
Die Links führen auf externe Websites Dritter, auf die Inhalte dieser Websites habe ich keinen Einfluss. Deshalb kann für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernommen werden. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden keine möglichen Rechtsverstöße oder rechtswidrigen Inhalte auf den jeweiligen Seiten gefunden.
|19|Teil I Theoretische Grundlagen
|21|1 Einleitung
Förderdiagnostik – Begriff und diagnostischer Prozess
Beobachtungen machen, dokumentieren und aus ihnen anschließend Förderziele gewinnen, diese tief im pädagogischen Alltag verwurzelten Handlungen sind Ausdrucksweisen eines Verständnisses von Diagnostik als Förderdiagnostik. Die Förderdiagnostik, mit ihren Methoden und Zielen, bildet die Grundlage, auf der der individuelle Entwicklungsstand des Kindes beschrieben werden soll. Sie weist aber über die Beschreibung des momentanen Ist-Zustands hinaus und kann auch Wege einer Weiterentwicklung zeigen.
Was ist Förderdiagnostik?
Überlegen wir kurz, wo uns das Wort Diagnostik im Alltag begegnet. Natürlich in Arztpraxen und -briefen, in Krankenhäusern, aber auch im sonderpädagogischen Setting, z. B. bei der Feststellung des sonderpädagogischen Schwerpunkts Geistige Entwicklung (KMK, 2021, S. 17). Das Wort Diagnostik hat seine Wurzeln im Griechischen und bedeutet in etwa „Unterscheidung, Entscheidung“ (Bundschuh & Winkler, 2019, S. 36). Berufsgruppen, bei denen Diagnostik ein Schwerpunkt der praktischen Arbeit ist, sind unter anderem Medizinerinnen und Mediziner oder Psychologinnen und Psychologen. Sie untersuchen Menschen und entscheiden, wie die berichteten Symptome zu deuten sind, welchem Krankheitsbild sie zugeordnet werden können. Aber auch pädagogische Kräfte diagnostizieren fortlaufend. Die Noten im System der Regelschule beispielweise stellen einen Wert dar, der Auskunft darüber gibt, wie die Lehrkraft die Leistung des Kindes bewertet. Jede Fehleranalyse, die er oder sie beim genauen Auswerten von Schriftstücken der Kinder macht, ist eine Diagnose, die Auskunft auf mögliche Verstehenslücken beim Kind geben kann. Entwicklungsgespräche im Kindergarten bauen auf den Schlüssen auf, die das Team aus den gemachten Beobachtungen und eventuell durchgeführten Screenings (z. B. zur phonologischen Bewusstheit) gezogen hat. Werden im medizinisch-psychologischen Setting an die Erstellung einer Diagnose anschließend zumeist therapeutische Maßnahmen besprochen (Therapieplan), führt im (sonder)pädagogischen Bereich die Diagnose zu der Frage, wie das Kind auf dem weiteren Weg unterstützt und gefördert werden kann(Förderplan).
Zusammenfassung
Förderdiagnostik ist also die Bezeichnung für den Weg und das Ziel der Bemühungen, um das Kind in seiner Entwicklung differenziert zu beschreiben und mögliche Wege der Weiterentwicklung aufzuzeigen und meint „zusammenfassend ein Erkennen und damit Aufzeigen von Ressourcen eines Menschen in Bezug auf ausgewählte Entwicklungsaspekte. Die erhaltenen Erkenntnisse dienen dann im weiteren Verlauf […] einer Interventionsplanung“ (Reichenbach & Thiemann, 2018, S. 34).
Eine differenzierte Beschreibung des Kindes bedeutet, auch die Stärken zu erfassen und nicht einseitig auf etwaige noch nicht erreichte Meilensteine der Entwicklung zu achten. Die Stärken, die Kompetenzen im jetzigen Moment, bilden den Ausgangpunkt für die Entwicklungsmöglichkeiten. Nicht immer verläuft Entwicklung kontinuierlich und in genau festgelegten Schritten. In manchen Fällen verläuft sie beschleunigt oder verlangsamt, jedes Kind ist anders und meistert seine Entwicklung auf einzigartige Weise. In jedem Fall ist es aber wichtig, entwicklungspsychologische Grundannahmen zu kennen, um ausgehend vom jetzigen Können Prognosen für den nächsten Entwicklungsschritt, für die „Zone der nächsten Entwicklung“ („Zone proximaler Entwicklung“) (Vygotskij, Lompscher & Rückriem, 2002, S. 331) zu formulieren (Abbildung 1-1).
Ein Beispiel: das Kind kann sich mit Schwimmflügeln und mithilfe der korrekten Arm- und Beinbewegungen über Wasser halten (Zone der aktuellen Entwicklung). Die Zone der nächsten Entwicklung könnte es sein, die Schwimmhilfen Schritt für Schritt zu entfernen, die Bezugsperson begleitet das Kind dabei und unterstützt es. Der zukünftige Entwicklungsstand wäre dann das selbstständige Schwimmen, ohne Begleitpersonen oder Schwimmhilfen.
Das Ziel der Förderdiagnostik, Wege der Weiterentwicklung aufzuzeigen, kann nur gelingen, wenn das Kind in diese Weiterentwicklung einbezogen wird und die Möglichkeit des Scheiterns bewusst bleibt. Die Förderdiagnostik bietet die Ausgangslage und Hinweise auf mögliche Ziele. Welche Ziele ausgewählt werden und wie und ob sie überhaupt erreicht |22|werden, ist nicht automatisch garantiert und gelingt nur unter Einbezug derjenigen, die den Weg zu gehen haben: der Kinder selbst. So wird ein sehr ängstliches Kind, das sich noch nicht bereit fühlt, auf Schwimmhilfen zu verzichten, weniger Erfolg haben als ein Kind, das von sich aus selbstständig schwimmen lernen möchte, z. B. weil befreundete Kinder das ebenfalls tun.
Abbildung 1-1: Die Zone proximaler Entwicklung (nach Vygotskij, 2002, S. 331).
Welche Methoden nutzt Förderdiagnostik?
Förderdiagnostik nutzt die gleichen Methoden wie die herkömmliche Diagnostik. Diese werden hier kurz erläutert. Um Ihnen eine zeitliche Orientierung zu geben, an welcher Stelle im diagnostischen Prozess sich die vorgestellten Methoden finden, finden Sie hier eine Grafik (Abbildung 1-2).
An erster Stelle steht die Festlegung, welche Frage überhaupt beantwortet werden soll („1“ in Abbildung 1-2). Möchten Sie für Ihre Förderplanung den allgemeinen Entwicklungsstand erheben? In allen Bereichen oder in einem speziellen? Oder möchten Sie wissen, warum das Kind in bestimmten Situationen mit herausfordernden Verhaltensweisen reagiert? Die Formulierung einer genauen Fragestellung bestimmt den weiteren Prozess, der erst beendet ist, wenn die Frage beantwortet werden kann und Ziele und Maßnahmen zur Förderung feststehen.
Bevor die Untersucherin bzw. der Untersucher konkrete Verfahren (z. B. psychologische Tests) anwendet, versucht sie bzw. er zunächst, sich ein Bild im Vorfeld zu machen. Diese „Phase der Vorinformation“(Bundschuh & Winkler, 2019, S. 138) oder Erhebung der „Vorgeschichte“(„2“ in Abbildung 1-2)(Breitenbach, 2021, S. 145) ist wichtig, um den weiteren förderdiagnostischen Prozess so passgenau wie möglich auf das Kind planen zu können. Je genauer und breiter die Informationen sind, die im Vorfeld erhoben werden, desto besser kann bestimmt werden, welche Bereiche der Entwicklung genauer untersucht werden sollen, um die Fragestellung zu beantworten.
Ein Beispiel: das Team hat bemerkt, dass das Kind oft sehr laut ist im Gespräch und immer wieder nicht oder verzögert auf Aufforderungen reagiert. In der Erhebung der Vorgeschichte taucht die Information auf, dass das Kind viel mit Mittelohrentzündungen zu kämpfen hatte und immer wieder operiert werden musste.
Die Anamnese ist zentral in dieser Phase. Sie ist eine Art „diagnostisches Interview“ (Bundschuh & Winkler, 2019, S. 137), das dazu dient, möglichst viele relevante Informationen über das Kind zu sammeln. Im sonderpädagogischen Kontext könnten hier Informationen über die bisherige Entwicklung des Kindes aus Sicht der Eltern von Interesse sein, Vorlieben und Abneigungen des Kindes, soziale Bezugspersonen, Krankheits- und Gesundheitsaspekte (inkl. medizinischen und therapeutischen Aspekten, siehe oben), aber auch bisherige frühpädagogische Erfahrungen.
|23|Weiterführende Literatur
Bundschuh & Winkler führen in ihrem Standardwerk „Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik“ einen Katalog mit möglichen Fragen auf, die die Anamnese zu beantworten versucht (S. 141–144).
Bundschuh, K. & Winkler, C. (2019). Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik. München: Ernst Reinhardt. Crossref
Da im sonderpädagogischen Kontext nicht selten Arztbriefe eine Rolle spielen, wird „Interview“ hier etwas weiter interpretiert und umfasst auch die Sichtung aller relevanten Unterlagen. Neben Arztbriefen könnten das beispielsweise Berichte der Frühförderung sein oder das Untersuchungsheft der Kinderärztin bzw. des Kinderarztes.
Die Anamnese spielt eine zentrale Rolle für den weiteren Verlauf des förderdiagnostischen Prozesses. Auf der Grundlage der hier gewonnenen Informationen kann die Untersucherin bzw. der Untersucher entscheiden, wie weiter vorgegangen wird (Hypothesenbildung und Untersuchungsplanung[„3“ und „4“ in Abbildung 1-2]).
Abbildung 1-2: Der förderdiagnostische Prozess.
Beispiele: Kann das Kind seinem Alter gemäß sprechen? So können (Test-)Verfahren in Betracht gezogen werden, die auf Sprache basieren (im Gegensatz zu non-verbalen Verfahren). Berichten die Eltern von langen „Auftauphasen“ des Kindes gegenüber Unbekannten, ist für das Kennenlernen zum einen ausreichend Zeit einzuplanen und zum anderen besonders auf die Vorlieben des Kindes zu achten, um Zugang zu finden.
Diesen nächsten Schritt im förderdiagnostischen Prozess nennen Bundschuh & Winkler „pädagogische Informationsphase“(„5“ in Abbildung 1-2) (Bundschuh & Winkler, 2019, S. 138). Hier können nun, wie oben erwähnt, spezifische Verfahren eingesetzt werden, um einzelne Entwicklungsbereiche genauer zu untersuchen.
Beispiele: Tests zur Überprüfung der Intelligenz oder – im Bereich der vorschulischen Bildung hoch bedeutsam – Screenings zur phonologischen Bewusstheit. Die Informationen, die hier gewonnen werden, betreffen einen klar abgegrenzten Bereich, der möglichst tief und genau beschrieben wird, z. B. hinsichtlich der Fähigkeit eines Kindes, Anlaute zu hören oder Silben zu segmentieren. Diese Verfahren sind in einer klar umrissenen Form gehalten, der Ablauf ist oft bis hin zu den Gebärden des Untersuchenden festgehalten. Durch diese genaue Festlegung der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung werden diese Verfahren „formelle“ Verfahren genannt.
Sie werden ergänzt durch sogenannte „informelle Verfahren“, zu denen die Verhaltensbeobachtung zählt. Die Beobachtung als informelles Verfahren ist eine wichtige Ergänzung zu formellen Tests und dient |24|als weiteres Puzzlestückchen, das am Ende ein möglichst präzises Bild des kindlichen Entwicklungsstandes gibt. Beobachtung ist (weitgehend) voraussetzungslos möglich und jederzeit einsetzbar, weiter unten wird sie ausführlich theoretisch dargestellt.
In einem sichtenden und interpretierenden Schritt wertet die Testleitung alle Informationen aus und prüft, ob die Fragestellung beantwortet werden kann („6“ in Abbildung 1-2). Sollte das noch nicht gelingen, formuliert sie neue Hypothesen und leitet daraus einen neuen Untersuchungsplan ab. Wenn die Informationsphase (vorläufig) abgeschlossen ist, beginnt der „Förderungsprozess“(„7“ in Abbildung 1-2)(Bundschuh & Winkler, 2019, S. 139). Die Handelnden sind nicht nur die Pädagoginnen bzw. Pädagogen und ihr Team, sondern auch die Erziehungsberechtigten und vor allem das Kind. Auf der Grundlage der Informationen werden gemeinsam (Förder-)Ziele gesucht und Wege dorthin (Fördermaßnahmen) formuliert. Bereits bei diesem Treffen sollte idealerweise auch das nächste Treffen vereinbart werden, bei dem gemeinsam besprochen wird, wie weit fortgeschritten die Förderplanung ist und ob weitere Unterstützung oder Änderungen notwendig sind. Förderplanung ist eine zentrale Säule der (sonder)pädagogischen Arbeit mit Kindern.
Nach dieser (recht ausführlichen) Einleitung zu Förderdiagnostik allgemein geht es nun an den eigentlichen theoretischen Unterbau der Beobachtungsbögen.
Im folgenden Teil, den theoretischen Grundlagen, werden Beobachtung und Förderplanung als pädagogische Kernkompetenzen beschrieben, Qualitätsmerkmale und Problemfelder betrachtet und in der beobachtungsgestützten Formulierung von Förderzielen zusammengeführt.
Zunächst wird aber die ICF prägnant und einfach erklärt, vor allem in Bezug auf Sinnhaftigkeit für die (Sonder-)Pädagogik. Sie dient als Basis für das später vorgestellte Beobachtungsinstrument. Am Ende des Teils I finden Sie eine Doppelseite, auf der das Wichtigste in Kürze zusammengefasst ist.





























