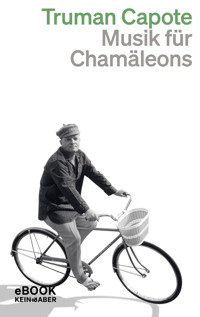12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinen letzten Lebensjahren haben sich Truman Capote und Lawrence Grobel mehrmals getroffen, aus einem ursprünglich geplanten Interview wurde dieses lange intime Gespräch. Funkelnd, scharfzüngig und sehr persönlich erzählt Capote über sein Leben, spricht offen über alltägliche Dinge, über sein Schreiben, seine Probleme mit Drogen und Alkohol, seine Homosexualität. Zudem lässt er sich mit Genuss schonungslos über berühmte Zeitgenossen wie John F. Kennedy, Jacqueline Onassis, Norman Mailer oder Marilyn Monroe aus.
Ein literarisches Zeitdokument und zugleich der unverzichtbare Schlüssel zu Truman Capotes Person und seinem Werk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks des Autors
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Truman Capote wurde am 30. September 1924 in New Orleans geboren. Er wuchs in den Südstaaten auf, bis ihn seine Mutter als Achtjährigen zu sich nach New York holte. 1948 erschien sein Roman Andere Stimmen, andere Räume, der als das sensationelle Debüt eines literarischen Wunderkindes gefeiert wurde. 1949 folgte eine Sammlung erster Kurzgeschichten unter dem Titel Baum der Nacht, 1950 die Reisebeschreibung Lokalkolorit, 1951 der Roman Die Grasharfe. Das 1958 veröffentlichte Frühstück bei Tiffany erlangte auch dank der Verfilmung mit Audrey Hepburn große Berühmtheit. 1965 erschien der mehrmals verfilmte Tatsachenroman Kaltblütig, 1973 Die Hunde bellen, 1980 Musik für Chamäleons. Postum wurden 1987 – unvollendet – Erhörte Gebete und 2005 das wiederentdeckte Debüt Sommerdiebe veröffentlicht. Bei Kein & Aber erscheint das Gesamtwerk des Autors, zuletzt Wo die Welt anfängt, seine frühesten Erzählungen. Truman Capote starb am 25. August 1984 in Los Angeles.
ÜBER DAS BUCH
In seinen letzten Lebensjahren haben sich Truman Capote und Lawrence Grobel mehrmals getroffen, aus einem ursprünglich geplanten Interview wurde dieses lange intime Gespräch. Funkelnd, scharfzüngig und sehr persönlich erzählt Capote über sein Leben, spricht offen über alltägliche Dinge, über sein Schreiben, seine Probleme mit Drogen und Alkohol, seine Homosexualität. Zudem lässt er sich mit Genuss schonungslos über berühmte Zeitgenossen wie John F. Kennedy, Jacqueline Onassis, Norman Mailer oder Marilyn Monroe aus.
Ein literarisches Zeitdokument und zugleich der unverzichtbare Schlüssel zu Truman Capotes Person und seinem Werk.
Für Truman,der seine Bleistifte spitzteund keine Angst hatte
Grobel: Glauben Sie, dass Konversation Literatur sein kann?Capote: Nein, aber sie kann eine Kunst sein.
VORWORT
von James A. Michener
Truman Capote war für Schriftsteller wie mich von ungeheurer Bedeutung, denn er übernahm eine notwendige Rolle in der amerikanischen Literatur – eine Rolle, von der wir profitierten, die aber selbst auszuüben wir nicht geschaffen waren.
England hat schon immer Raum für den wahrhaft skandalösen Exzentriker geboten und gab daher für den ungebärdigen Iren Oscar Wilde eine glänzende Bühne ab, von der herab dieser der Welt, von den Londoner Salons bis in die Bergarbeiter-Camps von Colorado, ein extravagantes Schauspiel gab.
Jean Cocteau, den großen französischen Maler-Dichter-Schauspieler-Poseur, habe ich nie kennengelernt, doch in den Jahren nach 1900, als der unsägliche Oscar Wilde starb, wurde Cocteau zu dem Künstler im Blickpunkt, einem, der sich in der Kunst des Epater les bourgeois gefiel, der Kunst, dem Bürger der Mittelschicht eins auf die Schnauze zu hauen. Extravagant in seiner körperlichen Erscheinung, exhibitionistisch mit Absicht, überschwänglich in Wort und Tat, dazu ein überragender Künstler in jedem Medium, gemahnte er, wo immer er wollte, die Welt unaufhörlich daran, dass Künstler anders sind und dass ihr Wert überwiegend in der Tatsache gründet, dass sie sich, verdammt, genau so aufführen, wie es ihnen gefällt. Cocteau hat Generationen von wohlanständigen Franzosen, Engländern und Deutschen bezaubert, verwirrt und brüskiert, stets zum Ergötzen der wachen Welt und zur Bereicherung der Freunde der Kunst und des spektakulären Schauspiels. Eitle und selbstgerechte Gemeinwesen profitieren davon, dass es Männer wie Jean Cocteau und Oscar Wilde gibt, die ihnen auf die Hacken treten. Man muss sie daran erinnern, dass Künstler manchmal schockierend widerborstig sind, dass sie unpopuläre Anliegen verfechten, dass sie sich auf eine Art und Weise benehmen, die für andere undenkbar wäre, und dass sie manchmal spitze Zungen haben. Ich hatte immer schon den starken Verdacht, dass solche Künstler mithelfen, die Gesellschaft in Ordnung zu halten, wachsam und auf dem Sprung, und zivilisierter, als sie es sonst wäre.
Zu meiner Zeit hatten wir in Amerika drei solche Männer – Norman Mailer, Gore Vidal und Truman Capote, und deren Beiträge an das Leben unseres Landes sind von unschätzbarem Wert. Lassen Sie es mich verdeutlichen und Ihnen erzählen, was vor etlichen Jahren innerhalb von nur fünf Tagen geschah. Zuerst verdrosch Norman Mailer Gore Vidal in New York – in einem öffentlichen Literaturkrawall, der es auf die Titelseiten schaffte. Am nächsten Tag gab John Gardner, würdige Ergänzung des Schrecklichen Trios, der Washington Post ein Interview, worin er rundheraus feststellte, er sei der größte Meister der englischen Sprache seit Chaucer, und Größen wie John Milton, Ernest Hemingway und eine Schar weiterer Scharlatane vom gleichen Schlage wären, so oder anders betrachtet, Nullen. Da standen so viele ähnliche Aussprüche, dass ich die Post anrief, um mich zu vergewissern, dass Gardner tatsächlich all das gesagt hatte; man versicherte mir: »Er hat es gesagt, und er war nüchtern.«
Dann kam Truman Capote in unsere Gegend, um vor einem College zu sprechen, doch als er an jenem Abend um acht auf die Bühne torkelte, war er blau und machte sich daran, die Studenten in einer recht kräftigen Sprache zu beschimpfen. »Wieso seid ihr«, wollte er wissen, »wenn ihr Schriftsteller werden wollt, nicht zu Hause und schreibt etwas, statt euch in diesen Saal zu drängen, um eine alte Flasche wie mich anzuhören?« Bei diesen Worten taumelte er und brach am Fuß des Podiums zusammen, von wo der entnervte Direktor der Englisch-Abteilung, zusammen mit zwei Helfern, seinen reglosen Körper von der Bühne schleppte. Ende der Vorlesung.
Als ich am Ende jener Woche von den dramatischen Ereignissen las, sagte ich zu meiner Frau: »Mir ist, als sei ich neunzig und stünde am Ende eines verpassten Lebens. Nie war ich an den Ereignissen des Tages beteiligt. Ich habe kein Recht, mich Schriftsteller zu nennen.« Insgeheim war ich eifersüchtig auf Mailer, Vidal und Capote. Sie haben stets beharrlich dafür Zeugnis abgelegt, dass sie Künstler sind. Und sie haben uns daran erinnert, dass Künstler oft eine besondere Freiheit brauchen, die Leute in anderen Berufen nicht zu benötigen scheinen.
Gegenüber Schriftstellern wie diesen, die sich zu Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens hochstilisieren, sind Schriftsteller wie ich wie gewerkschaftlich Nicht-Organisierte in der Arbeiterschaft; wir profitieren von den Lohnsteigerungen, die von der Gewerkschaft erstritten werden, ohne selbst Beitrag zahlende Mitglieder zu sein oder Drecksarbeit, wie Streikpostenstehen oder die Reihen des Fußvolks führen, tun zu müssen. Wir sind Schmarotzer, und wir wissen es.
Mein Umgang mit Truman Capote, den ich als einen mir selbst so ganz entgegengesetzten Mann schätzen lernte, nahm seinen Anfang in den Geschäftsräumen von Random House, als Bennett Cerf mit einem Abzug jener unsäglichen Fotografie zu mir hereingestürzt kam, das dieses Jüngelchen aus dem tiefsten Magnolienplantagen-Süden zeigt, träge auf eine Chaiselongue hingegossen. Unter das berühmte Foto des Sybariten hatte irgendjemand ein Wortspiel auf den Titel jenes Buches gekritzelt, das Capote einst Ruhm brachte: Other Vices, Other Rooms.
»Sehen Sie, was so ein Schlawiner mir da geschickt hat!«, zeterte Cerf mit seiner hohen, aufgeregten Stimme. Dann aber konnte er sich das Lachen doch nicht verbeißen. »Was Sie brauchen, Michener, ist ein Foto wie dieses. Einen Aufmerksamkeits-Anreißer.«
Danach begegnete ich Capote gelegentlich im Lektorat von Random House, und ich war zugegen an jenem fröhlichen Tag, an dem sich herausstellte, dass ein anderer Verlag – so viel größer als Random House, dass er es riskieren konnte, seine Geschäftsräume in einem un-fashionablen Teil New Yorks zu unterhalten – versucht hatte, Truman mit der Verheißung riesiger Tantiemen in seinen Stall zu locken. Cerf platzte mit der Nachricht heraus: »Capote ist in Versuchung geraten, das muss ich zugeben. Man hat ihm einen Preis geboten, bei dem wir nicht mithalten konnten. Aber schließlich hat er ihnen mit seiner hohen, quäkenden Stimme gesagt: ›Kein junger Mann, der anstrebt, ein seriöser Schriftsteller zu sein, wäre einverstanden, von einem Verlag herausgebracht zu werden, der seine Geschäfte westlich der Fifth Avenue betreibt.‹«
Später irgendwann fiel ich bei Cerf in Ungnade, weil ich mich in den New Yorker Bistros mit meinem alten Freund Leonard Lyons, dem Kolumnisten der New York Post, blicken ließ, der eine Schwäche für Künstler, Musiker und Schriftsteller hatte. Lyons hatte Cerf öffentlich vorgeworfen, er habe Zitate aus seiner Kolumne geklaut, um sie in den klugen Satiren-Anthologien zu verwenden, die er, Cerf, so regelmäßig und erfolgreich herausgab. Wenn ich mit Lyons befreundet sein wollte, konnte ich nicht mit Cerf befreundet sein, und umgekehrt. Wiewohl Capote und ich beide Cerf-Favoriten waren, sollte ich Truman erst durch Lyons kennenlernen; und wichtiger noch, Lyons machte mich auch mit einer phänomenalen Möchtegern-Sängerin-Schauspielerin-Causeuse bekannt. Sie besaß ein Minimum an Talent, ein Maximum an Schönheit und einen derben Sinn für Humor. Auch war sie 188 cm groß, einen halben Kopf größer als ich und anderthalb Köpfe größer als Truman.
Letzteres ist wichtig, weil Truman und ich abwechselnd mit ihr ausgingen, und es war so reizend mit ihr, dass ich es nicht gerne sah, wenn sie Truman begleitete. Sie waren ein phänomenales Paar, die statuenhafte, himmelhoch aufstrebende Bergmannstochter und der rundliche kleine, neben ihr dahintänzelnde Gnom. Es bekümmert mich noch immer, gestehen zu müssen, dass sie Truman viel lieber mochte als mich, zum Teil wohl, weil sie wusste, was für ein auffälliges Paar sie abgaben, und dies war wichtig für eine junge Frau, die in New York ihren Weg zu machen versuchte. Sie mochte auch Leonard Lyons, weil er ihren Namen ziemlich häufig in seiner Kolumne erwähnte, und eines Abends sagte sie mir: »Er macht mich in New York noch zum Stadtgespräch.« Und eine Weile tat er das auch, denn sie konnte eine aufsehenerregende Fernsehshow landen, und alle drehten die Köpfe nach ihr um, wann immer sie wie eine Amazonenkönigin mit Capote oder mir im Schlepptau hereinmarschierte.
Gut, wie sie war, hat sie mir nie von Truman erzählt, noch Truman von mir, aber wir mussten das Doppelspiel bemerken, das sie spielte, doch mochten wir sie deshalb nicht weniger gern. Ich war ganz hingerissen von ihr, wie halb New York in jenem Jahr, und ich verfolgte ihren Weg aufmerksam und liebevoll, denn sie war der erste wirkliche Star, den ich kannte – ich selbst hatte sie in diese Kategorie befördert, wenn auch der Rest der Welt weniger dazu geneigt war. Als dann Capotes sensational gutes Breakfast at Tiffany’s erschien und eine Frau in New York Capote verklagen wollte, weil, wie sie behauptete, die Hauptfigur, diese unbeschreibliche Holly Golightly, ihr nachgebildet sei, setzte ich mich daher in meiner Herzensgüte hin, griff zur Feder und ließ einen Brief an Random House los, in dem ich meinen Schriftstellerkollegen verteidigte. Aus Gründen, die gleich einsichtig werden, darf ich vermuten, dass der Brief, den ich an Donald Klopfer, den Vizepräsidenten des Verlags, abschickte, vernichtet wurde; aber ich kann mich noch gut an seinen Inhalt erinnern:
Lieber Donald,
Ich kann nicht dasitzen und zusehen, wie Ihr und mein Freund Truman Capote durch die Gerichtsklage, die über ihm schwebt, gekreuzigt werdet. (Eine hübsch zusammengestoppelte Metapher.) Die Klage, die von der jungen Frau aus New York angestrengt wird, ist offenbar falsch, denn zufällig weiß ich, dass Truman seine Holly Golightly einer wunderbaren jungen Dame aus Montana nachgebildet hat, und sollte es zur Verhandlung kommen, bin ich gerne bereit, dies zu bezeugen.
Jim Michener
Nun, der Brief war noch keine sechs Minuten bei Random House, als Bennett Cerf schon am Telefon hing und keifte: »Haben Sie Durchschläge von diesem verrückten Brief, den Sie uns geschickt haben?« Bevor ich auch nur den Mund aufmachen konnte, fuhr er fort: »Verbrennen Sie sie! Als ich Truman Ihren Brief zeigte, jammerte er: ›Ich fürchte schon, sie wird mich auch verklagen?‹«
Mir war klar, dass Capote seine Holly jener fröhlichen jungen Dame nachgebildet hatte, die wir beide so sehr liebten, aber sie hat ihn nicht verklagt. Wahrscheinlich vor allem, weil sie die enorme Publicity genoss, die sein Buch ihr im Kreis ihrer Freunde aus der Café-Society einbrachte, die den wahren Sachverhalt kannten. Doch nach dieser Beinah-Pleite mit den Prozessen sah Truman sie immer seltener und überließ das Feld mir, und ich war weiterhin betört vom sprudelnden Charme des Mädchens. Ich musste mich dann allerdings aus der Konkurrenz zurückziehen, und zwar wegen ihres unvermindert starken Drangs, Aufmerksamkeit zu erregen.
Das war der Beginn einer sporadischen Freundschaft mit Capote, der sich bei mir für die erbotene Hilfe bedankte, so irrig sie auch gewesen sein mochte. Ich sah ihn manchmal im El Morocco, wo er Marilyn Monroe hofierte, die, wenn sie mit ihm tanzte, ihre Schuhe auszog (sonst wäre auch sie einen Kopf größer gewesen).
Je mehr ich über Capote erfuhr, desto besser konnte ich ihn leiden. Ein Produzent, für den ich in Hollywood arbeitete, erzählte mir, dass Truman, wenn er über Land reiste, sich gern zur Bibliothek irgendeiner verschlafenen Kleinstadt chauffieren und den Fahrer draußen warten ließ, während er, Capote, hineinrannte. »Das erste Mal sagte ich nichts. Das nächste Mal fragte ich: ›Truman, was zum Teufel tun Sie da in den Bibliotheken?‹ Und er antwortete mit kindlichem Vergnügen: ›Die Karteikarten durchsehen. In dieser hatte Mailer sieben Karten. Vidal hatte acht. Ich aber hatte elf.‹«
Truman lud mich zu seinem großen Karacho im Waldorf ein, der Sensation jener Saison, aber ich war in Europa, und später sah ich ihn, glaube ich, nicht mehr. Nach dem Debakel in Maryland, wo er vor seinem studentischen Publikum betrunken umgekippt war, schrieb ich ihm eine Nachricht, die besagte: »Bleib dran, Junge. Wir brauchen Dich.«
Ich jedenfalls brauchte ihn, denn mit den Jahren war ich ihm zunehmend dankbar dafür, dass er die Rolle des Genie-Clowns spielte, der das breite Publikum daran erinnert, dass Künstler stets anders sind, und dies manchmal radikal. Mein letzter Kontakt mit ihm brachte diese Überzeugung auf den Nenner. Ich hatte in den New Yorker Büros von Random House emsig an einem Manuskript gearbeitet – drauflosgeschuftet, wäre das treffendere Wort – und kam mit verschwommenem Blick aus dem Verlag, als ich mich von der grellweißen Umschlagseite einer großen Greenwich-Village-Zeitung angestarrt fühlte. Sie enthielt keinen Titel, nur ein herrlich verlottertes Foto meines Freundes Capote, der mich – einen Sombrero auf dem Kopf, oder war es ein Opernhut à la Toulouse-Lautrec aus dem vorigen Jahrhundert? – höhnisch angrinste, und links oben vier fette Druckzeilen:
Ich bin AlkoholikerIch bin süchtigIch bin schwulIch bin ein Genie
Die ersten drei Behauptungen gestand ich ihm zu, aber mit der letzten hatte ich Schwierigkeiten. In einem Leben langer Wanderschaft habe ich persönlich nur zwei Genies kennengelernt, Tennessee Williams, der mit Wörtern und menschlichen Situationen brillanter umgehen konnte als irgendeiner von uns, und Bobby Fischer, den Schachweltmeister, der einzigartig verrückt programmiert war. Beide Männer fanden, dass es ein unerträglicher Zustand sei, bergendes Gefäß des Genius zu sein, und beide gingen an dieser Belastung zugrunde.
Larry Grobel, der Gesprächspartner bei den Interviews, auf denen dieses Buch beruht, begann seine langen Sitzungen mit Capote etwa um die gleiche Zeit, als er mich in Florida interviewte, und ich hatte das lohnende Erlebnis, von diesem Unternehmen und später von seiner Reaktion auf einen Schriftstellerkollegen zu hören, den ich seit Langem bewunderte. Grobel sagte unumwunden, Capote sei ein Genie; der Fluss seiner Worte, stets absolut richtig gesetzt, käme aus keiner gewöhnlichen Quelle.
Grobels Urteil zwang mich, meine Einschätzung Capotes zu überdenken.
Zur Zeit der Veröffentlichung von In Cold Blood arbeitete ich in weit verstreuten Teilen der Welt, und wohin ich auch kam, wurde In Cold Blood in die Landessprache übertragen – mit all der Wucht, die es im Englischen gehabt hatte. Kritiker, Leser und andere Schriftsteller waren allesamt fasziniert, und kein anderes Buch während meiner produktiven Jahre genoss solchen Beifall von Publikum und Kritikern.
Ich schätzte damals, dass Truman mindestens vier Millionen Dollar mit seinem Buch verdient haben musste, und wahrscheinlich fünf. Sein außerordentlicher Reichtum erlaubte ihm ein außerordentliches Auftreten.
Aber ich respektierte ihn nicht wegen seiner Einkünfte; es war wegen seiner Beharrlichkeit, wegen der hohen Qualität seiner Arbeit und wegen seiner Weigerung, sich unterkriegen zu lassen. Mir gefiel, wie meisterlich er das treffende Zitat setzte, eine Fähigkeit, die mir abgeht. Auch schätzte ich die Art, wie er einmal eine Sentenz anbrachte, die ich nie zuvor gehört hatte, auch wenn andre behaupteten, es sei ein alter Klassiker, für den passenden Augenblick wiederbelebt. Capote hatte seiner Freundin Prinzessin Lee Radziwill, Jackie Kennedys Schwester, eine Rolle in einem Fernsehstück eingepaukt, und sie war durchgefallen. Um sie zu trösten, sagte Capote: »Die Hunde bellen, und die Karawane zieht weiter.« Als ein Mann, der jahrelang mit Karawanen umhergezogen ist, war ich bezaubert von dem glücklichen Einfall, ob nun original Capote oder von ihm aufgeschnappt. Ich denke jährlich ein Dutzend Mal daran, und ich bin dankbar, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat.
Weil vielleicht gerade viele junge Leute dieses Buch lesen werden, muss ich einen Punkt klären. Ich hatte Capote gern, trotz seiner Schwierigkeiten, und ich schätzte ihn hoch als Schriftstellerkollegen, aber nie habe ich ihn oder Oscar Wilde oder Jean Cocteau als den idealen Schriftsteller auf den Thron gesetzt. Byron war ein Truman Capote seiner Zeit; Wordsworth und Goethe waren es nicht. Die meisten guten Bücher der Welt werden von gewöhnlichen oder gar farblosen Menschen geschrieben – Leuten wie Saul Bellow, Anthony Trollope, Gustave Flaubert, Joyce Carol Oates oder Wladyslaw Reymont, dem polnischen Nobelpreisträger. Gewiss gefällt mir Capote, aber ich möchte ihn nicht endlos kopiert sehen von unseren jugendlichen Aspiranten. Er wäre einzuordnen als ein später Thomas Chatterton, unzweifelhaft brillant, unzweifelhaft lodernd, unzweifelhaft zum Scheitern verurteilt.
Hat Grobel Recht, wenn er Capote ein Genie nennt? Ich bin mir nicht sicher, denn ich habe strenge Maßstäbe für dieses Wort, aber ich möchte doch zwei Beweisstücke ins Mahlwerk der Kritik werfen, die vielleicht Grobels Behauptungen stützen.
Erstens bezweifle ich, dass irgendein anderer Schriftsteller, gleich welcher Sprache, der zur Zeit der Morde von Kansas lebte, In Cold Blood mit jener strengen Selbstbeherrschung hätte schreiben können, wie Capote sie übte. Ich meine damit die Darstellung eines Themas von aischylianischer Tragik, ohne verdrießliches Moralisieren; ich meine die Wahl des exakt richtigen Vokabulars; ich meine die Handhabung von Spannung und Horror, ohne in falsches Pathos zu verfallen; ich meine das Erzählen einer sehr persönlichen Geschichte – seine Interaktion mit zwei abscheulichen Mördern –, ohne sich selbst zu einer zentralen Figur werden zu lassen; ich meine auch die Pioniertat eines neuen Stils, Romane zu schreiben. Aus allen diesen Gründen kann man Capote rühmen, ein Ehrfurcht heischendes Meisterwerk hervorgebracht zu haben. Niemand als er hätte es damals tun können, und wenige könnten es heute erreichen.
Zweitens habe ich Jahre später mit gebanntem Interesse Auszüge aus Capotes letztem Werk gelesen, jenen nie vollendeten Answered Prayers, wie sie 1975 und 1976 im Esquire veröffentlicht wurden. Ich hatte seit Jahren gehört, Truman arbeite an etwas, das er als sein Meisterwerk betrachte, und ich hatte ein mehr-als-übliches Interesse entwickelt. Ein Schriftsteller hört dauernd, dass irgendein Zeitgenosse an dem Opus summum bonum arbeitet, das sich einen sicheren Platz in der Nachwelt behaupten wird. Mailer arbeitet an solch einem Werk. Das tut auch James Baldwin, und das tut auch Graham Greene. Das tut auch Joyce Carol Oates. Das tut auch Otto Defore, von dem noch niemand gehört hat, draußen in Idaho. Das tun wir alle.
Hier aber bot Capote tatsächlich Proben aus seinem Chef d’œuvre, und ich war ungeduldig, sie zu prüfen. Bevor ich mit der zweiten Lieferung fertig war, stand meine Meinung fest, und ich hielt mein Urteil in einem Aide-mémoire für mich fest:
Ein schockierender Vertrauensbruch und Klatschen auf der Toilette, ein Um-den-Tisch-Sitzen. Ich bin bekannt mit vieren der Leute, die T.C. so misshandelt, und ich kann die falschen Behauptungen, die er aufstellt, kategorisch bestreiten. Ein Meisterwerk an reiner Biestigkeit, das viele vordem aufgetane Türen schließen wird. Warum hat er das getan? Hat er kein Verantwortungsgefühl oder Noblesse oblige? Die Sicht eines Proktologen auf die amerikanische Gesellschaft.
Aber ich bin sicher, dass Answered Prayers, falls er das Ganze zu Ende bringen kann, der Schlüsselroman unseres Jahrzehnts sein wird, das Werk eines amerikanischen Proust, von dem man sagen wird, es habe unsere Epoche auf den Nenner gebracht. Ich kann mir vorstellen, wie Harvard-Absolventen im Jahr 2060 ihren Dr. phil. machen, indem sie rätseln, wer die verruchtesten und gemeinsten Charaktere Capotes waren, und dann die Gerechtigkeit seiner Anmerkungen bewerten. Die beste dieser Studien, eine, die seinen Ruf festigen wird, könnte den Titel tragen: »Truman Capote und seine Zeit.« Wie Toulouse-Lautrec wird er schließlich seine Epoche repräsentieren, und man wird ihn schätzen für die meisterhafte Art, wie er sie auf ihren Begriff brachte.
Aber nur, wenn er sein Werk in großem Stil abschließen kann, nur wenn er genügend führende oder bedeutsame Persönlichkeiten einbezieht, nur wenn er seinen Stoff meistert, statt sich von ihm überwältigen zu lassen. Ich höre, er trinkt so viel und hängt so schwer an Drogen, dass er es nur schwerlich schaffen dürfte. Was wird er uns dann hinterlassen haben? Ein paar Fragmente, in Fußnoten abzuhandeln. Eine verdammte Menge Fast-Literatur wird in Fußnoten zusammengedrängt.
Aufgrund einer ungewöhnlichen Kombination von Umständen war es mir vergönnt, Capote flüchtig kennenzulernen und seine Leistung mit einiger Genauigkeit einzuschätzen. Ich hatte eine beständige Zuneigung zu dem Mann, und ungeheuren Respekt vor seinem Talent. Ich beneidete die klassische Art, wie er sich gab und in seiner öffentlichen Pose schwelgte. Seine spöttischen Hiebe waren erste Klasse, seine besten Schriften von hohem Verdienst, und sein In Cold Blood außerordentlich in seiner Meisterschaft.
Sein Weggang hinterlässt eine Lücke. Aber mein Gruß an ihn soll sein, was ich ihm in meinem letzten Brief sagte: »Bleib dran, wir brauchen Dich.«
Austin, Texas
Oktober 1984
EINLEITUNG
Freitagmittag, den 16. Juni 1982, nahm ich ein Taxi vom Drake-Hotel zur Forty-ninth Street und First Avenue. Ich war nervös, als ich in das La Petite Marmite eintrat, gleich gegenüber dem UN-Plaza, in dem er wohnte, wenn er in der Stadt war. »Mr Capote«, sagte ich zum Oberkellner, der mich zu einem Tisch in der Mitte des Raumes führte. Es war voll, aber der einzige Mensch, den ich bemerkte, war Truman Capote, der in einem blauen Leinensakko über dem Polohemd dasaß und ein Glas hielt, sein großer Kopf wie ein Medizinball auf einem kurzen, dicken Hals.
»Bin ich zu spät, oder sind Sie zu früh?«, fragte ich, als ich mich neben ihn setzte.
»Ich bin wohl zu früh«, sagte er. »Ich habe schon mein Essen bestellt, und mein Drink ist da.« Er hob das Glas an die Lippen und nahm einen Schluck.
Er sah nicht so aus, wie ich es erwartet hatte. Sein Gesicht war gedunsen, sein Haar schütter, seine Augen wie die einer Krähe. Er wirkte nicht zwergenhaft oder elfisch, wie er so oft beschrieben worden war, sondern verbreitete Kraft und Autorität.
Ein Kellner kam, und ich bestellte ein Glas Weißwein. »Alles trinkt Weißwein heutzutage«, sagte Capote. »Ich trinke Daiquiris.«
»Trinken Sie eine Menge davon?«, fragte ich.
»Nein, nur zwei pro Tag.«
Der Kellner reichte mir die Speisekarte, und ich bestellte. Essen war das Letzte, was mir am Herzen lag.
»Ich habe vergessen, warum wir hier zusammen essen«, sagte Capote.
»Wir wollten über die Möglichkeit sprechen, ein Fernsehinterview zu machen«, antwortete ich. Ich hatte Interviews für Playboy und Playboy-Kabelfunk gemacht und war aus Kalifornien herübergeflogen, um Capote wegen eines Kabel-Interviews zu treffen.
»Ich hasse Kalifornien. Wie können Sie da leben?«
»Früher habe ich hier gelebt«, antwortete ich, »bin aber 1974 nach Los Angeles gezogen.«
»Wieso, um Himmels willen, haben Sie das getan?«, fragte er. »Es ist doch eine wissenschaftliche Tatsache, dass Sie, wenn Sie in Kalifornien leben, jedes Jahr einen Punkt von Ihrem IQ verlieren. Im Ernst.«
Er war eben ein Kauz. Ich hatte Capote als Schriftsteller immer bewundert. Ich gab Norman Mailer recht, wenn er in Advertisements for Myself über ihn schrieb: »Er ist der perfekteste Schriftsteller meiner Generation, er schreibt die besten Sätze, Wort für Wort und Takt für Takt. Ich hätte keine zwei Wörter in Breakfast at Tiffany’s geändert, das ein kleiner Klassiker werden wird.« Auch erinnerte ich mich an einen Professor am College, der sagte, Lawrence Durrell zu lesen, sei wie Champagner trinken, aber Capote zu lesen, sei, wie wenn man reines frisches Bergwasser trinkt. (Er fügte noch hinzu, Kerouac sei wie Coca-Cola, was Capote ein Kichern entlockte.)
Ich war mir nicht sicher, was ich von Capote, der öffentlichen Person, halten sollte, aber ein Mann, der mit Marilyn Monroe, Jacqueline Onassis und Perry Smith Händchen halten und sich an Witz mit den besten seiner Zeitgenossen messen konnte, war gewiss jemand, den aufzusuchen sich lohnte.
Er erzählte mir, dass ein anderes Kabelfernsehprogramm ihn gebeten hätte, dort aufzutreten, aber sie hätten den Fehler gemacht, ihm eine Liste der Leute zu schicken, die sie bereits aufgenommen hatten. Er war nicht beeindruckt. »Besonders, da sie mit Gore Vidal anfingen«, lachte er.
Dann sagte er, er wolle keine Interviews mehr machen, dort wo er wohnte, denn einmal habe er Barbara Walters’ Team hereingelassen, und sie hätten »eine solche Schweinerei« gemacht.
Ich fragte ihn nach der Kabel-Show, die er und Joanne Carson erwogen, aber er bezweifelte, ob sie je zustande käme. »Sie müssten mir eine Menge Geld bezahlen, und wie ich höre, gibts noch kein Geld in Kabel-Land.«
Wir wurden jedoch gestört durch das Auftauchen eines vor Stolz strahlenden Kellners. »Warten Sie nur, bis Sie sehen, wie der Chef dies für Sie zubereitet hat«, sagte er zu Capote.
Truman besah sich den Fisch auf seinem Teller und jammerte: »Oh, das ist nicht so, wie ich es wollte. Also gut, ich probiere ihn.«
Er studierte den Fisch. »Nun«, sagte Capote zu mir, »wann würden Sie es machen wollen?«
»Jederzeit, wann Sie wollen«, antwortete ich.
»Jederzeit nach Mitte August«, sagte er, und dann gab er mir seine zwei Telefonnummern, die er mich bat geheim zu halten, weil er sie eben erst habe ändern lassen.
Ich erzählte ihm, dass ich, als ich mich auf ein Interview mit Marlon Brando vorbereitete, jenes Stück, das Capote einst für den New Yorker schrieb, »The Duke in His Domain«, sehr hilfreich und aufschlussreich gefunden hätte.
»Ja«, stimmte er zu, »aber mein bestes Prominentenporträt ist das über Marilyn Monroe.«
Die nächste Stunde lang, während er seinen Fisch aß und ich in meinen Krabben stocherte, sprachen wir über das Neueste im Fernsehen und über sein Schriftstellerleben. John Hinckley war nach den Schüssen auf den Präsidenten für verrückt erklärt und in eine Anstalt eingewiesen worden, was das richtige Urteil sei, wie Capote fand. »Er ist wahnsinnig, was sonst?«
Claus von Bülow hingegen, der unlängst schuldig gesprochen worden war, seiner Frau eine lebensgefährliche Dosis Insulin gespritzt zu haben, hielt er für völlig unschuldig. »Ich weiß es als Tatsache«, sagte Capote. »Seine Frau versuchte mir einmal beizubringen, wie man mit einer Spritze umgeht, um mir selbst Vitamin-B12-Injektionen zu machen.«
Ich fragte ihn, wieso er dann nicht in von Bülows Prozess aufgetreten sei.
»Nur, weil ich sicher war, dass er freigesprochen werden würde. Und weil Norman Mailer um Jack Abbott ein solches Spektakel aufgeführt hatte, fand ich es auch nicht so gut, wenn nun ein anderer Schriftsteller dasselbe tat. Aber ich werde aussagen, wenn sie in die Berufung gehen.«
Auch wenn seine Stimme ein paar Oktaven höher lag als Tenor, war dies nicht das nasale Schrillen, das ihr eigen schien, wenn ich ihn bei Talkshows im Fernsehen hörte, was wohl, so überlegte ich, seine sorgfältig stilisierte Persona sein mochte, wenn er »auf Sendung« war.
Als ich ihn nach seinen Gewohnheiten beim Schreiben fragte, sagte er, dass er jeden Morgen um vier Uhr dreißig aufstünde und von fünf Uhr dreißig bis zwölf Uhr dreißig mittags arbeite. Er meinte, er sei ein langsamer Schreiber, er überarbeite immer wieder, was er geschrieben habe, und gegenwärtig arbeite er an Answered Prayers und an einem Band Kurzgeschichten. Auch lese er gern seine Bücher, sagte er, und: »Jedes Mal, wenn ich In Cold Blood zur Hand nehme, lese ich es von Anfang bis Ende durch, als ob nicht ich es geschrieben hätte. Es ist wirklich ein ganz perfektes Buch, wissen Sie. Ich würde nichts daran ändern.«
»Ist es auch Ihr Lieblingsbuch?«, fragte ich.
»Nein, mein Lieblingsbuch ist The Muses Are Heard.«
Als ich ihn fragte, wer sein Agent sei, meinte er, er hätte keinen, nur einen Anwalt. »Warum sollte man es sich zwanzig Prozent kosten lassen, wenn der Anwalt die Arbeit tut? Dann sind es nur zehn Prozent. Ich habe nie einen Agenten gehabt, weil ich meine erste Arbeit verkaufte, als ich siebzehn war, und direkt zum Verlag ging. Und damals war ich der Jüngste, der beim New Yorker gearbeitet hat.«
Unser Gespräch sprang zum Film über, und er sprach über das Drehbuch für seinen Schmöker Handcarved Coffins. Das Projekt sei bei United Artists gewesen, »aber dort gab es Krach, und jetzt ist es bei Twentieth Century-Fox. Ich habe dieses Buch über David Begelman gelesen, Indecent Exposures, und da werden ein paar Leute genannt, darum ist es vielleicht nicht so gut«, lachte er. »Ich habe einen Reporter eingeführt, damit das Drehbuch läuft. Ich hab versucht, mich möglichst aus der Geschichte rauszuhalten.«
Als die Rechnung kam, bestand Capote darauf, sie zu begleichen. Er klagte über die Schleimbeutelentzündung in seiner Schulter und sagte, er habe zum Zahnarzt gehen müssen, weil seine Zähne nicht gut seien, er habe allerhand Schwierigkeiten gehabt, darunter auch die, wieder zu korrigieren, was sein früherer Zahnarzt mit seinen Zähnen anrichtete. »Er war eine Niete«, knurrte er, als wir das Restaurant verließen.
Im August sprach ich mit Capote am Telefon, um zu sehen, ob wir unser Interview nicht auf Oktober verschieben könnten.
»Was wars doch gleich, was wir machen sollten?«, fragte er, und seine Stimme klang, als spräche er durch ein Sieb. Dies war der scherzende Capote, nicht dieselbe Stimme wie damals, als wir uns trafen.
Ich frischte seine Erinnerung auf, und er sagte, mit dieser erstickten Stimme: »Oh, ich komme gerade von einer 60Minutes Show heute Morgen. Bin eben zurück. Ich habe lange kalt geduscht, hihi«, kicherte er. »Hmmm, na, ich habe nichts dagegen. Lassen Sie mich nachsehen – ich muss im Oktober einen Vortrag halten, an der University of California in Berkeley.«
Ich schlug vor, wir könnten das Interview vielleicht in Los Angeles machen, wenn er an der Küste wäre.
»Ich hasse Los Angeles«, sagte er. »Lassen Sie mich meine Agenda holen und das Datum suchen. Bleiben Sie.« Als er wiederkam, klang er verblüfft. »Welch ein Wunder, ich hab sie sofort gefunden – und bei der Unordnung, die in diesem Zimmer herrscht, wie der Schreibtisch aussieht … Mal sehen, im November habe ich diesen Vortrag. Na, jederzeit im Oktober, wann Sie kommen wollen, wirds gut sein. Schicken Sie mir nur zwei Briefe mit Datum und Zeit und Ort, einen an meine New Yorker Adresse und den anderen in mein Haus in Sagaponack. Es heißt S-a-g … hmmm, wie buchstabiert man das?«
Drei Wochen später rief er an. »Wie gehts Ihnen?«, quäkte er. »Ich habe Ihren Brief bekommen, und es ist gut. Wie gehts da drüben, wo die Wellen donnern?« Er riefe aus seinem Haus in Sagaponack an, sagte er, und er war offenbar ganz munter und gut aufgelegt.
Unser Interview war für Dienstag, den 12. Oktober, angesetzt, im Drake-Hotel. Am Montag versuchte ich, ihn anzurufen, konnte ihn aber nicht erreichen. Am Dienstagmorgen versuchte ich es noch einmal und erwischte ihn, als er sich eben rasierte. Ja, er werde rechtzeitig da sein, sagte er. Nein, er wolle nicht, dass ein Mietwagen ihn hole, er werde ein Taxi nehmen.
Als er eintraf, bot ich ihm einen Drink an, aber er lehnte ab. Nach einer Weile jedoch, als wir mit der Aufzeichnung begannen, änderte er seine Meinung und begann, Wodka zu trinken, pur.
Er war vorsichtig anfangs, wurde aber bald lockerer. Er las sogar sein kurzes Stück mit dem Titel »Mr Jones«, aus Music for Chameleons, über einen blinden, verkrüppelten Mann mit einem kleinen scharlachroten, sternförmigen Muttermal an der linken Wange, der im Zimmer nebenan wohnte, als er 1945 in einer Pension in Brooklyn lebte. Zehn Jahre später, in einem Metrowagen in Moskau, sah Capote den Mann gegenübersitzen – nur, dass er nicht blind oder verkrüppelt war, doch er hatte dasselbe auffällige Muttermal. Als er zu Ende gelesen hatte, schloss er das Buch mit einer gewissen Befriedigung und brummte in seinem typischen schleppenden Südstaatlerakzent: »So viel zu russischen Spionen.«
Weil das Interview so gut lief – und weil ich wusste, wir würden nur etwa acht Minuten davon über den Sender schicken –, fragte ich Truman, als wir fertig waren, ob er nichts dagegen hätte, unser Gespräch im Hinblick auf irgendein zukünftiges Projekt fortzusetzen. Ich hatte damals nichts andres im Sinn, als dass ich Geschichte aufzeichnete und dass er ein wunderbar unterhaltsamer Gesprächspartner war. Auch hatte ich mich für dies Interview so über-gut vorbereitet, dass ich noch Hunderte von Fragen zu stellen hatte.
»Ich hab nichts dagegen«, sagte er und schlug vor, ich könnte vielleicht im November nach Berkeley kommen.
Aber Berkeley klappte nicht. Als ich ihn deshalb anrief, sagte er, dass er nur für den einen Tag hinfliegen würde und sofort nach dem Osten zurückkehren müsse. Er bat mich auch, zwei Sachen aus unserem Gespräch zu streichen: etwas, das er über Thomas Thompson gesagt hatte, der unlängst gestorben war, und wie er Jacqueline Onassis an einer Stelle genannt hatte. »Alles andere können Sie lassen, nur das nehmen Sie bitte heraus.«
Er habe hart gearbeitet, sagte er, »geschuftet, würde ich meinen«, und klagte über die Hitze in New York, die »über 30º« sei.
Ich erzählte ihm von einer Umfrage über die Lesegewohnheiten von Teenagern in Cleveland, welche Bücher sie wünschten, dass ihre Eltern sie läsen. Die Wahl Nummer eins war In Cold Blood. Andere genannte Bücher waren Go Ask Alice, I’m O.K., You’re O.K., Of Mice and Men, und The Old Man and the Sea.
»The Old Man and the Sea kann ich nicht ausstehen«, sagte Capote, »aber die anderen können Sie drin lassen.«
Ich sprach ihn wieder am 2. Dezember, und seine ersten Worte waren: »Oh, was wird aus unserem Film?«
Ich fragte ihn, ob er Fotos von sich hätte, die wir benützen könnten, und er sagte, er habe eines, wo er sechzehn war, in der Highschool, das sei »recht nett, sehr ungezwungen. Und Carl Van Vechten hat ein Bild aufgenommen, als ich frisch beim New Yorker war, das ist ganz eindrucksvoll. Es ist in seinem Fotoband, der vor drei Jahren herauskam. Er ist jetzt tot. Auch seine Frau. Tatsächlich gibt es zwei Bilder, die Wendepunkte sind in meinem Leben. Das eine, als ich sechzehn war und eben die Highschool verlassen hatte, und eines von Cartier-Bresson, als ich achtzehn war.«
»Ist es das, welches auf dem Umschlag der Jubiläumsausgabe von Other Voices, Other Rooms abgedruckt ist?«, fragte ich.
»Ja, das ist es. Der Unterschied zwischen den beiden Bildern ist absolut umwerfend. Sie sind beide ganz außerordentlich.«
Aber irgendetwas stimmte nicht. Er klang sehr müde und schwach. Ich fragte ihn, wie es ihm ginge, und er sagte: »Seit ich Sie gesehen habe, gleich am nächsten Tag, habe ich diese Bauchschmerzen. Als ich den Vortrag in Berkeley hielt, bekam ich diese unglaublichen Schmerzen. Ich ließ mir von einem Arzt Demerol geben, es war eine qualvolle Erfahrung. Und als ich nach Hause kam, ging ich jeden Tag zu Untersuchungen ins Krankenhaus. Ich hatte Bauchschmerzen wegen etwas anderem, und sie machten alle diese Tests, und es war Zufall, dass sie einen sehr großen und gefährlichen Polypen in meinem Dickdarm entdeckten. Sie pumpten mir dieses weiße, schleimige Zeug in den Magen und durchleuchteten mich von Kopf bis Fuß. Ich habe unglaubliche Qualen durchgemacht. Ich werde Sonntag ins Krankenhaus gehen. Es wird gut werden, es wird nicht nachwachsen. Ich sage Ihnen, am besten lassen Sie sich auch ganz durchleuchten, von Kopf bis Fuß.«
»Konnten Sie überhaupt arbeiten?«
»Mir gehts zu schlecht, als dass ich überhaupt etwas tun kann. Ich versuche nur, es leichtzunehmen.«
»Können Sie essen?«
»Kann ich nicht. Wenn ich etwas esse, macht es mir furchtbare Bauchschmerzen. Ich soll auch keine Milch trinken«, sagte er mit seinem typischen Lachen. »Es ist ganz unheimlich. Hoffentlich nehme ich etwas ab.«
»In welches Krankenhaus gehen Sie?«
»Mount Sinai. Aber, bitte, erzählen Sie niemandem davon.«
Ich rief ihn am nächsten Tag wieder an, und als er mich fragte: »Wie gehts drüben im lieben alten Totenland?«, da wusste ich, es musste ihm bessergehen.
»Wissen Sie«, witzelte er, »ich habs Ihnen gesagt, Sie verlieren da drüben jede Minute Ihren IQ, Sekunde für Sekunde, tick, tick, tick, tick. Wieso ziehen Sie nicht wieder nach New York?«
»Ich habe hier drüben zu viel Familie«, scherzte ich.
»Na, es gibt ein Mittel, das zu vermeiden«, sagte er lachend. »Hier steht heute eine fantastische Geschichte in der Zeitung, über einen dreizehnjährigen Jungen, der eine .45 Magnum nahm und seine Mutter totschoss, in den Bauch. Als er gefragt wurde, warum er es gemacht hätte, sagte er: ›Weil sie wollte, dass ich in die Schule geh.‹ Sehen Sie, lustige Sachen sind los, hier bei uns!«
»Na ja«, lachte ich, »hier bei uns sind die Zeitungen voll von solchen Geschichten, also versäume ich nichts.«
»Oh, diese erbärmliche Zeitung, die ihr da drüben habt«, sagte er, auf den Herald Examiner anspielend. »Heil’ger Moses, die sollten Patty Hearst zur Herausgeberin machen. Sie würde den Laden aufmöbeln. Die Inside-Story übers Policedepartment bringen!«
Dann fragte er mich, ob ich The Ladies’ Home Journal gesehen hätte, das die Weihnachtsgeschichte über seinen Vater veröffentlicht habe. »Sehen Sie«, sagte er, »das war die andere Seite der Medaille. In A Christmas Memory habe ich meinen Vater gar nicht erwähnt. Ich habe ihn niemals in meinen Büchern erwähnt. Er ist letztes Jahr gestorben. Random House wird es nächstes Jahr in einer wirklich hübschen Ausgabe herausbringen. Ladies’ Home Journal hat eine sehr hübsche kleine Ausgabe davon gemacht, zum Versenden an alle Inserenten. Aber Zeitschriften … Playboy ist die einzige, die wirklich ehrlich ist.
Ich hab einen Brief bekommen, Sie werdens nicht glauben, von einem Redakteur bei McCalls