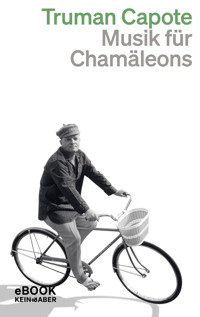79,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Truman Capotes neu editierte Werke in der achtbändigen Zürcher Ausgabe im Schmuckschuber
Band 1: Sommerdiebe
Band 2: Andere Stimmen, andere Räume
Band 3: Baum der Nacht
Band 4: Die Grasharfe
Band 5: Frühstück bei Tiffany
Band 6: Die Hunde bellen
Band 7: Kaltblütig
Band 8: Erhörte Gebete
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 3193
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Die Werke
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Truman Capote wurde 1924 in New Orleans geboren; er wuchs in den Südstaaten auf, bis ihn seine Mutter als Achtjährigen zu sich nach New York holte. Mit zwanzig Jahren veröffentlichte er seine erste Kurzgeschichte Miriam in Mademoiselle; für die Erzählung Die Tür fällt zu wurde ihm 1948 der »O.-Henry-Preis« verliehen. Im selben Jahr erschien sein Roman Andere Stimmen, andere Räume, der als das sensationelle Debüt eines literarischen Naturtalentes gefeiert wurde. Es folgten 1949 die Kurzgeschichtensammlung Baum der Nacht, 1950 die Reisebeschreibung Lokalkolorit, 1951 der Roman Die Grasharfe. Das 1958 veröffentlichte Frühstück bei Tiffany erlangte auch dank der Verfilmung mit Audrey Hepburn große Berühmtheit. 1965 erschien der mehrmals verfilmte Tatsachenroman Kaltblütig, 1973 Die Hunde bellen (Reportagen und Porträts), 1980 Musik für Chamäleons (Erzählungen und Reportagen). Postum wurden 1987 – unvollendet – der Roman Erhörte Gebete, 2005 das neu entdeckte Debüt Sommerdiebe und 2013 der Erzählband Yachten und dergleichen mit einer neu entdeckten Geschichte veröffentlicht. Truman Capotes Gesamtwerk erschien in neuer Übersetzung bei Kein & Aber. Der Autor starb 1984 in Los Angeles.
DIE WERKE
Zürcher Ausgabe in neu übersetzten Einzelbänden Herausgegeben von Anuschka Roshani
» Band 1: Sommerdiebe
» Band 2: Andere Stimmen, andere Räume
» Band 3: Baum der Nacht
» Band 4: Die Grasharfe
» Band 5: Frühstück bei Tiffany
» Band 6: Die Hunde bellen
» Band 7: Kaltblütig
» Band 8: Erhörte Gebete
BAND 1: SOMMERDIEBE
» Über das Buch
» Buch lesen
» Editorische Notiz, Impressum
ÜBER DAS BUCH
Vor ihr liegt ein Sommer, in dem sie einen ganzen Kontinent zwischen sich und ihrer Familie weiß: Während ihre Eltern nach Europa segeln, bleibt die 17-jährige Grady McNeil allein zurück in einem schwülen New York ohne Aircondition, dafür in einem voller Versprechen. Grady kann tun und lassen, was sie will. Und sie will eine Menge, bloß sich noch nicht in die feine Gesellschaft einfädeln, die sie nur müde macht. Sie verliebt sich in Clyde, einen jüdischen Jungen aus Brooklyn, der, zurück aus dem Krieg, als Parkplatzwächter arbeitet. Es ist ihr egal, dass sich ihre Mutter einen anderen Schwiegersohn erträumt – eine standesgemäße Partie. Doch ein komfortables, risikoloses Leben ist das Letzte, was Grady interessiert. Sie schwirrt durch diese heißen Monate mit Clyde und seinen Kumpeln – erfüllt von einer Sehnsucht nach einer Welt mit lauter Unbekannten, wo nichts festgeschrieben ist und stets ein Rätsel bleibt.
»Dieses Buch ist ein wahrer Schatz.«
Cosmopolitan
»Eine aufregende Wiederentdeckung.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung
KAPITEL 1
»Du bist ein Rätsel, mein Liebes«, sagte ihre Mutter, und Grady, die versonnen durch einen Tafelaufsatz mit Rosen und Farn über den Tisch blickte, lächelte nachsichtig: ja, ich bin ein Rätsel, und der Gedanke gefiel ihr. Aber Apple, acht Jahre älter, verheiratet und alles andere als rätselhaft, sagte: »Grady ist dumm, weiter nichts; ich wünschte, ich könnte mitkommen. Stell dir vor, Mama, nächste Woche um diese Zeit wirst du in Paris frühstücken! George verspricht immer, dass wir hinfahren … aber ich weiß nicht.« Sie schwieg und sah ihre Schwester an. »Grady, warum in aller Welt willst du mitten im Sommer in New York bleiben?« Grady wünschte, die anderen würden sie in Ruhe lassen; immer dieses Nachhaken, dabei war nun endlich der Tag gekommen, an dem das Schiff auslief: was gab es da noch zu sagen, über das hinaus, was sie schon gesagt hatte? Danach gab es nur noch die Wahrheit, und mit der mochte sie nicht ganz herausrücken. »Ich habe hier noch nie den Sommer verbracht«, sagte sie, wobei sie es vermied, ihnen in die Augen zu schauen, indem sie aus dem Fenster sah: das Glitzern des Verkehrs hob die Stille des Junimorgens im Central Park hervor, und die Sonne strömte mit der Kraft des jungen Sommers, der den grünen Schorf des Frühlings trocknet, durch die Bäume vor dem Plaza, in dem sie frühstückten. »Ich bin eben pervers, ihr habt Recht.« Lächelnd gestand sie sich ein, dass es vielleicht ein Fehler gewesen war, das gesagt zu haben: ihre Familie war ohnehin nicht weit weg davon, sie für pervers zu halten; schon mit vierzehn war sie zu der erschreckenden und völlig klaren Einsicht gelangt: ihre Mutter, begriff sie, liebte sie, ohne sie wirklich zu mögen; anfangs hatte sie gedacht, es läge daran, dass sie in den Augen ihrer Mutter hässlicher, eigensinniger, weniger kokett war als Apple, aber später, als sehr zu Apples Kummer deutlich wurde, dass sie, Grady, wesentlich hübscher aussah, gab sie es auf, sich über den Standpunkt ihrer Mutter den Kopf zu zerbrechen: die Antwort lautete natürlich, was auch sie schließlich begriff, dass sie einfach, in aller Stille, ihre Mutter nie, nicht einmal als ganz kleines Mädchen, sonderlich gemocht hatte. Doch beide machten davon nicht viel Aufhebens; das Haus ihrer Abneigung war bescheiden mit Zärtlichkeit möbliert, die Mrs. McNeil jetzt zum Ausdruck brachte, indem sie die Hand ihrer Tochter ergriff und dabei sagte: »Wir werden uns aber Sorgen um dich machen, Liebling. Wir können gar nicht anders. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bezweifle, ob das das Richtige ist. Siebzehn ist nicht sehr alt, und du warst noch nie ganz allein.«
Mr. McNeil, der, wenn er den Mund auftat, sich immer so anhörte, als ginge es um seinen Einsatz beim Pokerspiel, der aber nur selten den Mund auftat, teils, weil seine Frau nicht gern unterbrochen wurde, teils, weil er ein sehr müder Mann war, titschte seine Zigarre in der Kaffeetasse aus, was bei Apple und Mrs. McNeil bewirkte, dass sie zusammenzuckten, und sagte: »Als ich achtzehn war, Teufel auch, da hatte ich mich schon drei Jahre lang in Kalifornien umgetan.«
»Aber Lamont – du bist schließlich ein Mann.«
»Was gibt’s da für einen Unterschied?«, brummte er. »Gibt doch schon seit einiger Zeit keinen Unterschied mehr zwischen Männern und Frauen. Behauptest du selbst.«
Mrs. McNeil räusperte sich, als habe das Gespräch eine unangenehme Wendung genommen. »Trotz allem, Lamont, ist mir gar nicht wohl bei der Abreise …«
Unbändiges Gelächter stieg in Grady auf, eine freudige Erregung angesichts dieses Sommers, der sich vor ihr erstreckte wie eine endlose weiße Leinwand, auf die sie selbst die ersten groben Pinselstriche auftragen konnte, ganz und gar frei. Dann wiederum, und mit ernstem Gesicht, lachte sie, weil die anderen kaum etwas ahnten, nichts. Das Licht, das flirrend vom Tafelsilber abprallte, schien ihre Erregung zu stärken und ihr gleichzeitig ein Warnsignal zuzublinken: Vorsicht, Liebes. Aber anderswo sagte etwas: Grady, sei stolz, du bist groß, also hisse deine Flagge hoch droben, im Wind. Was konnte gesprochen haben, die Rose? Rosen sprechen, sie sind das Herz der Weisheit, hatte sie irgendwo gelesen. Sie sah wieder aus dem Fenster; das Gelächter strömte hoch, es flutete auf ihre Lippen: was für ein strahlender, sonnenüberglänzter Tag für Grady McNeil und Rosen, die sprechen!
»Was ist denn so komisch, Grady?« Apple hatte keine angenehme Stimme; sie erinnerte an das vorsprachliche Gebrabbel eines missgelaunten Säuglings. »Mutter stellt eine einfache Frage, und du lachst, als wäre sie eine dumme Kuh.«
»Grady hält mich bestimmt nicht für eine dumme Kuh«, sagte Mrs. McNeil, aber ein Unterton schwacher Überzeugung deutete auf Zweifel hin, und ihre Augen, verhangen von dem spinnennetzartigen Hutschleier, den sie jetzt vor das Gesicht zog, trübten sich von dem Stich, den sie stets verspürte, wenn ihr das entgegenschlug, was sie für Gradys Verachtung hielt. Es ging noch an, dass es zwischen ihnen nur die spärlichste Verbindung gab: es herrschte keine echte Sympathie, das wusste sie; doch dass Grady sich durch ihre Unnahbarkeit für die Überlegene ausgeben konnte, war unerträglich: in solchen Augenblicken zuckten Mrs. McNeil die Hände. Einmal, aber das war schon viele Jahre her, als Grady noch ein Wildfang mit kurzen Haaren und verschorften Knien war, hatte sie ihre Hände nicht beherrschen können, und bei dieser Gelegenheit, die natürlich in jene Zeit fiel, welche die nervenaufreibendste im Leben einer Frau ist, hatte sie, provoziert von Gradys rücksichtsloser Unzugänglichkeit, ihre Tochter heftig geohrfeigt. Jedes Mal, wenn sie danach von ähnlichen Regungen überkommen wurde, gab sie ihren Händen Halt auf einer festen Oberfläche, denn anlässlich ihrer damaligen Unbeherrschtheit hatte Grady, deren abschätzende grüne Augen wie Bröckchen aus Meerwasser waren, sie unverwandt angeblickt, hatte in sie hineingeblickt und einen Scheinwerferkegel auf den verwöhnten Spiegel ihrer Eitelkeit gerichtet: denn sie war eine beschränkte Frau, es war ihre erste Begegnung mit einer Willenskraft, die stärker war als ihre eigene. Bestimmt nicht, sagte sie und zwinkerte mit gekünsteltem Humor.
»Tut mir leid«, sagte Grady. »Hast du eine Frage gestellt? Ich höre offenbar nicht mehr hin.« Das Letzte war von ihr weniger als Entschuldigung gemeint, sondern eher als ein ernstes Geständnis.
»Also wirklich«, zwitscherte Apple, »man könnte meinen, du bist verliebt.«
Etwas pochte an ihr Herz, ein Gefühl der Gefahr, das Silber bebte bedeutsam, und eine Zitronenscheibe, halb zerdrückt in Gradys Hand, verharrte reglos: Grady schaute ihrer Schwester rasch in die Augen, um zu sehen, ob dort irgendetwas Kluges und nicht ganz so Dummes zu entdecken war. Zufrieden drückte sie weiter die Zitrone in ihren Tee aus und hörte ihre Mutter sagen: »Es geht um das Kleid, Liebes. Ich finde, ich kann es ebenso gut in Paris anfertigen lassen: Dior oder Fath, so jemand. Das könnte auf lange Sicht sogar preiswerter sein. Ein weiches Lindgrün wäre himmlisch, besonders bei deinem Teint und deinen Haaren – ich muss allerdings sagen, ich wünschte, du würdest sie nicht so kurz tragen: das wirkt unpassend und nicht … nicht sehr weiblich. Zu schade, dass Debütantinnen nicht Grün tragen können. Ich denke da an etwas aus weißer moirierter Seide …«
Grady unterbrach sie mit einem Stirnrunzeln. »Wenn das das Partykleid sein soll, dann will ich es nicht haben. Ich will keine Party, und ich habe nicht vor, auf eine zu gehen, jedenfalls nicht auf so eine. Ich will mich nicht zum Gespött machen.«
Von allen Dingen, die Mrs. McNeil auf die Nerven gingen, reizte und ärgerte sie das am meisten: sie zitterte, als erschütterten unnatürliche Schwingungen das solide und stabile Mauerwerk des Plaza-Speisesaals. Auch ich lasse mich nicht zum Gespött machen, hätte sie sagen können, denn im Hinblick auf Gradys Debütantinnenjahr hatte sie schon viel Vorarbeit geleistet, viel in die Wege geleitet; es wurde sogar erwogen, eine Sekretärin einzustellen. Darüber hinaus hätte sie in einem Anfall von Selbstgerechtigkeit sogar so weit gehen können, zu behaupten, sie habe ihr gesamtes Gesellschaftsleben, jeden öden Lunch und jeden todlangweiligen Fünfuhrtee (wie sie das in diesem Licht hinstellen würde) nur ertragen, damit ihren Töchtern in ihrem Balljahr ein glänzender Empfang bereitet wurde. Lucy McNeils eigenes Debüt war ein berühmtes und gefühlvolles Ereignis gewesen: ihre Großmutter, eine zu Recht gefeierte New-Orleans-Schönheit, die den Senator LaTrotta von South Carolina geheiratet hatte, führte Lucy zusammen mit ihren beiden Schwestern ein, auf einem Kamelienball in Charleston im April des Jahres 1920; es war wahrhaftig eine Einführung, denn die drei LaTrotta-Schwestern waren kaum mehr als Schulmädchen, deren gesellschaftliche Abenteuer sich bislang in den Fesseln der Kirche zugetragen hatten; so hungrig war Lucy an jenem Abend herumgewirbelt, dass ihre Füße noch tagelang die Blasen dieses Eintritts ins Leben getragen hatten, so hungrig hatte sie den Sohn des Gouverneurs geküsst, dass ihre Wangen noch einen Monat lang vor reumütiger Scham gebrannt hatten, denn ihre Schwestern – damals Jungfern und immer noch Jungfern – behaupteten, Küsse produzierten Babys: nein, sagte ihre Großmutter, als sie ihr tränenreiches Geständnis hörte, Küsse produzieren keine Babys – sie produzieren aber auch keine Ladys. Erleichtert setzte sie ihren Weg durch ein Jahr des Triumphs fort; es wurde ein Triumph, weil sie angenehm anzusehen und nicht unerträglich anzuhören war: enorme Vorteile, wenn man bedachte, dass dies die karge Jahreszeit war, in der den jungen Herren nur solche beklagenswerten Essigpflaumen wie Hazel Veere Numland oder die Lincoln-Mädchen zur Auswahl standen. Dann, in den Winterferien, hatte auch die Familie ihrer Mutter, die Fairmonts aus New York, ihr zu Ehren und genau in diesem Hotel, dem Plaza, einen stilvollen Ball gegeben; sie versuchte sich daran zu erinnern, aber obwohl sie jetzt so dicht beim damaligen Schauplatz saß, vermochte sie sich nur wenig ins Gedächtnis zu rufen, lediglich, dass alles golden und weiß gewesen war, dass sie die Perlen ihrer Mutter getragen hatte, und, ach ja, sie war Lamont McNeil begegnet, ein nicht weiter bemerkenswertes Vorkommnis: sie tanzte einmal mit ihm und war nicht sonderlich angetan. Ihre Mutter jedoch war stärker beeindruckt, denn Lamont McNeil, gesellschaftlich zwar ein unbeschriebenes Blatt, warf, obwohl erst Ende zwanzig, einen immer größeren Schatten auf die Wall Street und galt deshalb als gute Partie, wenn nicht im Kreise der Engel, so doch bei denen in der Schicht direkt darunter. Er wurde zum Essen gebeten. Lucys Vater lud ihn nach South Carolina zur Entenjagd ein. Mannhaft, gab Mrs. LaTrotta von sich, die große alte Dame, und da dies ihr Maßstab war, erteilte sie ihm das goldene Siegel. Sieben Monate später sagte Lamont McNeil, seine Pokerstimme zu ihrem zärtlichsten Vibrato senkend, sein Sprüchlein, und Lucy, die zuvor erst zwei Heiratsanträge erhalten hatte, einer absurd und der andere ein Scherz, sagte, ach, Lamont, ich bin das glücklichste Mädchen auf der Welt. Sie war neunzehn, als sie ihr erstes Kind bekam: Apple, spaßigerweise so benannt, weil Lucy McNeil diese Früchte während ihrer Schwangerschaft kistenweise verzehrt hatte, aber ihre Großmutter, die zur Taufe erschien, fand das geradezu schockierend frivol – Jazz und die zwanziger Jahre, sagte sie, seien Lucy zu Kopf gestiegen. Aber diese Namenswahl war das letzte fröhliche Ausrufungszeichen einer verlängerten Kindheit, denn ein Jahr später verlor sie ihr zweites Kind; es war ein totgeborener Sohn, und zum Andenken an ihren im Krieg gefallenen Bruder nannte sie ihn Grady. Sie brütete lange vor sich hin, Lamont mietete eine Jacht, und sie machten eine Kreuzfahrt durchs Mittelmeer; in jedem hellen, pastellfarbenen Hafen, von St. Tropez bis Taormina, gaben sie an Bord traurige, verweinte Eiscrèmepartys für Horden einheimischer verlegener kleiner Jungs, die der Steward an Land gekapert hatte. Aber bei ihrer Rückkehr nach Amerika lichtete sich dieser tränenreiche Nebel abrupt: sie entdeckte das Rote Kreuz, Harlem und das zwingende Gebot beim Bridge, sie engagierte sich für die Trinitarische Kirche, den Cosmopolitan und die Republikanische Partei, es gab nichts, was sie nicht förderte, begünstigte und protegierte: einige sagten, sie sei bewundernswert, andere nannten sie tapfer, einige wenige verachteten sie. Diese wenigen bildeten jedoch eine energische Clique, und mit vereinten Kräften hatten sie im Laufe der Jahre ein Dutzend ihrer ehrgeizigen Bestrebungen hintertrieben. Lucy hatte gewartet; sie hatte auf Apple gewartet: die Mutter einer erstklassigen Debütantin verfügt über die gesellschaftliche Form des atomaren Gegenschlags; aber dann wurde sie darum betrogen, denn es gab einen neuen Krieg, und ein Debüt mitten im Krieg hätte von außerordentlich schlechtem Geschmack gezeugt: sie hatten stattdessen England einen Sanitätswagen geschenkt. Und nun versuchte auch Grady, sie darum zu betrügen. Ihre Hände zuckten nervös auf dem Tisch, flogen zum Revers ihres Kostüms und zupften an einer Brosche aus zimtfarbenen Diamanten: es war zu viel, Grady hatte immer versucht, sie zu betrügen, einfach dadurch, dass sie nicht als Junge geboren wurde. Sie hatte sie trotzdem Grady genannt, und die arme Mrs. LaTrotta, die sich damals in ihrem letzten, verdrossenen Lebensjahr befand, hatte sich dazu aufgerafft, Lucy für morbide zu erklären. Aber Grady war nie Grady gewesen, nicht das Kind, das sie sich wünschte. Und es war keineswegs so, dass Grady in dieser Hinsicht ideal sein wollte: Apple mit ihrer niedlichen, koketten Art und unterstützt von Lucys Stilgefühl, wäre ein sicherer Erfolg gewesen, aber Grady, die, so fing es schon an, bei jungen Leuten nicht beliebt zu sein schien, war ein Wagnis. Wenn sie sich weigerte mitzumachen, war der Misserfolg unvermeidlich. »Es wird ein Debüt geben, Grady McNeil«, sagte sie und zog ihre Handschuhe in die Länge. »Du wirst weiße Seide tragen und einen Strauß grüner Orchideen haben: der wird ein wenig die Farbe deiner Augen einfangen und zu deinen roten Haaren passen. Und wir werden die Kapelle engagieren, die die Bells für Harriet hatten. Ich warne dich, Grady, wenn du dich deswegen grässlich aufführst, werde ich nie wieder ein Wort mit dir wechseln. Lamont, verlangst du bitte die Rechnung?«
Grady schwieg einige Augenblicke lang; sie wusste, dass die anderen nicht so ruhig waren, wie sie taten: sie warteten darauf, dass sie wieder Theater machte, was bewies, mit welcher Ungenauigkeit sie sie beobachteten, wie wenig sie von ihrem neuen Wesen ahnten. Noch vor einem Monat, noch vor zwei Monaten wäre sie, wenn sie sich in ihrer Würde so angegriffen gefühlt hätte, hinausgestürzt und in ihrem Auto mit durchgetretenem Gaspedal über die Hafenstraße gebraust; sie hätte Peter Bell aufgetrieben und den Ärger in einem Wirtshaus an der Landstraße hinter sich gelassen; sie hätte alle dazu gebracht, sich Sorgen zu machen. Aber was sie jetzt empfand, war echte Unbeteiligtheit. Und bis zu einem gewissen Grade Sympathie für Lucys ehrgeizige Pläne. Es war so weit fort, einen ganzen Sommer weit; es gab keinen Grund, zu glauben, dass es je geschehen würde, das weiße Seidenkleid und die Kapelle, die die Bells für Harriet gehabt hatten. Während Mr. McNeil die Rechnung beglich und sie den Speisesaal durchquerten, nahm sie Lucys Arm und drückte ihr mit ungelenker Ausgelassenheit ein zartes, spontanes Küsschen auf die Wange. Es war eine Geste, die die unmittelbare Wirkung hatte, sie alle zu vereinen; sie waren eine Familie: Lucy strahlte, ihr Mann, ihre Töchter, sie war eine stolze Frau, und Grady, bei all ihrer eigensinnigen Sonderbarkeit, war ein wunderbares Kind, eine richtige Persönlichkeit. »Liebling«, sagte Lucy, »du wirst mir fehlen.«
Apple, die vorausging, drehte sich um. »Grady, bist du heute Morgen in deinem Auto hergekommen?«
Grady ließ sich Zeit mit der Antwort; neuerdings schien alles, was Apple sagte, verdächtig zu sein; aber warum sich Gedanken machen? Was, wenn Apple es wusste? Trotzdem hatte sie etwas dagegen. »Ich bin mit dem Zug aus Greenwich gekommen.«
»Dann hast du das Auto zu Hause gelassen?«
»Wieso, ist das von Bedeutung?«
»Nein; na ja, schon. Und du brauchst mich nicht so anzublaffen. Ich dachte nur, du könntest mich nach Long Island hinausfahren. Ich habe George versprochen, dass ich in der Wohnung vorbeischaue und seine Enzyklopädie hole – einen schweren Brocken. Ich würde sie äußerst ungern im Zug mitschleppen. Wenn wir früh genug hinkämen, könnten wir baden gehen.«
»Tut mir leid, Apple. Das Auto ist in der Werkstatt; ich hab’s neulich hingebracht, weil der Tachometer klemmte. Wahrscheinlich ist es inzwischen fertig, aber ich bin schon in der Stadt verabredet.«
»Ach ja?«, sagte Apple säuerlich. »Was dagegen, wenn ich frage, mit wem?«
Grady hatte sehr viel dagegen, gab aber »Mit Peter Bell« zur Antwort.
»Mit Peter Bell, großer Gott, warum triffst du dich andauernd mit dem? Der hält sich für sehr klug.«
»Das ist er auch.«
»Apple«, sagte Lucy, »Gradys Freunde gehen dich nichts an. Peter ist ein reizender Junge; und seine Mutter war eine meiner Brautjungfern. Lamont, weißt du noch? Sie hat den Brautstrauß aufgefangen. Aber ist Peter nicht noch in Cambridge?«
Genau in diesem Augenblick hörte Grady, wie jemand quer durch die Hotelhalle ihren Namen rief: »Heda, McNeil!« Nur ein Mensch auf der ganzen Welt nannte sie so, und mit gespielter Freude, denn er hatte sich für seinen Auftritt nicht den glücklichsten Zeitpunkt ausgesucht, sah sie, er war es. Ein junger Mann, teuer, aber unpassend gekleidet (er trug eine weiße Abendkrawatte zu einem strengen Flanellanzug, dessen Hose von einem denkbar unpassenden, schmucksteinbesetzten Wildwestgürtel zusammengehalten wurde, und an seinen Füßen staken Tennisschuhe), der sein Wechselgeld am Zigarrenstand einsteckte. Als er auf sie zuging, wobei sie ihm auf halbem Wege entgegenkam, schritt er mit dem lässigen Selbstvertrauen dessen aus, der immer weiß, wo das Beste im Leben zu finden ist. »Was bist du hübsch, McNeil«, sagte er und drückte sie voller Zutrauen an sich. »Aber nicht so hübsch wie ich: ich war gerade beim Friseur.« Die makellose Frische seines glatten, klaren Gesichts bewies das; und ein frischer Haarschnitt gab ihm jenen Anschein wehrloser Unschuld, wie es nur ein Haarschnitt kann.
Grady versetzte ihm einen glücklichen, jungenhaften Schubs. »Warum bist du nicht in Cambridge? Oder ist das Recht zu langweilig?«
»Langweilig schon, aber nicht so langweilig, wie meine Familie es sein wird, wenn sie hört, dass ich rausgeschmissen worden bin.«
»Ich glaube dir kein Wort«, lachte Grady. »Jedenfalls will ich alles darüber hören. Nur sind wir gerade schrecklich in Eile. Mutter und Dad fahren nach Europa, und ich bringe sie zum Schiff.«
»Kann ich mitkommen? Bitte, Miss?«
Grady zögerte, dann rief sie: »Apple, sag Mutter, Peter kommt mit«, und Peter Bell drehte Apple hinter ihrem Rücken eine lange Nase, dann lief er auf die Straße, um ein Taxi zu rufen.
Sie brauchten zwei Taxis; Grady und Peter, die an der Garderobe warteten, um Lucys kleinen schielenden Dackel abzuholen, nahmen das zweite. Es hatte ein Schiebedach: Taubenflüge, Wolken und Hochhaustürme stürzten auf sie ein; die Sonne, sommerspitze Pfeile abschießend, spielte mit der hellen Kupferpennyfarbe von Gradys kurzgeschnittenen Haaren, und ihr schmales, lebhaftes Gesicht, geformt aus Knochen von fischgrätenhafter Zartheit, erglühte unter dem wehenden honiggelben Licht. »Falls jemand fragen sollte«, sagte sie, als sie Peters Zigarette für ihn anzündete, »Apple oder jemand, dann sag bitte, dass wir verabredet sind.«
»Ist das ein neuer Trick, den Herren die Zigaretten anzuzünden? Und dieses Feuerzeug; McNeil, wo hast du das denn her? Grauenhaft.«
Das war es auch. Es war ihr jedoch bis zu diesem Augenblick nicht so vorgekommen. Spiegelblank und mit einer riesigen Initiale aus Glitzerplättchen, war es die Art von Neuheit, die man auf den Ladentischen von Drugstores findet. »Ich habe es gekauft«, sagte sie. »Es funktioniert phantastisch. Denkst du trotzdem an das, was ich dir gerade gesagt habe?«
»Nein, mein Schatz, das hast du nie im Leben gekauft. Du gibst dir große Mühe, aber ich fürchte, du bist wirklich nicht besonders ordinär.«
»Peter, nimmst du mich auf den Arm?«
»Ja, natürlich«, lachte er, und sie zog ihn, ebenfalls lachend, an den Haaren. Obwohl nicht miteinander verwandt, waren Grady und Peter dennoch Verwandte, nicht durch das Blut, sondern aus Sympathie: es war die beglückendste Freundschaft, die sie kannte, und in ihrem warmen, sicheren Bad entspannte sie sich bei jedem Zusammensein mit ihm. »Warum sollte ich dich nicht auf den Arm nehmen? Machst du nicht genau das mit mir? Nein, schüttle nicht den Kopf. Du führst was im Schilde, und du willst es mir nicht sagen. Macht nichts, Liebes, ich werde dich jetzt nicht quälen. Und was die Verabredung angeht, warum nicht? Hauptsache, ich kann meinen besorgten Eltern aus dem Weg gehen. Allerdings wirst du zahlen: was hat es schließlich für einen Sinn, für dich Geld auszugeben? Viel lieber würde ich um die liebe Schwester Harriet herumscharwenzeln; wenigstens kann sie einem alles über Astronomie erzählen. Übrigens, weißt du, was dieses öde Mädchen gemacht hat: sie ist nach Nantucket gefahren und will den Sommer damit verbringen, die Sterne zu studieren. Ist das das Schiff? Die Queen Mary? Und ich hatte auf etwas Amüsantes wie einen polnischen Tanker gehofft. Wer sich diesen widerlichen Walfisch ausgedacht hat, der müsste vergiftet werden: ihr Iren habt völlig Recht, die Engländer sind ein Graus. Aber die Franzosen auch. Die Normandie ist gar nicht früh genug ausgebrannt. Trotzdem würde ich nie an Bord eines amerikanischen Schiffes gehen, und wenn man mir dafür …«
Die McNeils waren im A-Deck untergebracht, in einer Suite mit getäfelten Kabinen und falschen Kaminen. Lucy, an deren Revers eben eingetroffene Orchideen zitterten, huschte hierhin und dorthin, mit Apple im Gefolge, die ihr die Begleitkarten von diversen Obst- und Blumenpräsenten vorlas. Mr. McNeils Sekretärin, die stattliche Miss Seed, ging zwischen ihnen mit einer Flasche Piper-Heidsieck umher, ihre Miene war ein wenig verkniffen angesichts der Ungehörigkeit von Champagner am Vormittag (Peter Bell sagte zu ihr, er brauche kein Glas, er nähme auch die Flasche mit dem, was noch drin sei), und Mr. McNeil selbst, würdig geschmeichelt, stand an der Tür und wimmelte einen Mann ab, der wichtige Reisende für das Fernsehen interviewte: »Tut mir leid, alter Knabe … hab mein Make-up vergessen, haha.« Niemand mochte die Witze von Mr. McNeil, die einzigen, bei denen er damit ankam, waren andere Männer sowie Miss Seed: und das nur, behauptete Lucy, weil Miss Seed in ihn verliebt war. Der Dackel zerriss die Strümpfe einer Photographin, die Lucy in ihrer steifsten Zeitschriftenpose ablichtete: »Was haben wir drüben vor?«, sagte Lucy, die Frage des Reporters wiederholend. »Also, ich weiß nicht genau. Wir besitzen ein Haus in Cannes, das wir seit dem Krieg nicht mehr gesehen haben; da werden wir wohl Halt machen. Und Einkäufe machen; natürlich werden wir Einkäufe machen.« Sie hüstelte verlegen. »Aber hauptsächlich geht es um die Schiffsreise. Nichts weckt die Geister wie eine Sommerpassage.«
Peter Bell stahl den Champagner und entführte Grady hinauf durch die Salons bis auf ein offenes Deck, wo Passagiere, die mit ihren Abschiedsbesuchern vor der Skyline der City promenierten, sich bereits stolz den wiegenden Seemannsgang angeeignet hatten. Ein einsames Kind stand an der Reling und warf traurig Konfettiwolken in die Luft: Peter bot ihm einen Schluck Champagner an, aber die Mutter des Kindes, eine Riesin von ungewöhnlichem Körperbau, nahte mit donnernden Schritten und trieb sie in die Flucht zu dem Deck mit den Hundezwingern. »Oh je«, sagte Peter, »von der bösen Familie in die Hundehütte verbannt: ist das nicht immer unser Los?« Sie kauerten sich an einem sonnigen Plätzchen zusammen; es war so verborgen wie das Versteck eines blinden Passagiers, ein sehnsüchtiges Röhren aus den Schornsteinen klagte durchdringend, und Peter sagte, wie wundervoll es wäre, wenn sie einschliefen und erst aufwachten, wenn die Sterne am Himmel stünden und das Schiff auf hoher See wäre. Als sie vor Jahren über die Strände von Connecticut gelaufen waren und auf den Sund geblickt hatten, da hatten sie ganze Tage damit zugebracht, ausführliche und abenteuerliche Pläne zu schmieden: Peter hatte dabei immer eine ernste Begeisterung an den Tag gelegt, er schien fest zu glauben, dass ein Schlauchboot sie bis nach Spanien tragen würde, und etwas von dem alten Ton schwang jetzt in seiner Stimme mit. »Wahrscheinlich ist es nur gut, dass wir keine Kinder mehr sind«, sagte er und teilte den letzten Rest Champagner mit ihr, »das wäre wirklich zu elend. Aber ich wünschte, wir wären noch Kinder genug, um auf diesem Schiff zu bleiben.«
Grady streckte die nackten braunen Beine aus und warf den Kopf in den Nacken. »Dann würde ich an Land schwimmen.«
»Vielleicht kenne ich dich nicht mehr so gut wie früher. Ich bin viel weg gewesen. Aber wie kannst du Europa ausschlagen, McNeil? Oder ist das unverschämt? Ich meine, mische ich mich in dein Geheimnis ein?«
»Es gibt kein Geheimnis«, sagte sie, teils verärgert, teils beschwingt von dem Wissen, dass es vielleicht doch eins gab. »Kein richtiges. Es ist mehr, na ja, eine Heimlichkeit, eine kleine Heimlichkeit, die ich gerne noch eine Weile hüten würde, nicht für immer, aber eine Woche, einen Tag, nur ein paar Stunden: weißt du, so, wie man ein Geschenk in der Schublade verwahrt: man muss es bald genug fortgeben, aber eine Weile noch möchte man es ganz für sich haben.« Obwohl sie ihr Gefühl unbeholfen ausgedrückt hatte, warf sie einen Blick in Peters Gesicht, überzeugt, dort eine Spiegelung des altgewohnten Verständnisses zu finden; aber sie entdeckte nur eine beunruhigende Abwesenheit jeglichen Ausdrucks: er wirkte ausgeblichen, als habe die plötzliche Einwirkung des Sonnenlichts ihn aller Farbe beraubt, und da sie plötzlich merkte, dass er ihre Worte gar nicht gehört hatte, tippte sie ihm auf die Schulter. »Ich habe mich gefragt«, sagte er blinzelnd, »ich habe mich gefragt, ob Unbeliebtheit nicht am Ende doch noch belohnt wird?«
Das war eine Frage mit einer Vorgeschichte; aber Grady, die von Peters eigenem Leben die Antwort darauf erhalten hatte, war überrascht, sogar ein wenig erschrocken, hören zu müssen, dass er sie so wehmütig stellte, ja dass er sie überhaupt stellte. Peter war nie beliebt gewesen, so viel war richtig, weder in der Schule noch im Club, noch bei irgendjemandem von den Leuten, zu deren Bekanntschaft, wie er es ausdrückte, sie verurteilt waren; dabei hatte gerade das dazu geführt, dass sie sich miteinander verschworen hatten, denn Grady, der wenig an all dem lag, liebte Peter und hatte sich ihm in seinem abseitigen Reich angeschlossen, ganz als gehörte sie dort aus demselben Grunde hin wie er: Peter seinerseits hatte ihr eingeredet, sie sei ebenso unbeliebt wie er: sie seien zu edel, es sei nicht ihre Zeit, diese Ära der Jugendlichkeit, man werde sie beide, sagte er, erst in Zukunft zu schätzen wissen. Grady hatte das nie beschäftigt; in diesem Sinne war sie nie unbeliebt gewesen, erkannte sie, als sie an das zurückdachte, was ihr jetzt wie ein lächerliches Problem vorkam: sie hatte einfach nie irgendwelche Anstrengungen dafür unternommen oder tief empfunden, dass es wichtig war, gemocht zu werden. Wohingegen das für Peter von größter Bedeutung gewesen war. Ihre ganze Kindheit hindurch hatte sie ihrem Freund dabei geholfen, eine schützende, wenn auch zugige Sandburg zu errichten. Solche Sandburgen müssen irgendwann durch natürliche und erfreuliche Prozesse zerfallen. Dass die seine für Peter immer noch existierte, war schlicht außergewöhnlich. Auch wenn Grady immer noch Verwendung hatte für die Sammlung der nur für sie beide lustigen Stichwörter, für die traurigen Anekdoten und zärtlichen Wortprägungen, die sie miteinander teilten, so mochte sie sich doch an der Sandburg nicht mehr beteiligen: jene gelobte Stunde, der goldene Augenblick, den Peter versprochen hatte, wusste er nicht, dass der jetzt da war?
»Ich weiß«, sagte er, als habe er ihren Gedanken erraten und antworte jetzt darauf. »Trotzdem.« Ich weiß. Trotzdem. Er seufzte über sein Motto. »Du hast wahrscheinlich gedacht, ich mache Witze. Über die Universität. Aber ich bin wirklich rausgeflogen; nicht, weil ich das Falsche gesagt habe, sondern weil ich vielleicht das zu Richtige gesagt habe: beides ist offenbar unerwünscht.« Die Ausgelassenheit, die ihm so gut stand, ließ sein Schalksgesicht wieder zum Vorschein kommen. »Ich bin froh über dich«, sagte er unerklärlicherweise, aber mit solch einem Schwall von Wärme, dass Grady die Wange an sein Gesicht drückte. »Wenn ich sagen würde, ich liebe dich, dann wäre das inzestuös, nicht wahr, McNeil?« Alle-an-Land-Gongs hallten durch das Schiff, und Schatten, die plötzlich aus grauen Wolken fielen, häuften sich wie Asche auf dem Deck. Grady verspürte für einen Augenblick den sonderbarsten Verlust: der arme Peter, er kannte sie noch weniger als Apple, wurde ihr bewusst, und doch, weil er ihr einziger Freund war, wollte sie ihm sagen: nicht jetzt, irgendwann. Und was würde er sagen? Weil er Peter war, vertraute sie darauf, dass er sie noch mehr lieben würde: wenn nicht, dann mochte das Meer ihre Sandburg verschlingen, nicht die, die sie gebaut hatten, um das Leben fernzuhalten, die war schon verschwunden, wenigstens für sie, sondern eine andere, diejenige, die Freundschaften und Versprechen beschützt.
Als die Sonne sich bedeckt hatte, stand er auf und zog sie mit den Worten auf die Beine: »Und wo werden wir heute Abend feiern?«, aber Grady, die ihm jeden Augenblick erklären wollte, dass sie die Verabredung mit ihm nicht einhalten konnte, kam nicht dazu, denn als sie die Treppe hinuntergingen, rief ihnen ein Steward blechern mit glänzendem Gong seine Warnung zu, und später, im Getümmel von Lucys Abschied, vergaß sie es ganz.
Mit flatterndem Taschentuch hektisch ihre Töchter umarmend, folgte Lucy ihnen zur Gangway; sobald sie beide an den Segeltuchtunnel gebracht hatte, eilte sie hinaus aufs Deck und hielt nach ihnen hinter dem grünen Zaun Ausschau; als sie die beiden erblickte, eng zusammengedrängt und geblendet hochschauend, fing sie an, das Taschentuch zu schwenken, um ihnen zu zeigen, wo sie war, aber ihr Arm wurde seltsam schwach, und überwältigt von einem Schuldgefühl der Unvollständigkeit, etwas unbeendet, ungetan gelassen zu haben, ließ sie ihn sinken. Das Taschentuch wanderte ernsthaft zu ihren Augen, und das Bild von Grady (sie liebte sie! Bei Gott, sie hatte Grady so sehr geliebt, wie das Kind es zugelassen hatte) wellte sich und verschwamm; es hatte gramerfüllte Tage, schwere Tage gegeben, und obwohl Grady so verschieden von ihr war, wie sie von ihrer eigenen Mutter gewesen war, halsstarrig und härter, war sie trotzdem noch keine Frau, sondern ein Mädchen, ein Kind, und es war ein schrecklicher Fehler, sie konnten sie nicht hierlassen, sie konnte ihr Kind nicht unfertig, unvollständig lassen, sie musste sich beeilen, sie musste Lamont sagen, dass sie nicht fahren durften. Aber bevor sie sich regen konnte, hatte er die Arme um sie gelegt; er winkte zu den Kindern hinunter; und dann winkte auch sie.
KAPITEL 2
Der Broadway ist eine Straße; er ist auch ein Stadtviertel, eine Atmosphäre. Seit Grady dreizehn war, hatte sie jede Woche, auch in all den Wintern von Miss Risdales Unterricht, und sogar, wenn das bedeutete, die Schule zu schwänzen, was oft der Fall war, heimliche Expeditionen in diese Atmosphäre unternommen, wobei sie anfänglich von den Big Bands im Paramount und im Strand angezogen wurde, von ausgefallenen Filmen, die nie in die Lichtspielhäuser östlich der Fifth Avenue gelangten oder gar nach Stamford und Greenwich. Im letzten Jahr jedoch war sie lieber nur herumgelaufen oder an Straßenecken stehen geblieben, umspült von zahllosen Passanten. Sie verharrte den ganzen Nachmittag lang und manchmal, bis es dunkel wurde. Aber es wurde dort nie dunkel: die Lichter, die den ganzen Tag über gebrannt hatten, färbten sich gelb in der Dämmerung und weiß in der Nacht, und die Gesichter, all diese traumverfangenen Gesichter, gaben dann mehr als sonst von sich preis. Anonymität machte einen Teil des Reizes aus, sie fühlte sich dann nicht mehr als Grady McNeil, doch gleichzeitig wusste sie nicht, wer an ihrer Stelle dort stand, und die höchsten Flammen ihrer Erregung entsprangen einem Brennstoff, den sie nicht zu benennen vermochte. Sie sagte niemandem etwas von den perlenäugigen Negern, von den Männern in Seiden- oder Matrosenhemden, muskelbepackt oder mit bleichen Zähnen und lavendelfarbenen Anzügen, von den Männern, die lugten, lächelten, hinterherkamen: wo soll’s denn langgehen? Manche Gesichter, wie das der Frau, die in Nicks Spielhalle das Geld wechselte, sind Gesichter, die nirgendwohin gehören, sind grüne Schatten unter grünen Augenschirmen, einbalsamierte Abendmumien, die in der karamellsüßen Luft schweben. Los, schnell. Lautsprecher in den Eingängen, die das triste Dröhnen von Rhythmen hektisch ins grelle Licht schleudern, hetzen die Sinne in die Ohnmacht: lauf – hinaus aus dem weißen Schein in die wirkliche, die heimelige Dunkelheit ohne Sex, ohne Jazz: von diesen berauschenden Schrecknissen hatte sie niemandem erzählt.
In einer Seitenstraße vom Broadway und nicht weit vom Roxy lag ein bewachter Parkplatz. Eine unbelebte, scheinbar brach liegende Fläche, erlaubte er den einzigen freien Blick in einem Häuserblock mit Flohkinos und Stundenhotels. An der Einfahrt befand sich ein Schild mit der Aufschrift Nemo-Parkplatz. Er war teuer und eigentlich ungünstig gelegen, aber schon seit einigen Monaten, nachdem die McNeils ihre Wohnung geschlossen und das Haus in Connecticut geöffnet hatten, stellte Grady ihr Auto jedes Mal, wenn sie in die Stadt fuhr, dort ab.
Irgendwann im April hatte ein junger Mann die Stelle des Parkplatzwächters übernommen. Sein Name war Clyde Manzer.
Noch bevor Grady den Parkplatz erreichte, hielt sie nach ihm Ausschau: an ruhigen Vormittagen spazierte er manchmal in der Gegend umher oder setzte sich in einen Automatenimbiss und trank Kaffee. Aber er war nirgendwo zu sehen; auch nicht, als sie auf dem Parkplatz anlangte. Es war Mittag, und vom Boden stieg heißer Benzingestank auf. Obwohl er offensichtlich nicht da war, überquerte sie den Platz und rief ungeduldig seinen Namen; die Erleichterung von Lucys Abfahrt, das Jahr oder die Stunde Wartezeit bis zum Wiedersehen mit ihm, all die Dinge, die sie durch den Vormittag getragen hatten, schienen plötzlich in einem gähnenden Loch unter ihr verschwunden zu sein; sie gab es schließlich auf und stand still verzweifelt in der gleißenden Glut. Dann fiel ihr ein, dass er manchmal in einem der Wagen ein Nickerchen machte.
Ihr eigener Wagen, ein blaues Buick-Kabriolett mit ihren Initialen auf dem Connecticut-Nummernschild, war der letzte in der Reihe, und während sie noch weit davor nach ihm Ausschau hielt, begriff sie, dass sie ihn dort finden würde. Er schlief auf dem Rücksitz. Obwohl das Verdeck aufgeklappt war, hatte sie ihn vorher nicht gesehen, denn er hatte sich tief hineingekauert. Das Radio verbreitete murmelnd die Nachrichten des Tages, und in seinem Schoß lag ein aufgeschlagener Kriminalroman. Von vielen magischen Momenten ist einer, den Geliebten schlafen zu sehen: frei von Wahrnehmung und Wahrgenommenwerden, hält man für einen süßen Augenblick sein Herz; hilflos, und so ist er dann, wie vernunftwidrig auch immer, all das, wofür man ihn gehalten hat, männlich rein, kindlich zart. Grady beugte sich über ihn, ihre Haare fielen ihr ein wenig in die Augen. Der junge Mann, den sie betrachtete, war jemand von etwa dreiundzwanzig Jahren, weder hübsch noch hässlich; es wäre sogar schwer gefallen, durch die Straßen New Yorks zu laufen und nicht alle paar Schritte junge Männer zu sehen, die ihm ähnelten, obwohl er, da er den ganzen Tag an der frischen Luft verbrachte, wesentlich wettergebräunter war als die meisten. Aber er erweckte den Eindruck von wohlgestalteter Geschmeidigkeit, und seine Haare, schwarz mit kleinen Löckchen, passten ihm wie eine eng anliegende Persianerkappe. Seine Nase war leicht gebrochen, und das verlieh seinem Gesicht, das bei all seiner rustikalen Röte nicht ohne eine gewisse scharfsinnige Kraft war, eine übertriebene Männlichkeit. Seine Augenlider zitterten, und Grady, die spürte, wie sein Herz durch ihre Finger glitt, erwartete angespannt, dass sie sich öffneten. »Clyde«, flüsterte sie.
Er war nicht ihr erster Geliebter. Vor zwei Jahren, als sie mit sechzehn das Auto bekommen hatte, war sie mit einem zurückhaltenden jungen Paar aus New York, das sich nach einem Haus umsah, in Connecticut herumgefahren. Als sie dann schließlich das Haus fanden, ein kleines, nettes auf dem Gelände eines Country-Clubs gleich neben einem kleinen See, waren sie, die Boltons, von ihr hingerissen, und Grady schien ihrerseits vernarrt zu sein: sie überwachte den Umzug, sie legte ihren Steingarten an, fand für sie ein Hausmädchen, und an den Samstagen spielte sie mit Steve Golf oder half ihm beim Rasenmähen: Janet Bolton, ein zurückhaltendes, harmloses, hübsches Mädchen frisch aus Bryn Mawr, war im fünften Monat schwanger und so allen Anstrengungen abgeneigt. Steve war Rechtsanwalt, und da er bei einer Kanzlei arbeitete, die für ihren Vater tätig war, wurden die Boltons oft nach Old Tree eingeladen, dies der Name, mit dem die McNeils ihr Anwesen versehen hatten: Steve benutzte den dortigen Swimmingpool und die Tennisplätze, und Mr. McNeil überließ ihm mehr oder weniger zur eigenen Benutzung eine kleine Wohnung, die Apple gehört hatte. Peter Bell war ziemlich ratlos; ebenso wie Gradys wenige übrige Freunde, denn sie war nur noch mit den Boltons zusammen, oder, aus ihrer Sicht, nur noch mit Steve; und als ob all die Zeit, die sie gemeinsam verbrachten, nicht genügte, gewöhnte sie sich an, hin und wieder in seinem Morgenzug mit ihm in die City zu fahren. Um sich bis zur abendlichen Zugfahrt mit ihm nach Hause die Zeit zu vertreiben, spazierte sie von einem Broadway-Film in den nächsten. Doch sie fand keinen Frieden; sie konnte nicht verstehen, warum die Freude, die sie anfangs empfunden hatte, zu Schmerz geworden war und nun zu Qual. Er wusste es. Sie war überzeugt, dass er es wusste; seine Augen, die ihr folgten, wenn sie ein Zimmer durchquerte, wenn sie im Swimmingpool auf ihn zu schwamm, jene Augen wussten es und waren nicht unzufrieden: und so lernte sie, verbunden mit ihrer Liebe, auch etwas über den Hass, denn Steve Bolton wusste es und tat nichts, um ihr zu helfen. In jener Zeit war jeder Tag widerborstig, ein Zertreten von Ameisen, ein Ausreißen von Glühwürmchenflügeln, Wutanfälle, so schien es, gegen alles, was so hilflos war wie ihr hilfloses und verschmähtes Ich. Und sie ging dazu über, die dünnsten Kleider zu tragen, die sie auftreiben konnte, Kleider, so dünn, dass jeder Blattschatten oder Windhauch eine Kühle war, die sie streichelte; aber sie mochte nichts essen, sie wollte nur Coca-Cola trinken und Zigaretten rauchen und in ihrem Auto fahren, und sie wurde so flach und hager, dass die dünnen Kleider um sie herumflatterten.
Steve Bolton hatte die Angewohnheit, vor dem Frühstück in dem kleinen See bei seinem Haus schwimmen zu gehen, und Grady, die das entdeckt hatte, musste immer wieder daran denken: sie wachte morgens mit seinem Bild vor Augen auf, sah ihn am Rande des Sees im Ried stehen wie einen seltsamen, morgenrotgoldenen Vogel. Eines Morgens ging sie dorthin. Ein kleines Kieferngehölz wuchs unweit vom See, und dort versteckte sie sich, lag bäuchlings auf den taufeuchten Nadeln. Trüber Herbstnebel trieb auf dem See: natürlich kam er nicht, sie hatte zu lange gewartet, der Sommer war vergangen, ohne dass sie es auch nur gemerkt hatte. Dann sah sie ihn auf dem Weg: gelassen, pfeifend, in der einen Hand eine Zigarette, in der anderen ein Handtuch; er war nur mit einem Morgenmantel bekleidet, den er, als er den See erreichte, auszog und auf einen Felsblock warf. Es war, als sei endlich ihr Stern herabgefallen, einer, der beim Aufprall auf die Erde nicht schwarz wurde, sondern nur noch blauer brannte: halb kniete sie jetzt, mit vorgestreckten Armen, als wollte sie ihn berühren, begrüßen, während er hineinwatete und zugleich, so schien es, märchenhafte Größe annahm, zu ihr emporragte, bis er ohne jede Warnung in die Tiefe sank und hinter dem Ried verschwand: Grady, die trotz allem unwillkürlich aufschrie, schlüpfte hinter einen Baum, den sie umarmte, als wäre der ein Teil seiner Liebe, ein Teil seiner Herrlichkeit.
Janet Boltons Baby wurde am Ende der Saison geboren: in der fasanengesprenkelten Herbstwoche, bevor die McNeils Old Tree schlossen und wieder in ihre Winterresidenz in der Stadt zogen. Janet Bolton war ziemlich verzweifelt; sie hatte das Baby zwei Mal fast verloren, und ihre Haushaltshilfe war, nachdem sie einen Tanzwettbewerb gewonnen hatte, immer respektloser geworden: meistens erschien sie erst gar nicht, so dass, wäre Grady nicht gewesen, Janet nicht gewusst hätte, was sie anfangen sollte. Grady kam öfter vorbei und bereitete einen Imbiss zu und wischte rasch Staub; eine Pflicht gab es, der sie sich mit Hingabe annahm: sie sammelte gern Steves Wäsche ein und hing seine Sachen auf. An dem Tag, an dem das Baby geboren wurde, fand sie Janet zusammengekrümmt und schreiend vor. Jedes Mal, wenn ein Grund dazu vorlag, war Grady stets wieder überrascht, wie liebevoll besorgt ihre Gefühle für Janet waren: ein Nichts von einer Person, wie eine Muschel, die vielleicht aufgehoben und wegen ihrer geriffelten rosa Vollkommenheit aufbewahrt wird, aber nie einen Platz unter den wahren Schätzen eines Sammlers erhalten wird: Unwichtigkeit machte ihren Reiz aus und bildete zugleich ihren Schutz, denn es war unmöglich, stellte jedenfalls Grady fest, sich von ihr bedroht zu fühlen oder auf sie eifersüchtig zu sein. An jenem Morgen jedoch, als Grady das Haus betrat und sie schreien hörte, empfand sie eine Genugtuung, die, auch wenn sie nicht grausam gemeint war, sie zumindest daran hinderte, ihr sofort zu Hilfe zu kommen, denn es war, als gelangten all die Qualen, die sie selbst kannte, in diesen Momenten von Janet Boltons Martyrium zu triumphalem Ausdruck. Als sie sich schließlich dazu durchrang, die notwendigen Dinge zu tun, tat sie sie sehr gut; sie rief den Arzt, brachte Janet ins Krankenhaus und rief dann Steve in New York an.
Er kam mit dem nächsten Zug; es war ein beklommener Nachmittag, den sie miteinander im Krankenhaus verbrachten; es wurde Abend, und immer noch nichts, und Steve, der mit Grady ein paar Scherze, ein Spiel Herz-Ramsch zustande gebracht hatte, zog sich in eine Ecke zurück und ließ Schweigen sich zwischen ihnen breitmachen. Eine schale Verzweiflung von Zugfahrplänen und Geschäften und unbezahlten Rechnungen schien von ihm aufzusteigen wie müder Staub, er saß da und blies Rauchringe, Nullen, so hohl, wie Grady sich inzwischen fühlte … es war, als krümmte sie sich von ihm fort in den leeren Raum, als wiche sein Bild am See vor ihr zurück, bis sie ihn jetzt sehen konnte, wie er wirklich war, ein Anblick, der sie mehr rührte als alle anderen, denn mit den erschöpft gebeugten Schultern und der Träne im Augenwinkel gehörte er zu Janet und ihrem Kind. In dem Wunsch, ihm ihre Liebe zu zeigen, nicht als Geliebtem, sondern als von Liebe und Geburt niedergedrücktem Mann, ging sie zu ihm. Eine Krankenschwester war an die Tür gekommen; und Steve Bolton hörte von seinem Sohn ohne irgendeine Veränderung in seinem Gesichtsausdruck. Langsam erhob er sich, bis er aufrecht stand, die Augen blind-bleich; und mit einem Seufzer, der den Raum ins Wanken brachte, fiel sein Kopf nach vorn auf Gradys Schulter: ich bin ein sehr glücklicher Mann, sagte er. Das war es, mehr wollte sie von ihm nicht, die Sehnsüchte des Sommers waren vergangen zu Wintersamen: Winde wehten sie weit fort, bevor ein neuer April ihre Blüte brach.
»Los, steck mir eine Zigarette an.« Clyde Manzers Stimme, knurrig vom Schlaf, aber immer etwas heiser und belegt, hatte eine bestimmte Eigenschaft: alles, was er sagte, machte einen gewissen Eindruck, denn eine murmelnde Kraft, gedämpft wie ein Motor im Leerlauf, durchzog jede Silbe mit der Lunte der Männlichkeit; trotzdem stolperte er über Wörter, Pausen zertrennten manche Sätze, so dass aller Sinn sich verflüchtigte. »Sabber sie nicht voll, Kleines. Du sabberst sie immer voll.« Die Stimme, obwohl auf ihre Art attraktiv, konnte täuschen: ihretwegen hielten einige ihn für dumm: was nur bewies, welch schlechte Beobachter sie waren: Clyde Manzer war überhaupt nicht dumm: seine spezielle Klugheit war sogar die alleroffensichtlichste. Das schlichte Stipendium, das zu einem Diplom in Alltagsbewältigung führt – wohin laufen, wo verstecken, wie U-Bahn fahren und ins Kino gehen und einen Münzfernsprecher benutzen, ohne etwas zu bezahlen –, die Kenntnisse, die einhergehen mit einer Großstadtkindheit der Bandenkriege und verzweifelten Nachmittage, wenn nur die Grausamen und Schlauen, die Schnellen, die Tapferen überleben – das war die Ausbildung, die seinen Augen die bewegliche Ausdruckskraft verlieh. »Bah, du hast sie vollgesabbert. Verdammt, ich hab’s ja gewusst.«
»Ich werde sie rauchen«, sagte Grady; und mit dem Feuerzeug, das Peter so geschmacklos fand, zündete sie ihm eine neue an. An einem Montag, Clydes freiem Tag, waren sie zu einer Schießbude gegangen, und er hatte dort das Feuerzeug gewonnen und ihr geschenkt: seitdem zündete sie gern allen die Zigarette an: es erregte sie, zu sehen, wie ihr Geheimnis, kaschiert als dünne Flamme, zwischen ihr, die es kannte, und jemand anders, der es entdecken konnte, nackt emporschoss.
»Danke, Kleines«, sagte er und nahm die neue Zigarette an. »Du bist ein braves Mädchen: du hast sie nicht vollgesabbert. Ich hab bloß schlechte Laune, weiter nichts. Ich darf eben nicht so schlafen. Ich hab wieder was geträumt.«
»Hoffentlich bin ich drin vorgekommen.«
»Ich erinnere mich nie an meine Träume«, sagte er und rieb sich das Kinn, als müsse er sich rasieren. »Dann erzähl mal, hast du sie weggebracht, deine Familie?«
»Gerade eben – Apple wollte, dass ich sie nach Hause fahre, und ein alter Freund ist aufgetaucht; es war ein einziges Durcheinander, ich bin direkt vom Pier hergekommen.«
»Ein alter Freund von mir, wär schön, wenn der auftaucht«, sagte er und spuckte auf den Boden. »Mink, kennst du Mink? Ich hab dir von ihm erzählt, das ist der, mit dem ich beim Militär war. Wegen dem, was du mir gesagt hast, hab ich ihm gesagt, er soll vorbeikommen und den Nachmittag heute übernehmen. Der Mistkerl schuldet mir zwei Dollar: ich hab ihm gesagt, wenn er vorbeikommt, dann ist das vergessen. Also, Baby«, seine ausgestreckte Hand berührte die kühle Seide ihrer Bluse, »wenn er nicht auftaucht«, und glitt dann mit sanftem Druck zu ihrer Brust, »dann hänge ich hier fest.« Sie betrachteten einander schweigend, so lange, wie ein Schweißtropfen brauchte, um an seiner Stirn und dann an seiner Wange hinunterzulaufen. »Du hast mir gefehlt«, sagte er. Und er hätte noch mehr gesagt, wenn nicht Kundschaft auf den Parkplatz eingebogen wäre.
Drei Damen aus Westchester, in der Stadt zu einem Imbiss und einer Nachmittagsvorstellung; Grady setzte sich ins Auto und wartete, während Clyde sie abfertigte. Sie mochte die Art, wie er ging, die Art, wie seine Beine sich Zeit zu lassen schienen, jeder Schritt langsam ausgreifend und ruhig federnd: der Gang eines groß gewachsenen Mannes. Dabei war Clyde nicht viel größer als sie. Auf dem Parkplatz trug er immer eine Sommerkhakihose und ein Flanellhemd oder einen alten Sweater: Kleidung, die viel besser aussah und weitaus besser zu ihm passte als der Anzug, auf den er so stolz war. Diesen Anzug, einen blauen Zweireiher mit Nadelstreifen, trug er meistens, wenn er in ihren Träumen erschien; sie konnte sich gar nicht vorstellen, warum; aber schließlich waren ihre Träume von ihm ohnehin unsinnig. Darin war sie fortwährend die Zuschauerin, und er war mit jemand anders zusammen, einem anderen Mädchen, und sie gingen an ihr vorbei, feixten verächtlich oder taten sie ab, indem sie wegschauten: die Demütigung war groß, ihre Eifersucht noch größer, es war unsinnig; trotzdem hatte sie Grund zur Besorgnis: zwei- oder dreimal war sie sicher gewesen, dass er mit ihrem Auto weggefahren war, und einmal, nachdem sie das Auto über Nacht dort gelassen hatte, hatte sie zwischen den Polstern eine protzige kleine Puderdose gefunden, die ganz bestimmt nicht ihr gehörte. Aber zu Clyde sagte sie nichts von diesen Dingen; sie behielt die Puderdose und sprach nie davon.
»Bist du nicht Manzers Freundin?« Sie hatte im Radio nach Musik gesucht; sie hatte niemanden näher kommen hören, und deshalb erschrak sie, als sie aufblickte und sah, dass ein Mann am Auto lehnte, die Augen auf sie gerichtet und den halben Mund zu einem Lächeln verzogen, das einen Gold- und einen Silberzahn freilegte. »Ich hab gesagt, du bist doch Manzers Freundin, hm? Wir haben das Photo von dir in der Illustrierten gesehen. Das war ein gutes Photo. Meiner Freundin Winifred (hat Manzer dir von Winifred erzählt?), ihr hat das Photo sehr gefallen. Meinst du, der Bursche, der’s gemacht hat, würde auch eins von ihr machen? Das wär für sie eine große Sache.« Grady konnte ihn nur ansehen; und auch das kaum: denn er war wie ein fetter, schwabbeliger Säugling, der mit grotesker Plötzlichkeit zur Größe eines Ochsens gewachsen war: seine Augen standen hervor, und seine Lippen hingen herunter. »Ich bin Mink«, sagte er und holte eine Zigarette hervor, die Grady ihm anzuzünden erlaubte: sie hupte, so laut sie konnte.
Clyde ließ sich nie hetzen; nachdem er das Westchester-Auto abgestellt hatte, kam er gemächlich angeschlendert. »Was soll denn der Lärm?«, fragte er.
»Na dieser Mann, der ist da.«
»Meinst du, das seh ich nicht? Hallo, Mink.« Er wandte sich von ihr ab und widmete seine Aufmerksamkeit dem teigig lächelnden Gesicht von Mink, und Grady nahm wieder ihre Suche im Radio auf: selten schnappte sie bei dem, was Clyde sagte, rasch ein. Seine Grantigkeit bewirkte bei ihr lediglich, dass sie sich ihm näher fühlte, denn dass er seiner schlechten Laune ihr gegenüber so freien Lauf ließ, machte nur deutlich, wie nahe sie sich standen. Sie hätte es jedoch vorgezogen, wenn für dieses Ochsenkind nichts deutlich geworden wäre: bist du nicht Manzers Freundin? Sie hatte sich vorgestellt, dass Clyde mit seinen Freunden über sie redete, ihnen sogar ihr Photo in der Illustrierten zeigte, das war in Ordnung, warum nicht? Andererseits hatte ihre Vorstellungskraft nicht so weit gereicht, in Betracht zu ziehen, was das für Freunde sein mochten. Aber jetzt war es ein bisschen zu spät, um sich aufs hohe Ross zu schwingen, also versuchte sie lächelnd, Mink hinzunehmen, und sagte: »Clyde hatte schon Angst, du könntest vielleicht nicht kommen. Es ist sehr nett von dir, das für uns zu tun.«
Mink strahlte, als hätte sie auf einen Lichtschalter in ihm gedrückt; was peinlich war, denn an dem neuen Leben in seinem Gesicht erkannte sie, er hatte gemerkt, dass sie ihn nicht mochte, und es hatte ihm etwas ausgemacht. »Aber klar doch, ich lass doch Manzer nicht im Stich. Ich wär ja schon eher hier gewesen, bloß Winifred, du weißt schon, Winifred, die ist gerade in Streik getreten, und sie hat mich dazugeholt, damit ich denen da oben mal die Meinung geige (Entschuldigung).« Gradys Blicke irrten unruhig zu dem kleinen Schuppen mit dem Nemo-Büro: Clyde war darin verschwunden, um sich umzuziehen, und sie wartete ungeduldig auf seine Rückkehr, denn es war nicht nur nervtötend, mit Mink allein zu sein, sondern, und das traf vor einer Minute ebenso zu wie vor einer Woche, sie sehnte sich nach ihm. »Fabelhaftes Auto hast du, ehrlich. Winifreds Onkel, das ist der in Brooklyn, der kauft gebrauchte Autos: ich wette, er würde dir einen Batzen dafür geben. He, wir müssen uns alle vier mal für einen Abend verabreden: zum Tanzen ausgehen, weißt du, was ich meine?«
Clydes Wiedererscheinen nahm ihr die Antwort ab. Unter einer ledernen Windjacke hatte er ein sauberes weißes Hemd und eine Krawatte angelegt; es gab einen Versuch zu einem Scheitel in seinen Haaren, und seine Schuhe waren geputzt. Er pflanzte sich vor ihr auf, die Augen zur Seite gerichtet, die Hände in die Hüften gestützt: das grelle Sonnenlicht zwang ihn, die Stirn zu runzeln, aber seine ganze Haltung schien zu sagen: wie sehe ich aus? Und Grady sagte: »Liebling, du siehst einfach wundervoll aus!«
KAPITEL 3
Es war ihre Idee gewesen, mit ihm im Central Park in dem Selbstbedienungsrestaurant neben dem Zoo essen zu gehen. Da die Wohnung der McNeils in der Fifth Avenue und fast gegenüber dem Zoo lag, hatte sie dieses Lokal seit langem über, aber heute, beflügelt von der ungewohnten Aussicht, im Freien zu essen, kam ihr das festlich vor; darüberhinaus würde es für Clyde etwas ganz Neues sein, denn bestimmte Bezirke der Stadt waren weiße Flecke auf seiner Landkarte: das ganze Gebiet zum Beispiel, das um das Plaza herum beginnt und sich nach Norden und Osten erstreckt. Diese Welt östlich vom Park war natürlich das New York, das Grady am besten kannte: abgesehen vom Broadway hatte sie sich nicht oft daraus hinaus gewagt. Und so hatte sie es für einen Witz gehalten, als Clyde sagte, er habe nicht mal gewusst, dass es im Central Park einen Zoo gebe; zumindest könne er sich an keinen erinnern. Diese Wissenslücken vertieften das große Rätsel seines Milieus; sie wusste, wie groß seine Familie war und wie alle hießen: da gab es die Mutter, zwei Schwestern, die arbeiteten, und einen jüngeren Bruder – der Vater, ein Polizist, war schon tot; und sie wusste ungefähr, wo sie wohnten: irgendwo in Brooklyn, in einem Haus nicht weit vom Meer, und mit der U-Bahn brauchte man bis dorthin über eine Stunde. Dann gab es mehrere Freunde, deren Namen sie oft genug gehört hatte, um sie sich einzuprägen: Mink, dem sie gerade begegnet war, dann einen namens Bubble und einen dritten namens Gump; sie hatte einmal gefragt, ob das ihre richtigen Namen waren, und Clyde hatte geantwortet: klar.
Aber das Bild, das sie sich aus diesen Einzelteilen zusammengesetzt hatte, war zu stümperhaft, um auch nur den bescheidensten Rahmen zu verdienen: es mangelte ihm an Perspektive, und es zeigte wenig Begabung fürs Detail. Die Schuld daran lag natürlich bei Clyde, der einfach nicht sehr gesprächig war. Außerdem schien er fast gar nicht neugierig zu sein: Grady war von der Dürftigkeit seiner Nachfragen und der Gleichgültigkeit, die dahinterstehen mochte, manchmal so beunruhigt, dass sie ihn großzügig mit persönlichen Auskünften versorgte; was nicht heißen soll, dass sie immer die Wahrheit sagte, wie viele Verliebte tun das? oder können das?, aber zumindest gestand sie ihm genug Wahrheit zu, um ihm einen mehr oder weniger zutreffenden Einblick in jenes Leben zu geben, das sie ohne ihn geführt hatte. Sie wurde jedoch das Gefühl nicht los, dass er ihre Geständnisse lieber nicht hörte: er schien sie sich so schwer fassbar, so verschlossen zu wünschen, wie er selbst es war. Und doch konnte sie ihn nicht mit Fug und Recht beschuldigen, verschlossen zu sein: alle Fragen, die sie ihm stellte, beantwortete er: trotzdem war es wie der Versuch, durch eine Jalousie zu spähen. (Es war, als sei die Welt, in der sie sich begegneten, ein Schiff, in die Flaute geraten zwischen zwei Inseln, die sie selbst waren: ohne jede Anstrengung konnte er ihre Küste sehen, aber seine blieb verborgen im tief hängenden Nebel.) Einmal, gewappnet mit einer weit hergeholten Idee, war sie mit der U-Bahn nach Brooklyn gefahren, aus dem Gedanken, wenn sie nur das Haus sehen konnte, in dem er wohnte, und durch die Straßen laufen konnte, durch die er ging, dann würde sie ihn so verstehen und kennen, wie sie es wollte: aber sie war noch nie zuvor in Brooklyn gewesen, und die geisterhaften, menschenleeren Straßen, die Flachheit des Geländes, das sich in einem Durcheinander gleich aussehender eingeschossiger Häuser, brachliegender Grundstücke und stummen Leerstandes erstreckte, jagte ihr solche Angst ein, dass sie nach zwanzig Schritten kehrtmachte und zurück in die U-Bahn floh. Sie erinnerte sich hinterher, dass sie von Beginn an gewusst hatte, der Ausflug würde ein Reinfall werden. Vielleicht hatte Clyde, ohne bewusste Einsicht, mit dem Umfahren der Inseln und der Einsamkeit des Schiffes die beste Wahl getroffen: aber ihre Reise schien keinerlei Zielhafen zu haben; und während sie auf der Terrasse der Gaststätte im Schatten eines Sonnenschirms saßen, hatte Grady plötzlich wieder einen Grund, die beruhigende Sicherheit von Land zu brauchen.
Sie hatte es zu einem Vergnügen machen wollen, eine Feier ihnen beiden zu Ehren, und das war es auch: die Seehunde verschworen sich, spaßig zu sein, die Erdnüsse waren heiß und das Bier kalt. Aber Clyde entspannte sich einfach nicht. Mit feierlichem Ernst widmete er sich den Pflichten eines Begleiters bei solch einem Ausflug: Peter Bell hätte aus Hohn und Spott einen Ballon gekauft: Clyde überreichte ihr einen als Teil eines altehrwürdigen Rituals. Grady fand es so rührend und dabei so lächerlich, dass sie sich eine Weile lang schämte, ihn anzusehen. Sie hielt die ganze Mahlzeit hindurch an dem Ballon fest, als sei es ihr eigenes Glück, das an der Schnur ruckte und zurrte. Am Ende der Mahlzeit jedoch sagte Clyde: »Hör mal, du weißt, ich würde gern bleiben! Nur, es ist was dazwischengekommen, und ich muss bald zu Hause sein. Ich hatte das ganz vergessen, sonst hätte ich’s dir früher gesagt.«
Grady blieb gelassen; aber sie kaute an ihrer Unterlippe, bevor sie antwortete. »Tut mir leid«, sagte sie, »das ist wirklich zu schade.« Und dann, mit einer Verärgerung, die sie nicht umleiten konnte: »Ja, ich finde wirklich, das hättest du mir früher sagen müssen. Dann hätte ich mir nicht die Mühe gemacht, etwas zu planen.«
»An was hast du denn gedacht, Kleines?« Clyde sagte es mit einem Lächeln, das ein wenig Lüsternheit preisgab: der junge Mann, der über die Seehunde lachte und Ballons kaufte, hatte ihr seine andere Seite zugekehrt, und gegen dieses neue Profil, das härtere Züge aufwies, vermochte Grady sich nie zu verteidigen: sein Draufgängertum fesselte sie, lähmte sie derart, dass sie nur noch den Wunsch verspürte, zu beschwichtigen. »Ist ja auch egal«, sagte sie und zwang sich ihrerseits zu einem lüsternen Unterton. »Es ist jetzt niemand in der Wohnung, und ich hatte gedacht, wir könnten dorthin gehen und uns etwas zu essen kochen.« Turmhoch und über das halbe Gebäude verlaufend, waren die Fenster der Wohnung, wie sie es ihm gezeigt hatte, von der Terrasse aus zu sehen. Doch schon der Vorschlag eines Besuchs dort schien ihn zu verstören: er strich sich die Haare glatt und zog den Knoten seiner Krawatte fester.
»Wann musst du nach Hause? Doch nicht gleich?«
Er schüttelte den Kopf; dann ließ er sie wissen, was sie vor allem wissen wollte, nämlich, warum er überhaupt fort musste, und sagte: »Es ist mein Bruder. Der Kleine hat seine Bar-Mizwa, und es gehört sich einfach, dass ich dabei bin.«
»Eine Bar-Mizwa? Ich dachte, das ist etwas Jüdisches.«
Starre überkam wie Schamröte sein Gesicht. Er sah nicht einmal hin, als eine dreiste Taube gemächlich einen Krümel vom Tisch aufpickte.
»Es ist doch etwas Jüdisches, nicht?«
»Ich bin Jude. Meine Mutter ist Jüdin«, sagte er.