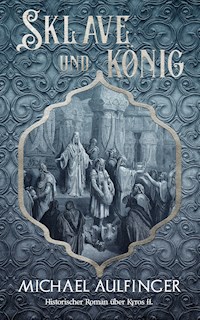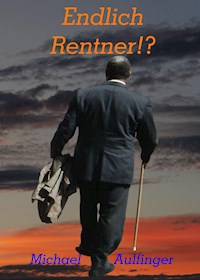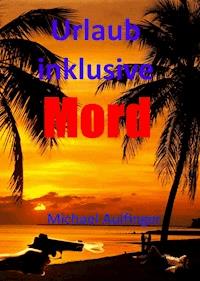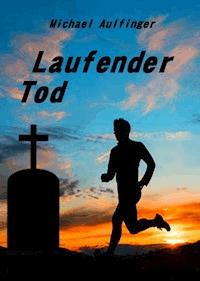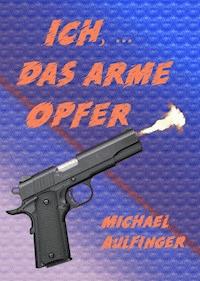
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der arbeitslose Tobias ist in großen Geldnöten. Eines Tages wird er in seinem eigenen Haus überfallen und in den Keller eingesperrt. Der Täter macht ihm dann ein Angebot, welches Tobias nicht abschlagen kann, wenn er nicht gesundheitlichen Schaden davon tragen möchte. Eine Odyssee jenseits des Gesetztes beginnt. Überraschende Wendungen und viel Ironie fesseln bis zum Ende.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Aulfinger
Ich, ... das arme Opfer
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Impressum neobooks
Kapitel 1
Es wurde sicherlich schon viel geschrieben und gesagt zum Thema Arbeitslosigkeit. Vieles daran ist hypothetisch. Die Vorstellungskraft eines in Lohn stehenden Arbeitnehmers reicht oft nicht aus, um sich die anfangenden Selbstzweifel eines Arbeitslosen vorzustellen.
Was sollte jemanden auch dazu veranlassen, sich damit zu befassen, wenn im gesamten Bekannten- und Verwandtenkreis niemand mit dem Fluch der modernen Zeit verdammt ist. Der Mensch schiebt diese Gedanken weit von sich. Bloß nicht daran denken. Verdrängen wir sie. Dies geht solange gut, bis es einen bestimmten erwischt - sich selbst. Dann ist es vorbei mit dem hypothetischem … was wäre wenn?
Nun bin ich also selbst einer von Deutschlands größtem Arbeitgeber. Ich schloß mich der Millionenhorde an. Welche Nummer habe ich eigentlich? Bin ich Nummer zweimillionenfünfhunderttausendzweihundertzwölf? Das ist mir doch egal. Allmählich macht sich Galgenhumor in mir breit. Woher kommt dies? Sollte wohl eine trotzige Reaktion auf die Situation sein, die ich zur Zeit sowieso nicht ändern kann.
Alles was ich an bürokratischen Formalitäten bisher erledigen mußte, habe ich in den vier Monaten meines bisherigen Zwangsurlaubes getan. Der Agentur für Arbeit habe ich sofort meine Situation dargelegt. Doch bei der Verabschiedung klingt der Satz Sie hören von uns, wie eine ironische Floskel, die der junge Mann auf der anderen Seite des Schreibtisches schon tausend mal sagte. Als ich das nächste Mal das Arbeitsamt aufsuchte, war ich für ein Fräulein in einem hellblauen Kleid, und mit einer Frisur bei der sie bei Rapunzel Anleihe nahm, eine Nummer unter vielen. Sie äußerte Hoffnung, vage Hoffnung. Nur nicht sofort. Ich sollte nicht den Kopf hängen lassen. Aber ich dürfe auch nicht zu viel erwarten. Es würde sich in meiner Branche schon ein brauchbarer Job finden, nur bräuchte ich noch viel Geduld. Kommt Zeit kommt Arbeit.
Die Zeitungen wurden nach entsprechenden Anzeigen durchforstet. Von alleine schrieb ich Bewerbungen an verschiedene Firmen. Bisher ohne Erfolg. Im Bekannten- und Verwandtenkreis war auch nichts zu finden. Aber dazu muß ich erklären, daß mein Verwandtenkreis sehr mickrig ist, und zwar besteht er nur aus einem Bruder, den ich selten sah, und einer Tante sowie einem Onkel, deren Gegenwart ich noch weniger ertragen möchte.
Mein Freundeskreis ist da ein wenig umfangreicher. Vor allem möchte ich meine beste Freundin Sabine erwähnen. Wir sind so gut befreundet, daß wir uns geschworen haben, niemals zusammen zu ziehen, damit wir weiterhin ein Liebespaar bleiben können. Denn tägliche gegenseitige Rücksichtnahme, wäre das Ende unseres guten Verhältnisses. Und das ist uns viel Wert. Von meinen anderen Freunden möchte ich jetzt nicht weiter erzählen. Das würde zu lange dauern, und von dem eigentlichen Grund meiner Geschichte ablenken. Denn jetzt möchte ich von jenem Tag erzählen, der mein Leben grundlegend änderte.
Hätte ich vorher gewußt, was für eine verrückte Geschichte mich an diesem Tag erwartet, hätte ich mich bei Sabine zu Hause ins Bett gelegt, und wäre die nächsten zwei Tage nicht aufgestanden. Heute wünschte ich, ich hätte es getan, und das folgende wäre nie geschehen. Aber ich habe es nicht getan, und so ist mir zwangsläufig das passiert, wovon meine Erzählung handeln wird. War es Schicksal? War es vorausbestimmt? Ich weiß es nicht, aber es würde mich reizen den Begriff, den man Schicksal nennt einmal eingehender zu untersuchen.
Jetzt drehe ich aber in Gedanken das Zeitenrad zurück, und fühle mich an den Spätsommertag zurück versetzt. Die Zeiten wandeln sich. Ich gehe in der Erinnerung zurück an den Tag, an dem alles begann.
Zu dem Zeitpunkt - es ist genau 16.38 Uhr - wo mir die Erinnerung an das Arbeitsamt einen faden Nachgeschmack hinterlässt, saß ich auf einer Parkbank. Heute morgen hatte ich es nicht mehr zu Hause ausgehalten. Die Decke wollte mir auf den Kopf fallen. Vor dem viereckigem Kasten, mit der stundenlangen audiovisuellen Berieselung, hatte ich reiß aus genommen. Auch das Buch, welches ich zur Zeit las, gab mir keine seelische Ruhe. Die Ausgeglichenheit, die Balance, fehlte mir, um einen ruhigen Tag genießen zu können. Raus, einfach raus. Unter Menschen kommen, dem Treiben zusehen, dies würde mich wohl etwas ablenken, und vielleicht auf andere Gedanken bringen. Das hoffte ich zumindest. Denn mich hatten nicht nur Selbstzweifel ergriffen. Nein, wenn es nur dieses gewesen wäre. Aber es kam noch Selbstmitleid dazu. Das war ja noch schlimmer. Ich nervte mich selber, und tat mir unendlich leid.
So saß ich nun auf dieser Parkbank. Die Arme waren links und rechts leger über die Bankrückenlehne gelegt. Mir fiel nichts anderes ein, als ziellos die vorbeischlendernden Menschen zu beobachten. Ohne viel nachzudenken saß ich herum und sah zu, wie einige spazieren gingen, und andere ihre Hunde Gassi führten. Wiederrum andere waren mit ihren Kindern unterwegs, auf dem Weg zum Spielplatz.
Die Zeit verging langsam. Zu langsam. Was sollte ich machen? Was sollte jetzt mit mir geschehen? Wie sollte es weitergehen? Fragen über Fragen, auf die ich im Moment keine Antwort wußte. Ständig kreisten meine Gedanken um das immer wiederkehrende Thema herum.
Irgendwie spürte ich, daß es mich kaputt machte. Die ersten Tage der Arbeitslosigkeit, waren noch erträglich, waren fast wie Urlaub. Die Erledigungen lenkten mich ab. Inzwischen hatte sich das geändert, denn die Gänge zum Arbeitsamt liefen immer nach dem gleichen Schema F ab, und endeten mit dem gleichen Satz. Sie hören von uns.
Meine eigene Arbeitssuche blieb erfolglos.
Langsam merkte ich, wie diese ganze derzeitige Situation an mir nagte. So konnte es nicht weitergehen. Ich machte mich noch verrückt, oder besser gesagt, ich wurde verrückt. Bald bekam ich die Erkenntnis, daß ich eine Beschäftigung schon aus seelischen Gründen dringend benötigte. Das in den Tag hinein leben war nicht mein Fall. Außerdem war meine derzeitige finanzielle Lage alles andere als rosig zu bezeichnen. Das Geld fehlte hinten und vorne. Dabei hatte ich sogar noch ein kleines Einfamilienhaus, daß mir meine Eltern hinterließen und in dem ich alleine lebte, zu unterhalten.
Doch verdrängte ich die Gedanken, die an den Geldmangel geknüpft waren wieder schnell. Ich sah die Menschen durch den Park gehen. Als ich so die Wege entlang blickte, wurde mir eins bewußt. Jedes Individuum, jede Person die an mir vorbei ging, hat seine eigene Geschichte, und seine eigenen Probleme. Oder soll ich sie Schwierigkeiten nennen? Ob diese Probleme schwerwiegender als meine waren, konnte mir im Moment keiner sagen. Ansichtssache. Das kommt auf den Blickwinkel an. Vollkommen relativ.
Allmählich begann ich mich zu langweilen. Die Menschen zu beobachten, lieferte mir auch nicht die seelische Befriedigung, die ich mir erhoffte. Der Hunger meldete sich. Auch wenn man kein Geld hat, ist der Hunger trotzdem da. Oder gerade erst dann. Dann spürt man ihn besonders intensiv. Das sind Lebenserfahrungen, die ich bisher nicht so ausgeprägt kannte, und mir deshalb jetzt in das Bewußtsein kamen. Ich hatte immer gutes Geld verdient, brauchte nie Hunger leiden. Doch jetzt kam diese Erfahrung hinzu.
Ein Rentner ging mit seinem watschelnden Dackel vorbei. Als er um die Ecke bog, stand ich auf. Es ging dem Abend zu, und der Hunger wollte besänftigt werden. Die zwei Kilometer bis zu meinem Haus ging ich zu Fuß. Ein Auto besaß ich zur Zeit nicht, und die Buslinie verkehrte nicht in diese Richtung. Denn ich wohnte am Stadtrand.
Mechanisch sah ich auf meine Uhr. Es war inzwischen fünf Uhr Nachmittags. Aber so richtig hatte ich die Uhrzeit nicht wahrgenommen. Wie in Trance ging ich die Königstraße entlang. An der Kreuzung zur Possehlstraße bog ich ab. Dort lag mein Haus. Oder besser gesagt, daß Haus meiner Eltern, daß ich nach dem Tod meines Vaters vor zwei Jahren geerbt hatte. Langsam ging ich auf das Haus zu. Wir Angehörigen, dazu zählte ich noch meinen Bruder, waren immer davon ausgegangen, daß das Haus so gut wie schuldenfrei sein würde. Nach den Erzählungen und Kommentaren meines Erzeugers würden wir uns nach seinem Ableben in ein gemachtes Bett setzen. So hörte es sich zumindest immer gut an. Doch die Realität hatte uns bald eingeholt. Nach der Beerdigung erfuhren wir, welche Hypothek noch auf das Grundstück lastete. Mein Bruder erschrak, und zog sich in seine Kieler Wohnung zurück, aus der er nur selten hervor kroch. Damit wollte er nichts zu tun haben. Gerne überschrieb er mir seinen Hausanteil, ab nicht ohne gierig die Hand aufzuhalten. Denn der Verkehrswert des Hauses war hoch. Im freien Verkauf würde es einen guten Preis erzielt haben. So konnte er sich über eine gute Summe Geld freuen. Nur Bares ist Wahres. Geld, welches ich selbstverständlich zu der Zeit nicht im Überfluß zur Verfügung hatte, und somit wiederum einen Kredit aufnehmen mußte. Irgendwie hätte ich es auch geschafft, aber dann machte meine Firma bankrott, und ich stand auf der Straße. Buchstäblich. Seitdem hängt der notwendige Verkauf des Einfamilienhauses wie ein Damoklesschwert über meine täglichen Gedanken. Widersprüchliche Stimmen vernehme ich in meinem Herzen, die mir gegensätzliche Ratschläge erteilen. Eine Stimme sagt immer zu mir:
Verkaufe, und du hast sofort keine Probleme mehr, dann hast du sogar noch Geld über, und kannst in einer Mietwohnung ein gutes Leben genießen.
Die zweite Stimme, die ich in meinem Innersten immer zu dem Thema vernahm, riet mir genau das Gegenteil.
Du kannst doch nicht das Haus deiner Eltern nur des schnöden Mammons wegen verkaufen. Wie haben sie sich dafür abmühen müßen, um dieses zu schaffen. Hast du kein Ehrgefühl? Halte das Haus in Gedenken an sie fest.
Diese gegensätzlichen Richtungen lebten in meinen täglichen Gedanken. Seit Wochen beherrschten sie mich. Was sollte ich machen? Wenn man über jeden einzelnen Ratschlag nachdachte, hatte jeder etwas für sich, und klang vollkommen vernünftig. Doch das half mir im Moment auch nicht weiter. Und dazu noch die Arbeitslosigkeit. Es war ein Dilemma, auf das ich zuraste. Der Untergang war absehbar. Die Bank wurde allmählich nervös. Ich zunehmend auch. Wenn nicht bald etwas passierte, würde ich mein Haus verlieren. Das war mir klar. Ich nahm mir vor meine Anstrengungen auf eine Arbeitsstelle hin, zu verstärken.
Automatisch hatten meine Beine mich bis zu meinem Anwesen getragen. Es lag in einer Seitenstraße. Links und rechts von meinem Grundstück waren die Nachbarn angesiedelt, die durch hohe Hecken und Zäune, die als Sichtschutz fungierten, abgetrennt waren. Auf der rückwärtigen Stirnseite meines Grundstückes, war ein kleiner Wald. Durch eine Holztür im Zaun, gelangte man in das Wäldchen. Dort hatte ich als spielendes Kind viele Nachmittage verbracht. Immer, wenn ich auf diesem Weg das elterliche Grundstück verließ, ergriffen mich Erinnerungen an meine glückliche Kindheit. Mit Freunden habe ich dort herum getobt. Im Winter wie im Sommer. Cowboy und Indianer hatten wir dort gespielt. So manche Schramme von den Ästen hatte ich mir an Beinen und Armen zugezogen. An einem Baum erkenne ich immer noch das Zeichen, daß ich damals mit meinem Messer hinein ritzte. Auch diese Erinnerungen lassen das mögliche Vorhaben eines Verkaufes zu einem Gewissenskonflikt werden. Waren diese Kindheitserinnerungen denn gar nichts wert. Im Moment bringe ich es nicht über mein Herz. Aber wenn der Sollstand meines Bankkontos etwas anderes empfahl?
Wiederrum mechanisch steckte ich den Schlüssel in die Tür. Ein leichte Quietschen der Türangeln empfing mich. Mich allerdings störte es schon gar nicht mehr. Im Moment störten mich andere Probleme. Aus Gewohnheit schloß ich hinter mir ab, und hängte die Sicherheitskette ein. Heute wollte ich nicht mehr raus. Mit Sabine war ich erst am Wochenende verabredet. Sie hatte mich zum Essen bei sich eingeladen. In der Woche arbeitete sie in einer Firma, die Parkettböden herstellt. Deshalb sahen wir uns in der Woche selten. Sie wohnte auf der anderen Seite der Stadt. Es hat eben seine Vorteile, wie auch seine Nachteile.
Im Flur gleich rechts stand der Schuhschrank. Meine Schuhe zog ich aus, und verstaute sie. Beim Eingang auf der linken Seite, führte eine Treppe nach oben, wo sich das Schlafzimmer und zwei ehemalige Kinderzimmer befanden. Jetzt wurden sie als Hobby- und Gästezimmer benutzt. Unter dem Treppenaufgang im Flur, führte eine Treppe in den Keller, wo sich unter anderem die Ölheizung befand. Vom Flur aus gesehen rechts schloß sich die Küche an.
Ich ging geradeaus, und betrat mein Eß- und Wohnzimmer. Links davon lag noch ein kleines Zimmer. Am Ende des Wohnzimmers schloß sich die Terrassentür an. Es war eine große Glastür, die geschoben werden konnte. Auf der Terrasse stand ein großer Grill, der häufig benutzt wurde. Dahinter lag der Garten wie in einem Dornröschenschlaf. Mein mangelndes Interesse an Gartenarbeit war deutlich zu ersehen. Einige nannten es ungepflegt. Dagegen sprach ich eher locker von einem natürlichen Biotop. Man kann einige Mißstände eben beschönigen. Sei es drum. Im Moment betörten mich andere Dinge, als das herausziehen von Grasbüscheln, die da nicht hingehörten, wo sie gerade wuchsen.
Einige Minuten stand ich unbeweglich in der Mitte des Wohnzimmers. Es war mir unmöglich, eine klaren Gedanken zu erfassen. Eine Lethargie hatte mich umschlossen. Mein Blick war leer auf die Glaswand und dem dahinter liegenden Garten gerichtet. Wie ich so da stand, tat ich mir selber leid. Ich armer Kerl. Diese böse Welt hatte sich gegen mich verschworen. Sie war ja so ungerecht zu mir.
Langsam versuchte ich mich von dieser Umklammerung zu lösen, denn ich spürte einen starken Hunger in mir. Wohl wußte ich, daß der Kühlschrank zur Zeit nicht allzu viel hergab. Aber für eine Packung Nudeln im Centbereich müßte es noch beim letzten Einkauf gereicht haben. Als ich mich umdrehen wollte, um zur Küche zu gehen, berührte mich ein Lufthauch. Das war ungewöhnlich, mitten im Wohnzimmer, da ja alle Fenster geschlossen waren. Wirklich alle?
Jetzt erst erkannte ich, daß die Tür zum kleinen Zimmer offen stand. War sie nicht meistens geschlossen? Ich war irritiert. Ich betrat das kleine Zimmer, in dem mein Schreibtisch mit dem heutzutage obligatorischem PC sowie eine Kommode stand. Außerdem hingen an den Wänden einige Regale, die mit Büchern belegt waren. Für mehr war in dem kleinen Zimmer kein Platz. Da erkannte ich, daß das Fenster offen stand. Zwar nur einen Spalt, aber der hatte für den Luftzug gesorgt. Es war mir nicht bewußt, daß ich es beim Verlassen des Hauses am Morgen offen gelassen hätte. Oder begann bei mir schon die Alzheimer Krankheit? Ich schüttelte den Kopf.
Sofort schloß ich das Fenster wieder. Schließlich wollte ich am Abend vor dem Fernseher nicht einschlafen, wenn nicht alle Fenster geschlossen waren.
Dann begab ich mich in die Küche. In einem Topf ließ ich Wasser ein, und stellte diesen auf den Herd. Dann griff ich mit der rechten Hand nach oben und öffnete einen Schranktür. In dem Moment, als ich nach dem Beutel Nudeln griff, vernahm ich hinter mir ein Geräusch. Doch da mein Arm ausgestreckt war, konnte ich mich nicht umdrehen, um der Ursache des Geräusches auf den Grund zu gehen. Haustiere, welche öfters Geräusche verursachen, nannte ich nicht mein eigen. Da hatte ich aber auch schon die Nudeltüte in der Hand, und zog den Arm gerade zurück, als ich einen Schlag auf meinem Kopf spürte. Das war das letzte, was ich wahrnahm, denn mich umfing eine plötzliche Dunkelheit, als wenn jemand einen Lichtschalter ausgeknipst hätte.
Heftige Kopfschmerzen waren das erste, was ich spürte, als ich erwachte. Unbewußt ging meine rechte Hand zu meinem Hinterkopf, und fühlte sogleich eine Beule. Ein leichter Schmerz durchzog sofort meinem Kopf. Die Augen waren noch geschlossen. Scheibchenweise kamen die Erinnerungen zurück. Wo war ich?
Jetzt erst benutze ich meine Nase. In ihr war ein penetranter Geruch gestiegen. Ein Geruch, den ich nicht sofort lokalisieren konnte, der mir aber bekannt war. Ich hatte diesen penetranten Gestank schon oft gerochen. Langsam wurde ich wach. Jetzt öffnete ich auch die Augen, und war im ersten Moment genauso schlau wie vorher, denn es war finstere Nacht.
Aber jetzt dämmerte es mir. Die Kopfschmerzen klangen ab, und bald wußte ich wo ich war. Der Geruch war Heizöl. Folgerichtig mußte ich in meinem eigenem Heizungskeller sein. Um ganz sicher zu sein, tastete ich meinen Liegeplatz ab. Denn es war zwecklos, nach einem Lichtschalter zu suchen. Dieser war nämlich draußen vor der verschließbaren Eisentür angebracht, wie mir meine Erinnerung weissagte.
Behutsam ging ich in die Knie, und dann stand ich auf. Ein wenig war ich noch wackelig auf den Beinen, aber die Benommenheit wich immer mehr aus meinem Körper. Es gab ein kleines vergittertes Fenster, durch dem ein wenig Mondlicht herein schimmerte. Dieses genügte, um die Umrisse der zwei Öltanks, die nebeneinander standen, zu erkennen. Davor war aus Gründen der Sicherheit, um eventuell auslaufendes Heizöl aufzuhalten, eine ein Meter hohe Mauer mit 2-DF-Steinen gezogen. Diese war verputzt, und gestrichen. Im Vorraum, wo ich gelegen hatte, befand sich an meinem Kopfende die Heizungsanlage. Im Moment war sie ausgeschaltet. Der Vorraum war gerade so groß, daß ich ausgestreckt liegen konnte. Viel Platz war nicht vorhanden. Als ich mich bückte fühlte ich zwei Decken, die mir gehörten. Außerdem hatte man mir ein Kopfkissen bereit gelegt. An meinem Fußende, welches die Kelleraußenwand darstellte, ertastete ich einen Plastikeimer, der da eigentlich nicht hingehörte. Zu welchem Zwecke er dort deponiert war, sollte ich noch erfahren. Daneben stand eine Packung Saft, und es waren zwei beschmierte Brote hinterlegt. Mehr war nicht vorhanden. Die schwere Eisentür war natürlich von außen verschloßen. Kein Schlüssel steckte von innen.
Gierig griff ich nach den Broten, und stillte meinen Hunger. Auch an dem Saft tat ich mich gütlich. In der Dunkelheit war es etwas schwierig, aber ich versuchte mich den Bedingungen anzupassen. Jetzt waren meine ersten Bedürfnisse befriedigt, und nun beschloß ich klar über meine Lage nachzudenken.
Richtig, es war mein eigener Heizungskeller. Ich war in meinem eigenem Haus eingesperrt.
Wie bizarr und grotesk. Wer macht so was? Je mehr ich darüber nachdachte, umso unheimlicher wurde es mir. Ein regelrecht ängstliches Gefühl, machte sich in mir breit, denn eins wurde mir sofort bewußt. Es muß ein Verbrecher sein. Erstmal ist diese Person ungebeten in mein Haus eingebrochen. Zweitens hat sie mir körperliche Gewalt angetan. Und drittens mich gegen meinen Willen gefangen gehalten. Dias war eindeutig war Kidnapping.
Und über einen Punkt, brauchte ich mir jedenfalls keine Illusionen machen. Der Verbrecher hatte einen längeren Aufenthalt für mich geplant. Dies war an der Verpflegung, an den bereitgelegten Decken und dem Kopfkissen ersichtlich. Wenigstens gönnte er mir ein geringes Maß an Gemütlichkeit. Danke lieber Verbrecher, vielen Dank.
Leicht neige ich im allgemeinen dazu einige Dinge mit Ironie zu sehen. Meine derzeitige Lage ebenfalls. Vielleicht war es eine Möglichkeit, mit dieser Situation umgehen zu können. Natürlich war sie von der Länge der Gefangenschaft abhängig. Nur wußte ich zu diesem Zeitpunkt nicht, wie lange sie dauern würde.
Ich legte mich hin, nachdem ich die eine Wolldecke ganz ausbreitet hatte. Mit der zweiten deckte ich mich zu. Mein Kopf lag auf dem Kissen.
Meiner zur Zeit aussichtslosen Lage bewußt, gab ich mich der aufkommenden Müdigkeit hin. Was sollte ich auch anderes tun? Ich war gefangen, und versuchte nur zu überleben, und mich anzupassen. So dauerte es auch nicht lange, und ich war eingeschlafen.
Die Sonne warf einige Strahlen durch das vergitterte Fenster. Das Gitter war eingemauert, so daß niemand leicht in den Heizungskeller eindringen konnte. In diesem Fall jedoch wurde es zur Mausefalle, denn ohne Werkzeug, kam man auch nicht hinaus.
Die Uhrzeit war mir unbekannt. Eine Uhr hatte ich nicht. Es gab auch keinerlei Hinweise, wonach ich sie bestimmen konnte. Was blieb mir also übrig, als zu liegen, und vor mich hin zu dösen.
Irgendwann spürte ich ein leichtes vibrieren. Jetzt schärfte ich meine Sinne, denn ich wollte mich nicht täuschen. Nach einem kurzen Moment der Unsicherheit, gab es keinen Zweifel. Ich hatte den Baß gespürt. Der oder die Einbrecher - ich wußte ja immer noch nicht, mit wem ich es zu tun hatte - vergnügten sich also mit meiner Stereoanlage. Wenn ich das Ohr an die Wand hielt, konnte ich sogar ein wenig Musik vernehmen. Sofort spürte ich, wie die Wut mich ergriff. Meine Fäuste ballten sich zusammen. Das war für mich der Gipfel der Unverschämtheit. An so eine Frechheit hatte ich nicht mal zu wagen gedacht.
Da werde ich überfallen, wie ein Tier im eigenen Keller eingesperrt, und die Einbrecher machen es sich gemütlich, und hören meine CDs. Vielleicht trinken sie auch noch meinen Whisky? Bei dem Gedanken spürte ich, wie die Zornesröte in mein Gesicht Einzug hielt. Ich war einfach nur außer mir.
Langsam beruhigte ich mich wieder, denn ich konnte sowieso nichts dagegen tun. Die Erkenntnis sammelte ich. Dieser Sachstand machte mir die Hilflosigkeit meiner Lage vollends bewußt. Eingepfercht, wie ein Kaninchen, dazu der andauernde Heizölgestank, den ich in den letzten Stunden schon nicht mehr so intensiv wahrnahm, weil meine Geruchsnerven sich daran gewöhnt hatten.
Ich begann mich immens zu langweilen. Die einzige Abwechslung, die mir blieb, war die Verrichtung der Notdurft. Inzwischen hatte ich nämlich den Zweck des Plastikeimers herausgefunden, und ihn für die menschlichen Bedürfnisse zweckentfremdet.
Danach quälte mich wieder ein aufsteigender Hunger. In meinen satirischen Gedanken spielte sich schon mein gesamter zukünftiger Tagesablauf ab, der aus schlafen, Hunger leiden und pinkeln bestand.
Was mich störte, oder sollte ich besser sagen wunderte, war die Tatsache, daß sich niemand um mich kümmerte. Niemand kam her, und stellte mir irgend eine Forderung, oder fragte mich nach irgend einer Bewandtnis. Für mich war es ein Rätsel. Diese in meinen Augen grundlose Festhaltung störte mich am meisten. Wenn es dem Einbrecher - oder die Einbrecher, auch auf die Gefahr hin, daß ich mich wiederhole - nur auf Wertgegenstände, wie Fernseher und DVD-Spieler ankäme, dann sollte er die Sachen nehmen und endlich verschwinden. Dann wußte ich wenigstens, woran ich war.
Mein Gefühl sagte mir, daß es dem Abend zuging. Es hatte den Anschein, als ob das durch das kleine Fenster herein kriechende Licht am abnehmen war.
Auf dem Rücken konnte ich nicht mehr liegen. Ich drehte mich auf die linke Seite, und würde plötzlich müde. Ich spürte, wie mir die Augen zufielen.
Als ich erwachte dämmerte es bereits. Ende August bedeutete dies, daß es ungefähr sechs Uhr Morgens sein mußte. So lange hatte ich also geschlafen? Ich wunderte mich selber über mich. Dies war als meine zweite Nacht in meinem eigenem Gefängnis gewesen. Ich tröstete mich damit, indem ich mir zuredete, daß ich es schon überleben werde. Das Heizöl roch ich schon gar nicht mehr. Den Geruch aus dem Eimer auch nicht. Die Geruchsnerven hatten sich schnell daran gewöhnt. Wahrscheinlich waren sie schon abgestorben. Das Summen der Heizungsanlage war zu dieser Jahreszeit sowieso nicht zu vernehmen.
Langsam öffnete ich die Augen, und sah zur gegenüberliegenden Außenwand. Hinter meinen Füßen lag etwas, was bei meinem Einschlafen noch nicht da gewesen war. Sofort war ich hellwach. Ich rieb mir die letzten Schlafkörner mit dem rechten Zeigefinger aus den Augen, und sah dort Lebensmittel. Das hieß also, daß ich während meines Schlafens, mitten in der Nacht also, Besuch hatte. Nichts hatte ich mit bekommen. Eine Wut auf mich selber ergriff mich. Das wäre eine einmalige Chance gewesen, meine Peiniger sehen zu können. Gleich meldete sich aber auch eine Schutzstimme in mir, die mir zur Vorsicht riet. Vielleicht war es auch ganz gut so, denn womöglich hätte ich die Kidnapper mit meiner Art gereizt, und mich damit unnötig in Gefahr begeben. Meine manchmal leicht aufsässige Art war mir hinreichend selbst bekannt.
Ich beruhigte mich wieder, und wandte mich dem Essen zu. Es war reichlich vorhanden. Zu meiner Überraschung fand ich beschmierte Brote, die mit Käse und Wurst belegt waren, welche nicht aus meinen mickrigen Vorräten stammten. Sie hatten also selbst investiert. Genauso war frisches Obst vorhanden. Auch die bereitgestellten Getränke, hatte ich nicht eingekauft.
Nach dem Essen verfiel ich in einen dämmernden Zustand. Stunden verbrachte ich so. Nichts tat ich. Selbst das denken viel mir schwer.