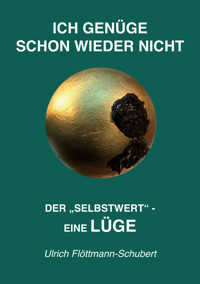
ICH GENÜGE SCHON WIEDER NICHT- Das weit verbreitete Leiden unter Minderwertigkeitsgefühlen, Versagensängsten, Angst vor dem Verlassenwerden! E-Book
Ulrich Flöttmann-Schubert
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wenn auf diesem Planeten ein Kind geboren wird, gerät es in eine konkrete Umgebung, von der es annehmen muss, dass sie die ganze Welt repräsentiert. Und daher wird es alles, was es erfährt, als richtig, stimmig und wahr erleben und auch glauben. Aber: Eine Wahrheit ist das nie! Jede Kultur, in die ein Kind hineingeboren wurde, hat sich im Laufe der Jahrtausende entwickelt. Und dabei sind zwangsläufig besondere Einstellungen, Haltungen, Vorstellungen von Moral und Ethik und Religion etc. entstanden. Und die Mitglieder dieser Gemeinschaften vertreten dies alles oft recht kritiklos. Aber noch einmal: All dies ist lediglich ein „Für-Wahr-Halten“ innerhalb dieser besonderen Kultur. Aber keine allumfassende, für jeden Menschen gültige „Wahrheit“. Warum habe ich dieses Buch geschrieben? In unserer Gesellschaft herrscht u.a. die kaum infrage gestellte Überzeugung, dass jeder Mensch sich selbst über seine Leistungen, seine Erfolge, sein Ansehen und sein Hab und Gut bewerten kann und darf. Das wird als allgemein gültige Wahrheit und Selbstverständlichkeit „verkauft“. Allerdings wird dabei verschwiegen oder schlicht nicht wahrgenommen, dass Leistungen und Erfolge immer wieder erneut erarbeitet werden müssen. Denn die guten Gefühle über Anerkennung und Applaus versickern nach sehr kurzer Zeit schon wieder. Und das ewige Ackern-müssen macht oft sehr krank! Ich vertrete hingegen die Haltung, dass es unsinnig und gefährlich ist, einen Menschen über seine Leistungen - im weitesten Sinne - zu bewerten. Meine Erfahrung zeigt, dass eine solche Erwartungshaltung z.B. der Verunglimpfung, Abwertung und Verfolgung derer, die den zugrundeliegenden Ansprüchen und Ideologien irgendwie nicht genügen, Tür und Tor öffnet. Und diese Erfahrung trägt ebenfalls erheblich zu vielerart Krankheiten und psychischen Problemen bei. Dem gegenüber versuche ich die Einsicht zu vermitteln, dass jeder Mensch im Prinzip von Anfang an wertvoll und gleichwertig mit allen anderen Menschen dieses Planeten ist. Die Bewertung einer einzelnen Person ist daher völlig unsinnig. Bewertet kann allenfalls das Ergebnis eines Tuns. Welches mit der Person selbst nicht identisch ist! Eine solche Haltung erscheint mir definitiv angemessener und menschenwürdiger. Im Text zeige ich zunächst auf, welche Bedeutung schon die Schwangerschaft für die Stabilisierung des Zustandes der würdevollen Einzigartigkeit haben kann. Ich mache deutlich, dass wir unseren Kindern nach der Geburt zwar mit zumeist guten Absichten begegnen, viel zu oft aber mit unangemessenem Verhalten. Ich zeige schließlich auf, unter welchen Voraussetzungen es möglich wäre, diesen Urzustand der Einzigartigkeit aufrecht zu erhalten. Dabei sehe ich die „bedingungslose Liebe“ als die wesentliche Grundvoraussetzung für ein diesbezügliches Gelingen an. Ich entwickle daraufhin Phantasien, wie sich ein solcherart geförderter Mensch in unserer Gesellschaft vermutlich verhalten und fühlen wird. Auf der anderen Seite stelle ich aber auch recht ausführlich dar, wie in unserer Gesellschaft die generelle Leistungsorientierung - hier Fremdwertgefühl genannt - entstehen kann, aufrecht erhalten wird und unsere Gefühle und unser Verhalten prägt. Schlussendlich zeige ich auf, was Erwachsene für sich selbst tun können, um sich von der Fremdwertgefühl-Falle etwas intensiver zu distanzieren und ihre Kinder somit unterstützen können, gar nicht erst in diese Falle hinein zu stolpern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ulrich Flöttmann-Schubert ICH GENÜGE SCHON WIEDER NICHT
Erich Kästner hat einmal geschrieben: „Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch“. Ulrich Flöttmann-Schubert (77) hat sich diesen Spruch als Lebensmotto gewählt. Dass er schon sehr lange danach lebte, war ihm ebenso lange überhaupt nicht klar. Seine kindliche Seite war ihm manchmal eher peinlich. Inzwischen kann er dazu stehen. Das klappt zwar noch nicht immer, aber immer öfter. Sei- ne über vierzig Jahre lange Tätigkeit als Psychologischer Psychotherapeut* in freier Praxis in Berlin hatte sicherlich auch damit zu tun. Der Umgang mit den Hilfesuchenden erforderte schließlich immer ein neugierig-staunendes Offensein und eine erwachsene Ernst- haftigkeit ebenso.
Die Erfahrung, dass viele seiner Patient*innen, die er als Psychologischer Psychotherapeut behandelte, hinter ihren „Vorzeigesymptomen“ unter Störungen des sogenannten Selbstwertgefühls litten, führte zu einer stetigen Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Je tiefer er sich damit befasste, desto klarer wurde ihm, dass ihn diese Problematik auch selbst betraf. Und es blieb dabei natürlich nicht außen vor, dass die Beschäftigung mit diesem Thema auch eine Auseinandersetzung mit seiner persönlichen Geschichte und mit seinem Verhältnis zu Mutter und Vater wurde. Aber er konnte und kann dies mit zunehmender Freude und immer befreiter und glücklicher erleben.
Ulrich Flöttmann-Schubert ist seit 44 Jahren mit seiner Frau zusammen und hat mit ihr zwei erwachsene Kinder. Vieles hat er in dieser Zeit sicherlich falsch gemacht, vieles aber auch ganz richtig.
Das Leben ist halt ein Lernprogramm - für das Kind und den Erwachsenen in uns.
Und wir alle können noch dazulernen! Immer!
* Ausbildung in Wissenschaftlicher Gesprächspsychotherapie (GwG), Verhaltenstherapie und NLP (Neuro-Linguistisches Programmieren); mehrjährige Tätigkeit als zertifizierter NLP-Trainer.
ICH GENÜGE SCHON WIEDER NICHT
DER „SELBSTWERT“ - EINE LÜGE
ULRICH FLÖTTMANN - SCHUBERT
Berlin / Dameswalde bei Oranienburg
© 2021 Ulrich Flöttmann-Schubert
ISBN Softcover: 978-3-347-65575-1
ISBN Hardcover: 978-3-347-65576-8
ISBN E-Book: 978-3-347-65577-5
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Covergestaltung: Manu Heck, Ulrich Flöttmann-Schubert
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich.
Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.
Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:
tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice",
Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Ich widme dieses Buch meinen beiden wunderbaren Kindern Sarai Marie und Jakob Julian, meiner lieben Frau Silke und all meinen tollen Patient*innen, die mir geholfen haben, zu verstehen, wie es geschehen konnte, dass wir so geworden sind, wie wir sind, und dass wir genau das bei unseren Kindern verbessern könnten.
INHALTSVERZEICHNIS
- Desiderata
- Prolog
- MEIN TRAUM, MEIN WUNSCH, MEIN ZIEL, MEIN CREDO
A WORUM ES GEHT
- DIE DREI ASPEKTE
- DIE AUFSCHLÜSSELUNG DES IST-ZUSTANDES
- Meine Geschichte
- Was ist das Selbst
- Metapher:Die goldene Kugel
- Das Fremdwertgefühl
- Was bedeutet dies nun für unsere Lebensgestaltung?
- Metapher:Die Kiepe
- Metapher:Pavillon und Haus
- Unterscheidung Aspekte I - III
Zusammenfassung
B VORBEREITUNG
1. SCHWANGERSCHAFT - DIE BASIS
- DIE ERWARTUNGEN
- DIE PROBLEMATISCHE SCHWANGERSCHAFT
- DIE SCHWANGERSCHAFT OPTIMAL GENUTZT
- UNMITTELBAR VOR DER GEBURT
- Metapher:Die Drachenhaut
Zusammenfassung
2. NACH DER GEBURT
- UNSER DILEMMA, UNSERE HILFLOSIGKEIT
- DIE ERSTEN JAHRE UND IHRE FOLGEN
- Vorbereitung in der Schwangerschaft
- Erwartungen des Säuglings: Ruhe, Geborgenheit, Mama
- Betreuung und Kommunikation
Zusammenfassung
C ASPEKT I: DER URZUSTAND
1. URZUSTAND - DIE VORAUSSETZUNGEN
- DIE BINDUNGSSTILE
- Bindungsstil „sicher-gebunden“ genauer
- Feinfühligkeit
- Weitere unterstützende Hinweise zur Stabilisierung des Urzustandes
- Zu Mama auf den Arm
- Zu Mama auf den Arm …und runter!
- Der Kinderwagen und der Nuckel
- Nachts
- Liebe als Bringepflicht
- Vater ist dabei…oder nicht
- Nur keine Scham!
- Differenzierung
- Sollte das alles sein?
Zusammenfassung
2. URZUSTAND - BEDINGUNGSLOSE LIEBE
- DER SINN DES LEBENS
- WIE DAS BEDINGUNGSLOSE LIEBEN AUSSEHEN KANN
- Liebe versus Lob
- WAS MAN NOCH BEDENKEN KANN
- Kommunikation
- Kommunikationsregeln in Aktion/reziprokes Umgangsverhalten
- Begleitung und Führung
- Verhältnis Eltern und Kinder: das gemeinsame Aufwachsen
- Trösten
- Wie das Kind die Welt erlebt
- Vorurteile
- Eltern und Pubertät
- Eltern und junge Erwachsene
- Die Geschichte der Kinder und Eltern
Zusammenfassung
3. URZUSTAND -WIE DER BEDINGUNGSLOS
GELIEBTE DANN IST
- Geschichte:Dödel-Dödel
- FLOW 1678
- BETROFFENHEIT VERSUS GETROFFENHEIT
- PAVILLON VERSUS HAUS
- VERGANGENHEIT, GEGENWART, ZUKUNFT
- MITEINANDER
- PAARBEZIEHUNGEN
Zusammenfassung
D ASPEKT II: DAS FREMDWERTGEFÜHL
1. FREMDWERTGEFÜHL - DIE GUTE ABSICHT
- WOLLEN ELTERN WIRKLICH IMMER DAS BESTE FÜR IHRE KINDER?
- Metapher:Das „kostbare Gewand“ der Elternliebe
- Der Film „Das weiße Band“
- Metapher:Die gute Absicht und Wolke 17
Zusammenfassung
2. FREMDWERTGEFÜHL - ENTSTEHUNG / ERHALTUNG
- LERNEN ÜBER REFERENZERFAHRUNG
Zusammenfassung
3. FREMDWERTGEFÜHL - ELTERLICHE AHNUNGSLOSIGKEIT
- BEISPIELE FÜR AHNUNGSLOSES VERHALTEN
- Meine dumme, dumme kleine Tochter
- Metapher:Die kluge Magd Bertha
- Metapher:Die Ohrfeige
- Zuschreibungen
- Unbedachte Sprüche
- Emotionale Unsensibilität
- Mama hat dich trotzdem lieb
- Die Schuldgefühle
- Die Scham
- Das „Ich müsste eigentlich“
- Eltern versus Erzieherinnen
- Metapher:Der Speicherchip
Zusammenfassung
4. FREMDWERTGEFÜHL - PRÄGT GEFÜHLE UND VERHALTEN
- BESONDERE GEFÜHLE / STÖRGEFÜHLE
- Der Stolz
- Neid und Eifersucht
- PASSIVE ERSATZSTRATEGIEN (FÜR GERINGES KÖNNEN ODER HABEN)
- Andere als minderwertig und unterlegen behandeln
- Selbstablehnung
- Selbstaffirmation oder „mehr desselben“
- Paarbeziehungen
- Metapher:Das Schweizer-Käse-Modell
- Zugehörigkeit
- Zugehörigkeit und Pubertät
- Metapher:Der Energieschlauch
- Rechthaberei
- DEPRESSION
Zusammenfassung
Zusammenfassende Betrachtung der Aspekte Urzustand und Fremdwertgefühl
E ASPEKT III: WAS SIE FÜR SICH / IHRE KINDER TUN KÖNNEN
1. VORÜBERLEGUNGEN FÜR ERWACHSENE
- WIE SOLL DAS FUNKTIONIEREN
- Metapher:20 Klone
- Neuerfindung
- Metapher:Das Brunnenmodell
- „Der junge Mann und die Frauen“
- „Der bierselige Stammtisch“
- Brunnenmodell: Bild und Erklärung
Zusammenfassung
2. STRATEGIEN ZUR VERÄNDERUNG VON GLAUBENSSÄTZEN
- DIE INNEN-AUßEN-TECHNIK
- Bild zur Innen-außen-Technik
- Die Technik für Kinder nutzen
- Schaubild zur Nutzung der Innen -Außen-Technik
- DIE GLAUBENSSATZ-ALTERNATIV-METHODE
- DER GEDANKENSTOP
- Metapher:Die Western-Saloon-Tür
Zusammenfassung
3. UNTERSTÜTZUNG DER KINDER
- KLEINE KINDER AB GEBURT
- DAS ÄLTERE KIND (AB CA. 4 J.)
- DAS KIND AB DER PUBERTÄT 338
Zusammenfassung
- EPILOG
- DANKSAGUNG
- Quellenverzeichnis
- Literaturliste
- Besondere Literaturempfehlungen
Desiderata
(Prosagedicht des amerikanischen Rechtsanwalts Max Ehrmann aus dem Jahr 1927)
Gehe gelassen inmitten von Lärm und Hast und denke daran, welcher Friede in der Stille sein mag.
So weit wie möglich versuche, mit allen Menschen auszukommen, ohne Dich zu unterwerfen. Sprich Deine Wahrheit ruhig und klar und höre anderen zu, auch den Schlichten und Unwissenden, denn auch sie haben ihre Geschichte.
Vermeide laute und aggressive Menschen, sie sind eine Plage für die Seele.
Wenn Du Dich mit anderen vergleichst, dann magst Du eitel werden oder bitter, denn es gibt immer größere und geringere Menschen als Dich. Freue Dich über Deine Erfolge und Pläne. Nimm Deine Arbeit ernst, auch wenn sie noch so bescheiden ist, es ist ein wirklicher Besitz in den wechselnden Geschicken des Lebens.
Sei vorsichtig mit geschäftlichen Dingen, denn die Welt ist voller Listen. Aber werde nicht blind gegenüber der Tugend, die Dir begegnet; Viele Menschen haben hohe Ideale, und wo Du auch hinsiehst, ereignet sich im Leben Heldenhaftes.
Sei Du selbst.
Insbesondere täusche keine Zuneigung vor. Hüte Dich davor, der Liebe zynisch zu begegnen, denn trotz aller Dürreperioden und Enttäuschungen ist sie beständig wie das Gras.
Nimm den Rat der Jahre freundlich an und lasse würdevoll die Dinge der Jugend hinter Dir.
Nähre die Kraft Deines Geistes, um Dich vor plötzlichem Unglück zu schützen, aber beunruhige Dich nicht mit dunklen Gedanken. Viele Befürchtungen sind aus Müdigkeit und Einsamkeit geboren. Jenseits einer gesunden Selbstdisziplin gehe freundlich mit Dir um. Du bist ein Kind des Universums, nicht weniger als die Bäume und die Sterne; Du hast ein Recht, hier zu sein.
Und ob es Dir bewusst ist oder nicht: das Universum entfaltet sich genau so, wie es das soll.
Lebe daher in Frieden mit Gott, wie immer Du ihn Dir auch vorstellen magst.
Und was auch immer Deine Anstrengungen und Dein Streben im lärmenden Durcheinander des Lebens sein mögen, behalte einen Frieden in Deiner Seele.
Trotz all ihrem leeren Schein, aller Plackerei und aller zerbrochenen Träume ist diese Welt doch wunderschön.
Sei heiter und versuche, glücklich zu sein
PROLOG
Die freimütige und ehrliche Einlassung meines knapp dreißigjährigen Sohnes krachte massiv bei mir ein und gab mir wirklich schwer zu den- ken! Ich hatte mich immer für einen besonders guten und sensiblen Vater gehalten; wie konnte ich nur so blind sein!?
Aber der Reihe nach:
Mein Sohn Julian war etwa sieben Jahre alt, als er eines Tages strah- lend in mein Zimmer kam; ich lag auf meinem Bett und las. „Papa, das habe ich für dich gemalt, das bist du,“ sagte er und legte mir ein Bild vor. Die Zeichnung stellte eine komische Person dar mit dicker, übergroßer Knollennase und einem merkwürdigen Irokesenhaarschnitt. Nun kann ich ja gerne zugeben, dass meine Nase wirklich nicht als zierlich angese- hen werden kann, aber diese Nasen-Übertreibung und dieser Haarschnitt hatten wirklich nur geringe Ähnlichkeit mit mir.
Ich sprang vom Bett auf und rief: „Julian, das bin doch nicht ich, so sehe ich doch nicht aus! Pass mal auf, du setzt dich jetzt hier hin, ich lege mich wieder aufs Bett, und dann zeichnest du mal ganz genau, was du von meinem Kopf siehst. Schau einfach genau hin, dann wird das schon klappen“. Julian setzte sich und fing an, mich zu zeichnen. Das dauerte eine Weile, dann aber war er fertig und zeigte mir das Bild. Ich war völ- lig von den Socken, weil er so überaus genau hingesehen und wirklich mein Konterfei sehr, sehr gut getroffen hatte. Da stimmte alles: Der
Schnurrbart, die Geheimratsecken, sogar meine Lesebrille mit der Schnur daran hatte er sehr genau erfasst. Nur meine Nase hatte er jetzt ein wenig untertrieben, aber das hatte wohl mit der Brille auf der Nasenspitze zu tun. Ich rief wieder: „Julian!“, sprang auf, rannte die Treppe zu meiner Hochetage hoch, klaubte ein 5-DM Stück aus meinem Portemonnaie, rannte wieder herunter, nahm meinen Sohn in den Arm, jubelte: „Meine Güte, was du für ein schönes Bild von mir gezeichnet hast. Hier, das hast du dir redlich verdient!“ und gab ihm das Geldstück. Julian zog offenbar verdattert, aber glücklich ab, so meine Wahrnehmung und meine Hoffnung.
Zwischenbemerkung: Ich möchte Sie gleich hier auf das Wort „Wahrnehmung“ aufmerksam machen, weil es im Gesamttext öfter vorkommen wird. Eine Wahrnehmung heißt eigentlich genau: Ich habe das für wahr genommen. Ich entscheide mich also für einen bestimmten Blickwinkel bzw. eine bestimmte Deutung oder Interpretation dessen, was ich mit meinen Sinnen bemerke! Eine Wahrnehmung ist somit immer ein subjektiver Vorgang, der aber oft als objektive Realitätsbeschreibung ausgegeben wird.
Am Abend zeigte ich das Bild meiner Frau, und auch sie war vollends begeistert von meinem Porträt und Julians Riesenfortschritt im Zeichnen.
In den folgenden Jahren habe ich immer mal wieder diese Geschichte erzählt, stolz das Bild vorgezeigt und mit meiner pädagogischen Kompetenz angegeben, die meinen Sohn gewissermaßen auf einen Schlag in Kontakt mit seinen künstlerischen Fähigkeiten gebracht hatte. Aber erst jetzt, mit fortgeschrittenem Alter, hat Julian uns gestanden, dass diese Situation für ihn nur Schrecken, Angst, Stress und letztendlich Ablehnung durch mich bedeutet habe. Und wenn er heute an diese Situation denke, käme auch immer wieder diese Angst und das damalige Gefühl der Ablehnung durch mich hoch. Und dieses „Ich genüge nicht“.
Was war geschehen?
Julian kam damals zu mir mit reinem Herzen und dem Wunsch, dem geliebten Papa eine Freude, ein Geschenk zu machen. Er hatte überhaupt nicht die Absicht, mir eine trefflich gelungene Zeichnen-Leistung zu präsentieren. Ich aber nahm dieses Geschenk nicht wahr! Mehr noch: Ich nahm seine Liebeserklärung nicht wahr! Eine klare Demütigung und Abwertung seiner Absichten. Stattdessen reduzierte ich sein Geschenk auf die reine Leistungsebene, wurde laut und kritisierte zusätzlich auch noch das Ergebnis. Dass ich damit aber auch ihn als ganze Person abwertete, wurde mir überhaupt nicht deutlich. Meine Einschätzung der Situation lag vollständig daneben. Zusätzlich setzte ich ihn unter Stress, nun meinen Vorgaben zu entsprechen, durch genaues Hinsehen ein wirklichesBild von seinem Papa zeichnen zu sollen. Und das auch zu können! Das machte ihm Angst, vor allem offenbar Angst vor dem möglichen Versagen. Als er mir das fertige Bild zeigte, und ich wie von der Tarantel gestochen meine Hochetage hoch rannte, vermutete er sofort, dass dies bedeuten könnte, dass er schon wieder etwas falsch gemacht habe. Das blöde Geldstück, meine Umarmung und meine Beteuerung, wie gut er seine Sache gemacht habe, also meinen Erwartungen entsprochen habe, waren nicht geeignet, ihn sofort aus seinem Stress und seiner Angst zu befreien. In meiner Begeisterung von mir selber und dem so erstaunlichen Ergebnis meiner eingebildeten pädagogischen Fähigkeiten bemerkte ich von seiner Inkongruenz überhaupt nichts. Auch meine Frau bekam am Abend von Julians Angst und seinen ängstlichen Bedenken, es dem Papa eventuell einmal nicht recht machen zu können, nichts mit. Julian konnte diese Gefühle natürlich auch nicht äußern, war sich deren vermutlich auch nur recht diffus bewusst.
Wenn ich in späteren Jahren anderen gegenüber in Julians Gegenwart stolz diese Geschichte erwähnte, blieb er still, weil er mir den vermeintlichen Erfolg nicht wegnehmen wollte, wie er nun berichtete. Wieso er dennoch ein guter Zeichner und Maler geworden ist, bleibt mir angesichts dieser problematischen Begleitumstände tatsächlich ein Rätsel.
Als er uns schließlich seine Version dieses Vorfalls erzählte, war ich völlig verblüfft und gleichzeitig entsetzt, wie es mir / uns passieren konnte, unseren Sohn und seine Gefühlslage so grottenschlecht einzuschätzen.
Irgendwann zu dieser Zeit, als Julian uns von seinen wahren Gefühlen berichtete, saß ich zusammen mit meiner Frau vor dem Fernseher und sah die Talkshow Kölner Treff. Eine junge Schauspielerin erzählte von dem unglaublichen Druck, den sie oft bei anderen Schauspielerinnen und vermutlich auch bei sich selbst erlebt hat, nämlich immer irgendetwas Besonderes darstellen und sein zu müssen, aufzufallen und anderen zu gefallen, schöner und sexier zu sein statt einfach sie selbst. Vermutlich sprach sie damit auch die durchaus allgemein bekannte berufsspezifische Profilierungsnotwendigkeit von Schauspieler*innen an, und interessanterweise bekam sie für ihre Äußerung starken Applaus vom Publikum. Interessant ist dies deshalb, weil doch eigentlich sehr viele von uns gelernt haben, wie überaus wichtig es ist, das Beste aus sich zu machen, etwas Besonderes darzustellen, groß raus zu kommen oder irgendwie zu siegen. Aber das Publikum spendete spontan viel Beifall für die Vorstellung, man solle einfach man selbst sein. Vielleicht hatte die junge Dame hier etwas zum Klingen gebracht, möglicherweise löste sie so etwas wie eine stille Sehnsucht aus nach …ja, nach was eigentlich?
Auf jeden Fall nahm ich diese Episode und den bestürzenden Bericht meines Sohnes zum Anlass, mir endlich von der Seele zu schreiben, was ich schon so lange meinte verstanden zu haben.
In diesem Buch soll es genau darum gehen. Genau um dieses man selbst sein und dessen tiefere Bedeutung. Und natürlich auch darum, wie es uns gelingen kann, diese besondere menschliche Qualität bei unseren Kindern zu bewahren. Es geht letztendlich dabei um nicht weniger als um unser Leben. Das erlebte Leben, das jeder für sich führt. Das Leben, das wir erleben, wenn wir morgens aufwachen, das uns durch den Tag begleitet und dem wir abends vielleicht als Tagesabschluss noch nachsinnen. Es geht darum, wie wir sein könnten, und wie wir von daher auch die Ereignisse, Erlebnisse, Beziehungen zu anderen und die Dinge in unserem Leben aufnehmen und verarbeiten könnten. Es geht um unser ICH, unser Selbst, oder wie auch immer wir das nennen mögen. Das also, was wir vielleicht als die Basis unseres Erlebens in der Welt definieren könnten.
Und jetzt werden vielleicht einige von Ihnen denken, was das denn nun wohl solle: Noch ein Buch über das ICH, das Selbst, das Sich-Selbst-Finden usw. Da haben Sie recht. Das Thema ist uralt, und es gibt tatsächlich schon sehr viele Bücher darüber. Und zugegeben: Auch was ich hier schreibe, ist nicht wirklich neu. Aber ich möchte Ihnen einen besonderen Aspekt aus diesem Themenkreis vorstellen, der in der einschlägigen Literatur eher wenig eindeutige Berücksichtigung findet.
MEIN TRAUM, MEIN WUNSCH, MEIN ZIEL, MEIN CREDO
Während meiner jahrzehntelangen Erfahrung als Psychotherapeut, Vater, Ehemann und Freund bin ich zu folgenden Überzeugungen gelangt, die gewiß auch nicht neu sind:
• Ein Mensch ist grundsätzlich einmalig und einzigartig, und ein Bemühen um Einzigartigkeit ist daher völlig unnötig.
• Wir behandeln aber unsere Kinder weitgehend so, als gäbe es diese Einsicht nicht und leiten sie an, sich in ihrem Gefühl zu sich selbst nach ihrer Leistungsfähigkeit zu richten.
• Die Orientierung an Leistungskategorien zur Erhöhung des sog. Selbstwertes ist aber unsinnig und gefährlich.
• Wir könnten und sollten unsere Kinder in ihrem Urvertrauen unterstützen, so dass sie sich über ihren Wert keinerlei Gedanken machen müssen, weil sie grundsätzlich wertvoll sind.
Ich schreibe dieses Buch in der Hoffnung, dass verstanden wird, dass die Begleitung und Führung unserer Kinder nicht dem Ziel dienen sollte, sie zu mehr oder weniger willen- und gedankenlosen Erfüllungsgehilfen kapitalistischer Leistungsansprüche und Expansionsbestrebungen zu verbiegen oder zurecht zu stutzen. Sie sollten glückliche Wesen sein und bleiben, die die Zeit auf dieser Erde möglichst 100%tig genießen können und dürfen.
Bei der ausführlichen Darstellung der oben genannten Überzeugungen wird deutlich werden, dass der Betreuung der Kinder in Bezug auf ihr Urvertrauen sicherlich mehr Aufmerksamkeit und Kraft gewidmet werden muss, als dies üblicherweise der Fall ist.
Leider höre ich hier schon jetzt den empörten Aufschrei, dass das unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen mit Sicherheit mal wieder ein viel zu hoher Anspruch sei. Dem kann ich bedingt sogar zustimmen, weil meine Frau und ich selbst die Belastung durch die Verantwortung für das Wohl unserer Kinder kennengelernt haben.
Andererseits: Was soll die Empörung und dieses Klagen? Wer würde denn akzeptieren, dass z.B. ein Architekt erklärt, er werde ein Hausprojekt mit dem billigsten Material und unter Verzicht auf spezifische, statische Berechnungen bauen, weil dies dann besonders leicht und schnell zu bewerkstelligen sei. Wer würde denn zustimmen, wenn ein Arzt meint, die von ihm gewählte Behandlungsmethode sei zwar mit unangenehmen Begleiterscheinungen und vielleicht gar gefährlichen Folgen für die Patient*innen verbunden, sei aber entschieden einfacher und kostengünstiger für ihn? Natürlich passiert all dies und vieles mehr tatsächlich, zumeist im Geheimen und aus „niederen Beweggründen“. Und wenn es publik wird, gibt es großes Geschrei.
Aber gerade in der so überaus wichtigen Frage der optimalen Betreuung unserer Kinder gibt es diese Empörung nicht oder viel zu selten. Im Gegenteil: Da wird räsoniert, dass namentlich die Frauen überfordert seien; der Anspruch der sog. Experten sei überstiegen; das alles sei so oder so Utopie und überhaupt nicht machbar etc. Das ist gerade so, als sei der Wert unserer Kinder, ihr Wohlergehen, ihre Seele geringer einzuschätzen als die Stabilität unserer Häuser oder unser gesundheitlicher Zustand. Warum kämpfen wir nicht für unsere Kinder, warum sind uns die möglichen und einzigen Garanten für eine bessere Welt so wenig wichtig? Warum schauen wir nur auf die kurzfristigen Billigziele des neuen Autos oder der neuen Küchenzeile oder des neuen Handys? So etwas ist wirklich nicht zu fassen!
Noch einmal zum Verständnis: Ich rede zwar von meinem Traum, aber auch von erreichbaren Zielen. Alles, was ich hier beschreibe, ist längst bekannt, das meiste ist überprüft und definitiv durchführbar. Aber es braucht dazu das Wachwerden der Menschen und die Erkenntnis, dass letztendlich nichts so wichtig ist, wie das Wohl des Einzelnen, insbesondere dann, wenn es sich dabei um einen kleinen, schutzbedürftigen Menschen handelt. Weder Gewinn, noch Zuwachs, noch Macht und Herrschaft, sondern nur liebevolles Miteinander und gegenseitige Rücksicht (und perspektivisch eine vernünftige, faire Umverteilung der Ressourcen) können diesen Planeten wieder gesund und schön machen und vielleicht sogar sicherstellen, dass das Leben für alle wieder lebenswert ist und Freude bringt.
Das alles erfordert eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Umdenken. Das Neugestalten müsste letztlich auf politischer Ebene stattfinden. Das Wohl des heranwachsenden Kindes sollte eine andere Priorität gewinnen; es müsste mehr Geld in die Bildung und Ausbildung von Erziehern und Pädagogen investiert werden; Schwangere und Eltern müssten entschieden mehr Informations- und Lernangebote bekommen für die Aufgaben, die ihnen bevorstehen, und die sie nicht so ohne weiteres delegieren können. Angesichts dessen, dass uns unsere Instinkte zur kindgerechten Betreuung unseres Nachwuchses leider nicht mehr so lebendig zur Verfügung stehen, erscheint mir diese Idee fast zwingend.
Andererseits sehe ich derzeit nicht, dass die Politik an diesem Thema sonderlich interessiert wäre. Die Mehrung des oberflächlichen Wohlstands und das wirtschaftliche Wachstum sind immer noch im Vordergrund. Und meine Ideen und Thesen stehen dem gegenüber durchaus im Widerspruch, wie Sie vielleicht schon jetzt verstanden haben.
Letztendlich sind eben doch Sie als Eltern angesprochen; Sie sind diejenigen, die vor Ort gefordert werden. Es geht also um Ihre persönliche Einsicht und Bereitschaft, sich auf meine Darstellungen einer kindgerechten und liebevollen Führung und Anleitung des Nachwuchses einzulassen.
Bitte betrachten Sie aber alle Überlegungen, die das Wünschenswerte betreffen, als Ideen, die zwar schon denkbar sind, aber nicht immer so leicht umgesetzt werden können. Und Hinweise auf möglicherweise problematische Entwicklungen Ihrer Kinder verstehen Sie bitte als Anregungen und Mahnungen, nicht als unsinnige Aufforderung zu unnützen Schuldgefühlen! Denn: Wir sind keine Roboter; und auch wenn wir noch so guten Willens sind, Fehler werden immer wieder passieren.
Der bekannte Familientherapeut Jesper Juul hat einmal gesagt, dass wir nicht perfekt sein müssen und durchaus auch eine Menge Fehler machen könnten, die Hauptsache sei aber, dass wir die Kinder richtig wahrnehmen und sie gleichwürdig in ihren Bedürfnissen respektieren.
A WORUM ES GEHT
DIE DREI ASPEKTE
Der Titel des Buches lautet: „ICH GENÜGE SCHON WIEDER NICHT!“ Dies ist die ohnmächtige und oft sehr verzweifelte Selbstanklage angesichts einer letztlich unklaren Definition dessen, was den Wert einer Person ausmachen könne. Da klingt das häufig beschriebene Selbstwertgefühl an und die in diesem Zusammenhang so oft beklagten Minderwertigkeitsgefühle. Die Lösung eines solchen Selbstwert-Problems ist jetzt aber nicht etwa ganz platt der Glaube an das Gegenteil: Ein „Ich genüge“ oder ein '"Ich schaffe das schon und bin toll!“ ändert schließlich nichts an dem anscheinend unwidersprochenen Maßstab des irgendwie Genügen-Müssens. Auch ein „Ich bin o.k. so, wie ich bin" impliziert einen ähnlichen Maßstab, von dem man denkt, dass man ihn selbst erfunden habe. Meiner Ansicht nach sind all diese Selbst-Bewertungen eine massive Vernebelung der eigentlichen Problematik, weswegen ich den Untertitel: DER „SELBSTWERT“ - EINE LÜGE gewählt habe.
Knapp gesagt: Mir geht es um den besonderen Urzustand des Fötus und des Kleinkindes, grundsätzlich richtig und daher irgendwie mit sich im Reinen zu sein. Diesen Zustand sehe ich als normal und gesund an. Er ist dem Menschen praktisch von der Zeugung an mitgegeben. Das kann ich nicht beweisen, und mit unserem Vokabular ist dieser Zustand auch nur dürftig zu beschreiben, weil er weder während der Schwangerschaft noch danach bewusst noch bewusstseinsfähig ist. Aber wer käme denn auf die Idee zu vermuten, der Fötus habe so etwas wie einen grundsätzlichen, praktisch genetisch vorgegebenen Zweifel an seiner Existenzberechtigung und würde - wenn er überhaupt schon denken und entsprechend fühlen könnte - seiner Geburt mit panischer Sorge entgegensehen, ob er den dann zu erwartenden Ansprüchen der Umgebung genügen könne?
Wir werden allerdings sehen, dass dieser von mir postulierte Ausgangszustand äußerst fragil ist. Das junge Leben ist zunächst vollständig darauf angewiesen, durch entsprechende Begleitung und Behandlung seitens der wesentlichen Bezugspersonen (im Folgenden mit WB abgekürzt) von Anfang an in diesem Zustand gehalten zu werden. Nur so kann es sich diesbezüglich so entwickeln, wie es seinen optimalen Möglichkeiten entspricht. Natürlich spielt die konkrete Lebensumgebung, in der das Kind aufwächst, ebenso eine wesentliche Rolle für seine Entwicklung wie auch spezifische Parameter der Einstellungen, Werte und Haltungen der WB. Darauf werde ich später eingehen.
Lassen Sie mich hier grob aufzeigen, welche Aspekte der individuellen Entwicklung ich darstellen und genauer betrachten will:
Aspekt I: Urvertrauen und die Erfahrung der bedingungslosen Liebe: Es gibt diesen gesunden Urzustand des Richtigseins als natürliches Phänomen, für das wir Menschen nichts tun müssen. Die WB sollten dafür Sorge tragen, dass dieser Zustand schon während der Schwangerschaft und namentlich nach der Geburt des Kindes aufrecht erhalten bleibt. Das wäre meines Erachtens das Ideal.
Aspekt II: Aufbau eines Selbstwertgefühls durch Orientierung an Leistung, der Irrweg:
Die WB (er)kennen diesen Urzustand selber nicht und lehren die Kinder ihre Selbstdefinition über Leistungen. Das führt oft zu psychischen und physischen Zusammenbrüchen; Zusammenhänge werden aber zumeist geleugnet.
Das ist der Problemzustand.
Aspekt III: Bemühungen, im Problemzustand aufgewachsenen Kindern zu helfen:
WB könnten sich bemühen, auch später noch die Fehlentwicklung ihrer Kinder zurück zu drehen. Derartige Bemühungen sind begrenzt, aber nicht hoffnungslos!
Es besteht auch die Möglichkeit, als Erwachsener selbst daran zu arbeiten, dem Urzustand wieder näher zu kommen. Das wäre sicher auch die beste Grundlage, den eigenen Kindern zu helfen.
In Bezug auf alle drei Aspekte ist der Verlauf der Schwangerschaft wesentlich für die Weiterentwicklung des Menschen, denn die Erlebnisse während dieser Zeit sind die Basis dafür, wer wir nach der Geburt sein könnten. Wer wir dann tatsächlich werden, wird maßgeblich durch das Engagement und das Verhalten unserer WB in der Säuglings- und Kleinkindzeit beeinflusst. Und ob wir unsere Kinder oder uns selbst auch später noch verändern können, hängt natürlich auch wesentlich von unserer bisherigen Geschichte ab.
Sie haben vielleicht schon verstanden, dass dieser Text an erster Stelle gedacht ist für diejenigen, die Eltern werden wollen und den Anspruch haben, ihre Aufgabe im Sinne der gleichwürdigen Leitung und Behandlung ihrer Kinder möglichst gut und richtig zu machen. Und zweitens natürlich auch für diejenigen, die schon Eltern sind und sich nun vielleicht betroffen fühlen. Aber Kinder, die mehr oder weniger tief in den Brunnen gefallen sind, müssen darin ja nicht ewig schmoren. Man könnte ja zumindest versuchen, sie da wieder heraus zu holen. Und schlussendlich gelingt es mir vielleicht sogar, Sie, die Sie ja auch mal ein Kind waren und vielleicht auch unter den Unsicherheiten und Fehlern Ihrer Eltern gelitten haben, mit Ihrer persönlichen Geschichte ein wenig zu versöhnen und Ihnen zu helfen, Ihr Leben in Zukunft etwas befriedigender zu gestalten.
Bevor es weitergeht, möchte ich noch ein paar grundsätzliche Bemerkungen vorweg schicken: Dieses Buch ist weder ein umfassender Erziehungsratgeber noch eine fundierte, wissenschaftliche Abhandlung. Meine Ideen und Vorstellungen schöpfe ich insbesondere aus meinen beruflichen Erfahrungen mit meinen Patient*innen, komme aber natürlich auch nicht umhin, gelegentlich die Sichtweisen kompetenterer Berater und Autoren zu zitieren. Ich möchte dazu beitragen, dass wir über uns und unsere so selbstverständliche Art des Lebens und Zusammenlebens auf eine vielleicht neue und eventuell sogar spannende Art und Weise nachdenken können. Im Wesentlichen werde ich aber versuchen, Ihnen meine Überzeugungen über den Widerspruch zwischen dem selbstverständlichen Urzustand und der aufgepfropften Leistungsorientierung etwas näher zu bringen. Ich werde darlegen, wie schnell und unbedacht wir trotz guter Absichten unseren Kindern immer wieder Schaden zufügen und an Beispielen verdeutlichen, wie sie meiner Meinung nach vor einer Fehlentwicklung geschützt werden können.
Es geht letztendlich um einen Paradigmenwechsel.
Alle Eltern müssen im Lauf ihrer Elternarbeit lernen, wie sie diesen Job möglichst gut machen können. Warum also dann nicht gleich so lernen, dass wir das eher und leichter erreichen können, was wir eigentlich immer schon wollten: Zufriedenheit unserer Kinder mit sich selbst, ein stabiles In-Sich-Ruhen, Freude am Leben, Freude am Tun an sich, Fähigkeiten, mit anderen glücklich und harmonisch zusammen sein zu können, Frieden.
Ich werde wohl keine Umstürze erreichen, aber es könnte ja sein, dass der eine oder die andere von Ihnen erkennt, dass meine Vorstellungen letztlich umsetzbar wären. Dass wir z.B. als Eltern von kleinen Kindern darauf achten können, sie in ihrer Einzigartigkeit zu bestätigen, ohne der Gefahr zu erliegen, sie zu egozentrischen Narzissten oder kleinen Leistungs-Monstern zu erziehen. Eigentlich kann ich wirklich nur sagen: „Ich habe einen Traum!“
Ich bin übrigens überzeugt, dass das oben erwähnte Publikum dieser Schauspielerin deswegen applaudiert hat, weil es irgendwie und vielleicht recht wenig bewusst erahnt hat, was sie meinte. Aber das eben nur erahnt und nicht wirklich benennen könnend. So wie man manchmal ganz begeistert von irgendetwas ist und sich erst hinterher fragt, wovon eigentlich genau und manchmal keine wirklich schlüssige, befriedigende Antwort findet. Vermutlich verstand auch die Schauspielerin die volle Bedeutung ihrer Äußerung nur sehr undeutlich. Wenn sie und das Publikum das hätten genauer erklären sollen, dieses man selbst sein, dann wären sie sicher schwer ins Schwimmen gekommen. Und im Zweifelsfall wären sie dann vermutlich doch wieder bei irgendeiner egozentrisch angehauchten Definition nach Art von etwas Besonderes sein gelandet.
Hinweis:
Damit das Buch auch lesbar ist und Spaß macht, habe ich auf komplizierte Fachbegriffe und Fußnoten im Wesentlichen verzichtet. Dennoch muss ich mich einiger theoretischer Konstrukte bedienen wie „Selbst“, „Urzustand“, „Selbstwertgefühl“, etc. Das sind alles nur Worthülsen, um sich sprachlich bewegen und sich miteinander einigermaßen verständlich machen zu können. Wesentliche, wiederkehrende Begriffe werden im gesamten Text kursiv gedruckt.
Im Text beziehe ich mich häufig auf die Aufgaben und Aktivitäten von Vater und Mutter. Ich möchte hier betonen, dass ich diese Form wegen der einfachen Lesbarkeit wähle, damit aber immer auch die anderen denkbaren Paarkonstellationen (und selbstverständlich auch die Alleinerziehenden) impliziere. Überdies habe ich mich bemüht, eine gendergerechte Sprache zu benutzen.Wenn mir dies nicht überall gelungen sein sollte, so bitte ich um gnädige Nachsicht.
DIE AUFSCHLÜSSELUNG DES IST-ZUSTANDES
Ich war als Psychologischer Verhaltenstherapeut fast 40 Jahre in privater Praxis tätig. Lassen Sie mich Ihnen etwas aus meiner beruflichen Erfahrung erzählen, was langsam aber sicher dazu beigetragen hat, dass ich mich getrieben fühlte, dieses Buch zu schreiben.
Stellen Sie sich folgende Situation vor, die ich so oder so ähnlich häufig genug erlebt habe: Vor mir sitzt ein Mann, Mitte Vierzig, gut aussehend, gut gekleidet, gebildet, höherer Angestellter, verheiratet, zwei Kinder. Und er behauptet, dass er sehr oft in dem Gefühl lebe, mickrig, unwichtig, wertlos und letztlich ein Versager zu sein und daher manchmal von einer depressiven Verstimmung in die nächste taumele. Da stimmt doch etwas nicht! Wie kann denn so was sein!? Der Mann hat doch augenscheinlich alles, was man sich in unserer Gesellschaft wünschen kann, und trotzdem klagt und jammert er. Ein Jammern auf sehr hohem Niveau, und manch einer mag dazu jetzt denken: „Dessen Probleme möchte ich haben!“ Und dennoch: Der Mann sagt zwar (und man könnte sich vorstellen, wie er dabei wie in einer alten, bekannten Werbesendung entsprechende Fotos auf den Tisch klatscht): „Meine Frau / meine Kinder / mein Job / mein Auto / mein Bankkonto!… und dann dennoch: meine Depressionen / meine Suizidgedanken.“ Trotz all der augenscheinlich vielen positiven Gegebenheiten ist dies offenbar sein subjektives Empfinden: Er fühlt sich klein und unwichtig und als Versager. Und mit der Einschätzung des offensichtlichen Widerspruchs seiner Aussagen fühlt er sich vielleicht auch ziemlich verrückt und schämt sich dafür, so zu fühlen. Aber für ihn stellt sich sein Leben so dar. Und er leidet.
Kennen Sie das auch? Können Sie das nachempfinden? Und kommt Ihnen das letztendlich nicht auch manchmal sehr merkwürdig vor?
Wie auch immer: Klein und wertlos zu sein – das ist eine Selbstsicht, die keiner von uns erleben möchte. Wir wollen uns sicher fühlen, anerkannt und wichtig sein. Und die anderen sollten das auch sehen und positiv bewerten. Aber offenbar bekommt man das gar nicht so einfach und selbstverständlich hin. Sehr viele Menschen in unserem Kulturkreis fühlen sich immer wieder klein und minderwertig, haben massive Angst vor dem Versagen und der Blamage, vor dem Ausgegrenztwerden, vor dem Verlassenwerden, dem Liebesentzug.
Sie denken jetzt vielleicht, dass das doch völlig normal sei, dass man diese Ängste hat; wer wolle denn schon gerne als Versager dastehen oder abgelehnt oder verlassen werden. Aber genau das ist der springende Punkt. Die wesentliche Frage ist doch nicht, ob es normal oder auch nur nachvollziehbar ist, unter diesen negativen Erfahrungen zu leiden oder sie zu fürchten. Natürlich ist das normal im Sinne von: Wenn so viele Menschen dies erleben, dann muss es ja wohl irgendwie richtig, also normal sein. Aber die wirklich wichtige Frage ist doch, ob diese von uns als so selbstverständlich hingenommene Normalität des „Man sollte in allem optimal sein und funktionieren!“; „Man sollte keine Fehler machen!“; „Man sollte sich anpassen“; „Man sollte gesehen werden und Bestätigung finden“; dieses „man sollte, man sollte, man sollte“ tatsächlich selbstverständlich und damit richtig und auch irgendwie psychisch und physisch gesund ist. Beispiel: Ein sehr hoher Prozentsatz der Amerikaner*innen ist schwer übergewichtig. Man könnte hier durchaus von einem normalen Zustandsbild reden. Aber ist diese Normalität dann auch gleichzeitig wünschenswert oder gar gesund? Wieso soll ich als normal und daher auch irgendwie o.k. ansehen, dass Personen wie der oben genannter Patient Angst vor dem Versagen haben, obwohl doch alles in seinem Leben perfekt zu sein scheint? Und was ist daran gesund, wenn ich mich außerhalb des therapeutischen Settings umsehe und bei Freunden, Bekannten, Verwandten sehr oft die gleiche Feststellung mache: Da wird ein guter und gut situierter Freund aus heiterem Himmel depressiv und selbstmordgefährdet; da fühlt sich ein Vater vollkommen als Versager angesichts der für ihn nicht akzeptablen Lebensentscheidung der Tochter; da bricht eine langjährige gute Freundin den Kontakt ab, weil sie mal eine deutliche Kritik an ihrem Verhalten hat hinnehmen müssen.
Minderwertigkeitsgefühle, Selbstunsicherheit und die Angst vor Ablehnung und dem Verlassenwerden scheinen ziemlich weit verbreitet zu sein. Sollte das eine Form der angestrebten Normalität sein? Ich finde nicht!
In diesem Buch soll es also auch darum gehen zu klären, warum das so ist, weshalb z.B. diese Selbstzweifel so massiv um sich greifen; wieso so eine große Unzufriedenheit herrscht; weswegen viele Menschen so pessimistisch sind, so antriebslos, so überdrüssig; wieso sich so viele überfordert fühlen oder sich selbst überfordern und dabei krank werden; und wie es kommt, dass dies alles zur Normalität geworden zu sein scheint. Und warum wir schließlich die Aufforderung, uns mal „am Riemen zu reißen“ oder uns „nicht so anzustellen“, einfach so zu akzeptieren bereit sind.
Ich möchte Ihnen auch vermitteln, was Eltern dafür tun könnten, um die hier angeführten sogenannten Normalitäten zu verhindern und ihren Kindern einen gesünderen Start ins Leben zu ermöglichen.
Meine Geschichte
Ich möchte Sie jetzt gerne dazu einladen, mich ein kurzes Stück auf meinem eigenen Weg zu meinem Verständnis dieser Thematik und den daraus abgeleiteten Fragen und Antwortversuchen zu begleiten. Ich denke, dass Sie auf diese Weise leichter Zugang zu meinem Ansatz bekommen, der - das kann ich hier gerne zugeben - schon bekannte Erkenntnisse zum Vorbild hat.
Zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit beschäftigte ich mich gewissermaßen ausbildungskonform und weisungsgemäß und bedingt durch die Vorgaben der Kassenärztlichen Vereinigung mit den Problemen, die die Patient*innen spontan oft schon beim ersten Kennenlernen im therapeutischen Setting äußerten. Das war dann der Therapieauftrag. Sie sagten z.B.: „Ich fühle mich oft so schlapp und antriebslos und möchte endlich wieder in die Puschen kommen!“; „Ich weiß auch nicht, wieso ich immer solche Angst vor solchen einfachen Situationen habe, bin ich nun verrückt oder was!?“; „Eigentlich bin ich ein ganz Friedlicher, aber manchmal raste ich einfach aus, und das kriegt dann meine Frau ab. Das ist doch… das will ich nicht mehr!“. Die Patient*innen konnten oft sogar so etwas wie eine Diagnose benennen (Depression, soziale Angst, Zwanghaftigkeit, Aggression etc.), und diese waren für sie gewissermaßen die Eintrittskarten für eine Psychotherapie. Und ich wusste, wie ich damit umzugehen hatte. Ich behandelte also depressive Patient*innen wegen ihrer depressiven Verstimmungen und ängstliche Patient*innen wegen ihrer Ängste. Durchaus mit Erfolg, d.h. die Ängste wurden geringer oder verschwanden ganz, die Depressionen hellten sich auf, sodass die Patient*innen wieder arbeiten und sich einigermaßen des Lebens erfreuen konnten. Letztendlich schienen meine Bemühungen aber doch nicht immer so erfolgreich gewesen zu sein, weil einige Patient*innen nach gewisser Zeit erneut erschienen mit dem gleichen oder einem ähnlichen Symptomkomplex, oder ich erfuhr, dass sie einen anderen Therapeuten mit einer anderen Methode aufgesucht hatten. Irgendwann kam ich nicht mehr umhin, feststellen und akzeptieren zu müssen, dass sich sehr oft hinter diesen typischen Problemmustern auch noch dieses andere, offenbar tiefer liegende Problem des Minderwertigkeitsgefühls verbarg. Und zeitgleich - so kann ich mich entsinnen - las ich in einer Fachzeitschrift, dass irgendein international renommierter Psychotherapeut geäußert hatte: „… dass wir Therapeut*innen in unserem täglichen Bemühen um unsere Patient*innen letztendlich doch immer nur eines zu erreichen versuchen: Dass sie sich selber besser annehmen können!“ Das hieß also im Klartext: Es gehe bei den vielen Personen, die sich in Psychotherapie befinden, und sicherlich nicht nur bei diesen, letztlich um diese Minderwertigkeitsgefühle, also um die Selbstwertproblematik und um das Thema der Selbstannahme. So ganz klar ist mir diese Aussage dennoch nicht geworden, weil ich nicht wusste, was die Kollegen mit dieser Selbstannahme und dem Selbstwertgefühl gemeint haben. Denken Sie an den oben erwähnten Urzustand des Mit sich im Reinen Sein, ohne etwas dafür tun zu müssen! Damals aber wurde mir aber auch ziemlich erschreckend bewusst: Ich hatte eigentlich selbst keine wirkliche Ahnung, kein schlüssiges Konzept davon, was unter diesem zumindest wohl unter Psycholog*innen als bekannt vorausgesetzten Selbstwertgefühl zu verstehen sei. Asche auf mein Therapeutenhaupt! Es schien aber klar zu sein, dass es so etwas wie das Selbst geben solle, dem man einen bestimmten Wert beimessen kann. Und je besser oder größer dieser Wert sei, desto zufriedener sollte man sich wohl fühlen.
Naja, das sagt sich so leicht.
Ich habe damals zunächst eine Reihe einschlägiger Bücher zum Thema „Selbstwertgefühl“ gelesen und war recht erstaunt, wie umfangreich die Liste der diesbezüglichen Veröffentlichungen war. Ich las auch, dass besonders in den USA diese Liste noch viel gewaltiger sei. Es war ziemlich offensichtlich, dass dieses Thema auch international ein großes Interesse findet, und dass offenbar wohl doch gar nicht so eindeutig klar und selbstverständlich ist, was denn eigentlich dieses Selbstwertgefühl sei bzw. was damit gemeint sein könnte. Das hat mich bezüglich meiner Unwissenheit recht schnell beruhigt. Ich muss allerdings gestehen, dass ich mit der Lektüre auch nicht so richtig glücklich und zufrieden geworden bin. Vielleicht waren es die falschen Bücher, die ich mir ausgesucht hatte. Schließlich habe ich damit aufgehört und mir meine eigenen Gedanken gemacht, die sich, wie ich schon erwähnte, dann letztlich doch als schon bekannt und schon längst gedacht entpuppten. Dennoch: Heute bin ich froh über diese Entscheidung. Ich hätte vermutlich meine Sichtweise, die ich Ihnen hier näher bringen möchte, nicht oder nicht so entwickeln können. Ich ahnte nämlich, dass ich bei einem Großteil der Lektüre der einschlägigen Literatur vermutlich immer wieder das Übliche erfahren würde:
• Selbstwertgefühl ist die Zufriedenheit, die ich aus den Vergleichen mit anderen ziehe bezüglich dessen, was sie und ich können und haben.
• Es ist auch dieses „Ich bin zufrieden mit mir, so wie ich bin“.
Letzteres klingt ja vielleicht zunächst ganz vernünftig, entpuppt sich aber beim genaueren Hinsehen und Hindenken auch als ein „Ich bin so und so, kann also dies und jenes und denke und verhalte mich so und so, und das erfüllt mich mit dem O.K.-Gefühl“. Also letztlich auch wieder: Bewertung der eigenen Person über irgendeine Form von Leistung. Das alles kannte ich, aber es war überhaupt nicht überzeugend.
Natürlich gibt es schon lange völlig andere Sichtweisen wie z.B. in den Schriften von Erich Fromm, der zwischen Sein und Haben unterschied oder in jüngerer Zeit, aber auch schon wieder ca. 40 Jahre alt, die Thesen von Albert Ellis, der propagierte, Eltern sollten ihre Kinder so behandeln, dass diese sich selbst bedingungslos annehmen können. Und auch Alice Miller betonte immer wieder die Bedeutung der liebevollen Haltung der WB für das gesunde Aufwachsen ihrer Kinder.
Ich befürchte allerdings, dass diese Menschenbilder heute nicht sonderlich verbreitet und nicht sehr populär sind. Die Vorstellungen von einem irgendwie leistungs- und erfolgsbestimmten Selbstwertgefühl ist immer noch Standard, und das ungute Gefühl, das ich dabei empfand, veranlasste mich, noch einmal genauer darüber nachzudenken, was denn der eigentliche, wünschenswerte Grundzustand sein könne, und wie sich andererseits dieses sog. Selbstwertgefühl entwickelt, dem wir alle so angestrengt und engagiert, aber letztlich wohl oft ohne dauerhafte Zufriedenheit hinterher zu hecheln scheinen.
Mir fiel in dem Zusammenhang der Satz ein, der in großen Lettern auf der Stirnseite der Turnhalle des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums in Gütersloh stand, welches ich ab 1955 besuchte: „Nicht auf das Beste, auf Dein Bestes kommt es an“. Damals war ich wirklich beeindruckt von der scheinbar klaren Weisheit dieser Aussage: „Vergleiche Dich nicht mit anderen, sondern sei zufrieden mit Deiner Bestleistung!“. Das machte mich fast ein wenig glücklich. Kein Wunder: Ich war ein guter Sportler, zumindest in der Halle. Beim Fußball spielte ich zumeist keine Rolle oder störte eher. Im Hallensport konnte ich aber relativ leicht mein Bestes geben, was manchmal sogar fast dem Besten entsprach. Komischerweise fiel mir aber nicht auf, dass ich diesen Satz in vielen anderen Schulfächern nicht anwendete. Warum nicht? Ganz einfach: Sagen Sie sich mal locker, dass es auf Ihr Bestes ankomme, wenn der Lehrer nach der Lateinklassenarbeit Ihr Heft durch die Klasse schleudert und dabei noch verächtlich kommentiert: „Na, Flöttmann (oder wie auch immer Sie heißen mögen), schon wieder eine Fünf!?“. Das ist in meinem Fall tatsächlich mehrfach so geschehen. Dabei hatte ich doch gemäß dieses Spruchs ganz sicher mein Bestes gegeben, hatte mich wirklich bemüht, mich vorbereitet, gelernt, geackert etc., aber dem Lehrer, der sicher dieses tolle Zitat aus der Turnhalle auch kannte, fiel jetzt nichts Besseres ein als dieser dämliche, respektlose Kommentar. Ich saß in der hinteren Schulbank und heulte leise vor mich hin, aber da war niemand, der mich tröstete, ich hätte doch alles gegeben. Eine Fünf ist eben eine Fünf, ist mangelhaft und verachtenswert, ist mies im Vergleich mit einer Vier oder einem Befriedigend, ist im Klassenvergleich schlicht Ausschuss. Selbst einige Klassenkameraden guckten mehr oder weniger verächtlich. Sie kennen sicher diese Typen! Und auch meine Mutter wusste später nichts anderes zu sagen als: „Dummer Junge, was liest Du auch immer nur diese Comics, streng Dich gefälligst mehr an!“. Vater entzog wortlos das Taschengeld und demonstrierte Enttäuschung.
Das Beste aus sich herauszuholen und dabei Anerkennung zu erlangen oder auch nur einigermaßen zufrieden sein zu können, war offenbar nur möglich, wenn mein Bestes zumindest besser als der Durchschnitt war.
Heute frage ich mich, was wohl meine unsportlichen Mitschüler empfunden haben mögen, die sich beim Hallensport unter dem Wand- spruch Nicht auf das Beste - auf Dein Bestes kommt es an! vergeblich am Reck abmühten. Mein fünf Jahre älterer Bruder konnte aus seiner Schul- zeit von einem alten Turnlehrer berichten, der z.B. derartige Situationen verächtlich mit den Worten zu kommentieren pflegte: „Jetzt guckt euch doch mal den dicken Meyer an, wie er seinen Wanst und sein Gemächte über die Stange hievt!“ Spitzenleistung, Herr Studienrat!! „Auf Dein Bestes…“
Es kommt in dieser Gesellschaft eben nicht auf mein Bestes an.
Das ist schlicht gelogen!
Damals wie heute.
Entweder ist das, was ich leiste, allgemeiner Durchschnitt; damit ist es aber auch nicht erwähnenswert, also auch nicht wirklich befriedigend. Mein Vater hätte höchstens gesagt, dass ich das sicher noch besser kön- ne. Oder die Leistung ist überdurchschnittlich gut. Erst dann kann sich vielleicht wirklich ein gewisses Hochgefühl einstellen, das sich anfühlen könnte wie ein „Ich bin o.k.“. Allerdings auch nur für gewisse Zeit.
Übrigens habe ich zu allem Überfluss später feststellen können, dass dieser Spruch an der Wand der Turnhalle von den Nationalsozialisten geprägt wurde, und die Künstler in der Schule hatten offenbar sogar das gleiche Schriftbild gewählt.
(gesehen auf: https://umedia.lib.umn.edu/item/l p16022coll208: 2549).
Und ich kann mir nun auch denken, aus welchem Loch dieser alte Turnlehrer meines Bruders ca.l 1950 gekrochen kam! Wirklich beeindruckend: Ein alter Nazispruch letztlich noch mindestens bis 1965 in der Turnhalle eines evangelischen Gymnasiums! Und natürlich einer, der in die falsche Richtung führte. Es wird hier einfach und frech über eine Vorannahme definiert, worauf es im Leben ankomme, nämlich auf das Streben nach Leistung. Und dabei verkauft dieser Spruch das so, dass jede Leistung, allerdings natürlich auch nur die individuelle Bestleistung, die individuelle Höchstanstrengung, als willkommen und anerkennenswert angesehen werde.
Gelogen!
Vielleicht können Sie sich auch daran erinnern oder haben davon gehört: In den 68zigern hatten viele radikal-bewegte Studenten auf dem Heck ihres Renault 4 oder ihres VW-Käfers oder 2CV das Spruchband geklebt: „Hast Du heute schon Dein Kind gelobt?“. Fand ich in meiner Naivität damals zunächst auch toll. Als hätten mir meine studentischen Kollegen mit diesem Spruch direkt aus dem Herzen gesprochen und bestätigt, wie gut und richtig es gewesen wäre, wenn meine Eltern mich in meiner Kindheit und Jugend mehr gelobt hätten. Einmal gelobt zu werden für irgendetwas erweckte in mir, wenn ich zurückblicke, immer so etwas wie das Gefühl meiner Existenzberechtigung. Lob als Hinweis darauf, dass ich es richtig machte und also dazugehören durfte und am richtigen Platz war. Denn wenn ich es richtig machte, dann fühlte es sich auch so an, als sei ich richtig: „Wenn ich das gut hinkriege, dann bin ich o.k.“; „Habe ich eine tolle Freundin, bin ich der King“; „Bin ich großzügig und freundlich, dann bin ich der Held“ etc.
Kommt Ihnen das auch bekannt vor? Haben Sie vielleicht auch diesen Druck gespürt und unter dem Drill und der ausgesprochenen oder für selbstverständlich erachteten Erwartungshaltung gelitten?
Meine Erfahrung war leider auch, dass sich das ersehnte Gefühl des Nun bin ich (wer), von dem ich naiv annahm, es sei das zu erwartende und also auch selbstverständliche Ergebnis meiner Leistungen, einfach nicht wirklich einstellen wollte. Ich hatte durchaus Erfolge (Freunde, Frauen, Beruf), aber wenn ich dachte, ich könne mich zurücklehnen, die Beine ausstrecken, die Hände hinter dem Kopf verschränken und vor mich hin murmeln: „Es ist geschafft, ich habe es geschafft, nun bin ich, und ich bin o.k.“, dann musste ich immer wieder feststellen, dass das nicht funktionierte. Die Erfahrung war vielmehr, dass ich diesen Erfolgsjubel fast mit Schuldgefühlen erlebte, und alsbald ein anderer Satz in meinem Kopf herumspukte: „Jetzt ruhe dich bloß nicht auf deinen Lorbeeren aus!“
Was ist das Selbst?
Das machte alles überhaupt keinen Sinn. Und meine Patient*innen in den Therapien bestätigten genau dies: Weitgehend unabhängig von ihrer tatsächlichen Situation, z.B. arbeitslos, geschieden, krank; oder beruflich erfolgreich, anerkannt, familiär stabil und weitgehend gesund, erlebten viele ihren Alltag als sinnlos, waren unzufrieden mit ihren Tätigkeiten, schätzten ihre Erfolge als allzu vergänglich ein und waren sich immer wieder unsicher in ihren Beziehungen.
Das heißt also: Das Konzept des stabilen Selbstwertgefühls, abgeleitet aus Leistung, Anstrengung, Vergleich mit anderen oder mit mir selber nach dem Motto: „Schau, da und da bist du ja schon richtig gut geworden! Freu dich doch!“ funktioniert offenbar doch nicht so, wie manch einer es sich erhoffen mag, und wie er meint, dass es ihm versprochen sei und ihm also zustünde.
Was tun wir also? Frei nach Paul Watzlawick, einem Kommunikationstheoretiker, machen wir weiter und mehr desselben. Denn es gibt immer neue, aufregende und spannende Wege, dieses Ich bin zu erwerben. Wir springen an Seilen von Brücken, wir machen ewig Party und Action, und wenn wir dazu nicht das Aussehen, das Geld oder die Gelegenheit haben, tummeln wir uns aus den gleichen Gründen im Internet, in den Rollenspielen der Avatare, schießen täglich viele Selfies mit dem Handy und versuchen, uns großartig darzustellen in den sozialen Medien: Punkte sammeln, Likes, anerkennende Sprüche. Und das Ende dieses Wahnsinns ist noch gar nicht abzusehen! Es scheint immer um irgendeine Identität, um das Sich-Spüren, um das Ich bin und das Schaut her! zu gehen. Und ich habe den Eindruck, dass all diese Versuche, dieses Meine Yacht, mein Haus, mein Auto, meine Frau etc. an dem Eigentlichen vorbeigehen.
Aber was ist denn nun das Eigentliche? Was meinte die eingangs erwähnte Schauspielerin und offenbar auch das Publikum mit dem Man selbst sein? Was ist das eigentliche Selbstwertgefühl oder wie sollte es eigentlich sein? Und was ist denn nun genau dieses Selbst, zu dem man ja offenbar eine Werteproblematik entwickeln kann?
Manchmal kommt man dem Verständnis einer Sache näher, wenn man die Bestandteile eines Wortes hinterfragt. Hier also Selbst und Wertegefühl. In unserer Sprache kennen wir eine Menge Worte, die mit dem Präfix Selbst- beginnen: Selbst-Bewusstsein, Selbst-Vertrauen, Selbst-Achtung, Selbst-Verwirklichung, Selbst-Sicherheit etc. Ich habe einfach einmal viele davon aufgelistet und durchdacht, aber klarer wurde mir dadurch leider auch nicht, was das Selbst allein ist. Schließlich fand ich dann aber einen kleinen Spruch, der mir zu einem besseren Verständnis verhalf: „Nachahmung ist Selbst-Mord“. Der Spruch ist natürlich eigentlich ziemlicher Unsinn, weil z.B. kleine Kinder auf die Nachahmung ihrer Eltern geradezu angewiesen sind, aber für mich war er in diesem Zusammenhang und an dieser Stelle dennoch hilfreich.
Es soll also demnach etwas zu ermorden geben, wenn man andere nachahmt.
Stellen wir uns dazu Folgendes vor: Ich übernehme alle Eigenschaften von Elvis Presley und zwar mit allem Drum und Dran, sein Auftreten, seinen Gesang, seine Erinnerungen, seine Wünsche und Hoffnungen, seine Eitelkeiten, seine Essens- Schlaf- und sonstige Gewohnheiten, einfach alles. Und wissen Sie was? Ich weiß insgeheim immer noch, dass ich der Flöttmann bin und Elvis nur nachahme. Da kann ich machen, was ich will. Ich bin jetzt vielleicht der beste Elvis-Imitator in Las Vegas, aber hinter der Bühne bin ich eben immer noch der Flöttmann. D.h. der Satz - „Nachahmung ist Selbstmord“ - ist schlicht falsch und führt in die Irre. Er müsste eher heißen: „Nachahmung ist ein Selbst-Mord-Versuch“. Welcher nicht gelingen kann. Und das wiederum bedeutet, dass dieses Selbst etwas sein muss, an dem die Nachahmung von etwas Benennbarem vollständig vorbei geht, und was logischerweise dann auch nicht ermordet werden kann. Es kann mit all dem, was wir tun, denken, fühlen, bewirken, schaffen und uns anschaffen können und auch mit dem, was und wie wir uns darstellen können, nichts zu tun haben. Es muss irgendwie davon unabhängig sein. Mit dem Selbst muss also eine Art eigenständige Instanz oder Energie gemeint sein.
Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen kleinen Einschub: Im Laufe meiner therapeutischen Arbeit hat es sich immer wieder als hilfreich erwiesen, meine Vorstellungen und Ideen in bildhafte Metaphern zu übersetzen. Diese inneren Bilder sollten den Patient*innen einerseits helfen, die Ideen besser zu verstehen und andererseits die Kommunikation mit ihnen durch Anwendung von Kürzel aus dem Metaphernrahmen zu erleichtern. Vielleicht hilft Ihnen das ja auch.
Die folgende Metapher soll den Unterschied zwischen dem Selbst und dem Rest von uns verdeutlichen:
Die goldene Kugel
Stellen Sie sich bitte folgendes leicht irres Bild vor: Sie und ich stehen vor einer großen Ballettspiegelwand, haben uns über unsere Körper von Kopf bis Fuß saubere Säcke gezogen und sehen durch die lichten Maschen des Stoffes da drüben im Spiegel diese beiden Säcke. Und dann werden diese Säcke langsam von unseren realen Körpern entfernt (während sie aber im Spiegelbild auf eine gewissermaßen verwunschene Art so bleiben), und es kommen darunter zwei strahlende, goldene Kugeln hervor (eine davon können Sie auch auf dem Titelbild bewundern).
Eine goldene Kugel ist Ihre und die andere ist meine. Diese beiden Kugeln sehen identisch aus; sie sind total gleichartig, und sie sind absolut gleichwertig. Und in dieser Metapher sind Sie die eine goldene Kugel, und ich bin die andere.
Und alles, was unter den Säcken da im Spiegel auch noch enthalten ist, ist alles andere von Ihnen und von mir, also das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen und das, was wir können und das, was wir haben.
Wenn man dieser Metapher folgt, dann können wir das sogenannte SELBST als das verstehen, was ich ganz oben den Urzustand genannt habe. Dieser existiert unabhängig von irgendeiner Leistung oder Bewertung. Er ist also das reine Lebendigsein, das allen Menschen gleicht. Und damit verbunden ist auch das unbewusste In Sich Ruhen und das Mit sich im Reinen sein. So gesehen ist der Urzustand natürlich kein irgendwie geartetes Gefühl, das wir im Körper verorten könnten.
Diesen Gedanken möchte ich zum Verständnis gerne noch etwas vertiefen: Wir werden als Menschen geboren und nicht (auch) als etwas anderes, z.B. als ein Zebra. D.h. wir kennen nur diesen einen Zustand: Menschsein. Wir können uns daher nicht als Menschen fühlen, weil es keine Alternative gibt. Ich kann nicht sagen: „Heute fühle ich mich als Mensch“ und: "Jetzt fühle ich mich als Zebra“. Ich kann auch nicht sagen: „Heute fühle ich mehr Menschsein als gestern“. Ein Gefühl hat man nur, weil man
a) die Abwesenheit dieses Gefühls spüren kann, also Freude / keine Freude,
b) und stattdessen eine Alternative wie: Trauer oder Gleichgültigkeit
c) oder eine Intensitätsveränderung des Gefühls, also mehr Freude (z.B. Begeisterung).
Wenn wir den Urzustand von Geburt an dauerhaft bestätigt bekommen, dann gibt es ebenfalls nur diesen. Er hat die gleiche Qualität wie das Menschsein: Es gibt nur diesen einen Zustand. Der ist daher ebenso unbewusst und auch nicht bewusstseinsfähig. Jemand im Urzustand kann nicht sagen „Ich bin jetzt im Urzustand…und jetzt bin ich es nicht“. Er könnte sagen: „Ich bin jetzt traurig“ oder so. Weil er natürlich auch den anderen Zustand des z.B. des Frohseins kennt. Aber den Urzustand kennt er nicht, er hat ihn oder noch genauer: Er ist ihn. Goldene Kugel halt.
Wenn wir allerdings diesen Urzustand nicht dauerhaft bestätigt bekommen, werden wir ständig Ersatzgefühle erleben müssen wie z.B. Stolz, Überlegenheit, Besonderssein, aber leider auch Unsicherheiten, Ängste etc., die unser Lebendigsein bzw. unseren Wert oder unsere Minderwertigkeit und unser Unglücklichsein signalisieren.
Nachahmung kann demnach also kein Selbstmord sein, denn egal wie gekonnt wir jemanden nachahmen, dieser Urzustand - im Bild der goldene Kugel - bleibt stets derselbe. Der Mord kann also nur all das betreffen, was in dem Sack ist.
In der hier vorgestellten Definition des Selbst sind alle Selbste dieser Welt a priori sowohl identisch als auch gleichwertig. Und gleichzeitig sind die Menschen jeder für sich einzigartig. In diesem Zusammenhang fallen mir die beeindruckenden Fotos von Richard Avedon ein (https:// www.pinterest.de/uweleder/richard-avedon/) oder auch die Portraits von bekannten Fußballspielern, die in überdeutlicher Schärfe und Belichtung oft zu Beginn einer Welt - oder Europameisterschaft gezeigt werden („Gegen Rassismus“). Diese Bilder zeigen, wie unglaublich unterschiedlich und damit so überwältigend einzigartig wir Menschen aussehen, jeder in seiner individuellen Schönheit. Kein Tattoo, kein Piercing, kein Korken im Ohr kommt an die Einzigartigkeit des individuellen Ausdrucks heran. Und der reicht für die Einzigartigkeit allemal aus!
Sie können das auch direkter haben: Schauen Sie einfach nur in den Spiegel. Sie sind auch eine(r) von den Einzigartigen! Und wenn Sie sich dessen bewusst werden, können Sie das Mantra formulieren: „Die/der da bin ich, und ich bin einzigartig, ohne etwas dafür tun zu müssen!… Und Du bist es auch!“ Letzteres als Hinweis darauf, dass man dieses Recht auf Einzigartigkeit nicht für sich gepachtet hat. Eine solche Haltung fördert Demut, Respekt und Toleranz auch und gerade vor der Andersartigkeit des anderen.
Meine Wahrnehmung ist allerdings, dass in unserem westlichen Kulturkreis diese grundsätzliche, immer vorhandene Einzigartigkeit jedes Menschen weder wirklich gesehen und verstanden noch gefördert wird. Schon gar nicht in dem Sinne, dass dafür nichts getan werden muss. Namentlich in unserer leistungsorientierten Gesellschaft kann eine solche Sichtweise ja auch nicht sonderlich populär sein. Aber viele von uns haben so etwas wie eine Ahnung von dieser selbstverständlichen Lebendigkeit, diesem Urvertrauen, dieser Einzigartigkeit. Aber eben nur eine Ahnung und vielleicht auch eine Sehnsucht, die vermutlich sowohl in der Reaktion des Publikums (oben) zum Tragen kam als auch häufig genug von meinen Patient*innen erlebt wurde.
Vielleicht haben ja auch Sie hin und wieder Kontakt zu dieser Ahnung. Und vielleicht haben auch Sie manchmal das stille oder sogar laut werdende Bedürfnis, nichts, aber auch gar nichts tun oder sein zu müssen und dennoch irgendwie zufrieden und mit sich im Reinen sein zu können.
Das Fremdwertgefühl
Nun könnte man aber durchaus auch auf die Idee kommen, die Einzigartigkeit des Individuums allein in der jeweiligen Persönlichkeit zu sehen. Diese wäre geprägt von den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zwar z.T. genetisch bedingt, später aber auch individuell geformt und gefördert werden könnten. Und heraus käme dabei dieses einzigartige Individuum, das sich zwar im Laufe seines Lebens ständig ändere, das sich aber stets liebend annehmen und mit sich zufrieden sein könne und ein hohes Selbst-Wertgefühl hätte. Im Ergebnis könnten sich also die so aufgewachsenen Personen als durchaus leistungsfähig, erfolgreich und kompetent entwickeln und ihren Platz in dieser Gesellschaft finden.
Bedenken Sie aber bitte noch einmal: Eine solche Haltung legt fest, dass wir von Anfang an unser Augenmerk darauf richten müssen, unseren sog. Selbst-Wert über Leistung zu definieren. Mit einer solchen Sichtweise würden wir aber genau in die Falle gehen, um die es mir hier geht, denn dieses Selbstwertgefühl beinhaltet den Begriff Wert. Eine Bewertung kann aber nur sinnvollerweise erfolgen, wenn es auch Unterschiede zwischen dem oder den zu Bewertenden gibt, und Vergleiche mit anderen angestellt werden können. Der Wertekanon für die Selbstbewertung wäre also das, was die Menschen von Anfang an in ihrem Elternhaus und in ihrer jeweiligen Kultur vorgefunden und übernommen haben. Der Selbst-Wert müsste somit gesehen werden als die Summe dieser Werte in ihrer jeweiligen individuellen Ausprägung, die jemand momentan auf den Markt der Vergleiche mit anderen werfen kann. Mit dieser Sichtweise würde aber dieses Urvertrauen, dieses selbstgenügsam In-Sich-Ruhen vollkommen zugeschüttet.
Um im Bild der goldenen Kugel zu bleiben: Es wäre so, als würden wir sie peu a peu mit klebrigem, schwarzen Pech einkleistern (so, wie vorne auf dem Cover). Irgendwann wäre sie damit vollständig und dick bedeckt und hätte vorerst keine Chance mehr, die Art unseres Lebendigseins zu bestimmen. Und vieles von dem, was dem Urzustand innewohnte, bliebe dabei vermutlich schnell auf der Strecke.
Wir sollten uns auch darüber klar sein: Dieser künstliche Wertebegriff stellt ein mächtiges Mittel zur Unterdrückung, Diffamierung, Demütigung etc. von bestimmten Menschen und / oder Gruppen von Menschen dar und trägt entschieden dazu bei, dass sich das Individuum im Vergleich mit anderen, die in Bezug auf dies oder jenes „besser“ sind - und die gibt es immer - unterlegen und schlecht fühlen kann und oft auch muss. Und klar ist auch: Indem wir permanent eingebläut bekommen, dass wir nur mit Leistungserfolg etwas taugen, bekommen wir unbewusst parallel dazu auch eingetrichtert, dass wir so, einfach so, eben nichts taugen.
Eine Haltung dem Menschen gegenüber, die sich aus einem Wertebegriff ergibt, ist potenziell respektlos und abwertend. Und da es sich bei diesem Phänomen außerdem um eine von außen gesteuerte Angelegenheit handelt, die willkürlichen Regeln und Normen unterworfen ist, will ich die Sache präziser fassen und wähle dafür den Neologismus FREMD WERTGEFÜHL.
Spätestens hier können wir sagen:
Die dicke, fette LÜGE über den sogenannten Selbstwertbesteht in der Behauptung, der Wert eines Menschen ließe sich durch irgendeine Art und Intensität von Leistung oder Besitz definieren.
Fazit:
DAS KONZEPT„SELBSTWERT“IST UNSINNIG UND GEFÄHRLICH!
Was bedeutet dies nun für unsere Lebensgestaltung?
Wir brauchen natürlich die Qualitäten des Einzelnen, seine Talente und vielfältigen Fähigkeiten zur Entwicklung unserer Kultur, unserer Welt. Und die vielschichtigen Unterschiede zwischen uns Menschen führen dazu, dass die einen schwierige und verantwortungsvolle Aufgaben erledigen können und müssen, die anderen eher leichte. Das ist so und ist auch gut und richtig so. Aber eigentlich überhaupt nicht problematisch, denn die einen sind nicht bessere und schon gar nicht etwa wertvollere Menschen. Sie sind nur anders und evtl. besonders passend geeignet in ihren jeweiligen Funktionen. Es wäre also sehr wichtig, auf beides zu achten: Stabilisierung des Urzustandes durch bedingungslose Liebe auf der einen Seite und Förderung der Leistungsfähigkeit und der intelligenten, kritischen Anpassung an gesellschaftliche Normen und Werte durch Anerkennung und Belohnung auf der anderen. Schließlich - nicht, dass Sie glauben, ich hätte das vergessen und verirre mich im Wolkenkuckucksheim - leben wir mit anderen Menschen zusammen, und jeder muss seine Brötchen letztlich selbst verdienen.
Und um hier noch einmal die 68ger und die Spruchbänder auf ihren Autos zu bemühen: Sie hätten schreiben sollen: „Hast du heute deinem Kind schon deine Liebe gezeigt!?“ (anstatt: gelobt… und auch statt: „Hast du heute schon dein Kind geliebt?“, weil daraufhin ja vermutlich die meisten Eltern sagen würden: „Ja sicher doch!"). Insofern sind die 68ger leider der Fremdwertgesellschaft, die sie ja eigentlich bekämpften, zumindest in diesem Aspekt auf den Leim gegangen.
Dass eine solch differenzierte Entwicklung und Förderung aber möglich ist, hat z.B. Jean Liedloff, eine Journalistin, schon in den Siebzigern in ihrem Buch The Continuum-Concept (dt.: “Die Suche nach dem verlorenen Glück”) über ihre Erfahrungen mit Yequana-Indianern im Dschungel Venezuelas beschrieben. Sie stellte fest, dass die Kinder dieser Stämme von Geburt an bedingungslose Zuwendung erfuhren; u.a. wurden die Kinder von ihren Müttern im Prinzip bis in das 5. Lebensjahr auf dem Rücken oder auf der Hüfte getragen. Kürzlich berichtete auch eine alte Bekannte von mir, dass sie einmal ein halbes Jahr in einem sehr einfachen Indiodorf in Südamerika gelebt habe, wo die „total tollen Kinder“ jederzeit von irgendeinem der älteren Dorfbewohner liebevoll angenommen wurden.
Jean Liedloff prägte den Begriff des Kontinuums der Richtigkeit, womit sie ausdrücken wollte, dass es beim Menschen eine angeborene, kontinuierliche Folge von entwicklungsbedingten Erwartungen gibt, die erfüllt werden müssen, ehe der Organismus sich unbeeinträchtigt auf seine nächste, evolutionär festgelegte Stufe begeben kann. Werden sie nicht erfüllt - und dies beginnt nach unseren heutigen Erkenntnissen nicht erst nach der Geburt sondern schon während der Schwangerschaft -, so entwickelt sich möglicherweise ein Leben in Unsicherheit, Vertrauensmangel, Angst und Liebesunfähigkeit.
Lassen Sie mich dazu bitte schon jetzt erklärend ein wenig ausholen: Wenn ein Kind als Säugling und Kleinkind die Erfahrung macht, dass es nicht





























