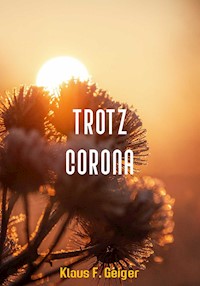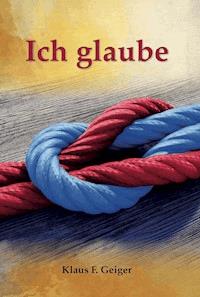
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Romeon-Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist eine Aufforderung an Christen und Nicht-Christen, sich ihrer religiösen Sozialisation und ihres Glaubens zu versichern und mit anderen darüber zu reden. Als Anregung hierzu skizziert der Autor seinen eigenen Werdegang – seine religiöse Erziehung, den Austritt aus der protestantischen Kirche und den Wiedereintritt – und seine Überlegungen zu zentralen Aussagen seiner Kirche. Hintergrund ist die Überzeugung, dass Religiosität und religiöse Gemeinschaften auch und gerade heute eine große Bedeutung haben – im Widerstand gegen eine Ökonomisierung aller Lebensverhältnisse und im Kampf für eine friedliche und gerechte Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 68
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich glaube
1. Auflage, erschienen 6-2018
Umschlaggestaltung: Romeon Verlag
Text: Klaus F. Geiger
Layout: Romeon Verlag
ISBN: 978-3-96229-949-1
www.romeon-verlag.de
Copyright © Romeon Verlag, Kaarst
Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung und Vervielfältigung des Werkes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks und der Übersetzung, sind vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verlages darf das Werk, auch nicht Teile daraus, weder reproduziert, übertragen noch kopiert werden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.
Alle im Buch enthaltenen Angaben, Ergebnisse usw. wurden vom Autor nach bestem Gewissen erstellt. Sie erfolgen ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Verlages. Er übernimmt deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für etwa vorhandene Unrichtigkeiten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Ich glaube
Klaus F. Geiger
Haltet euch nicht selbst für weise
(Römer 12,16 in der Einheitsübersetzung)
Inhalt
Vorwort
An der Kreuzung
Heiligabend
Evangelisch oder katholisch?
Ein feste Burg
Mein erstes Abendmahl
Konfirmation
Ein Referat
Keine kirchliche Trauung
”Die Kinder sollen später selbst entscheiden“
Zögern
Austritt aus der Kirche
Mein Weg zurück
Glaube und politisches Engagement
Gottes Wort
Gottes-Bilder
Wie ich es meinen Freunden erkläre
Eine bessere Welt als das Hier und Heute
Gottes Sohn
Sein Leben geben
Zweifel
Alles wörtlich nehmen?
Strenge Gebote
Widersprüche, unaufgeklärt
Der Glaube, Dienerin der Moral?
Schwanken
Woran ich nicht glauben kann
Das Ärgernis Glaube
Gottesliebe, Menschenliebe
Vorwort
Ich erinnere mich, ein Buch gelesen zu haben, dessen Einleitung mit dem Satz begann: Dieses Buch ist nicht… Das hat mir nicht gefallen. Gleichwohl zwingt mich das Thema dieses Bändchens, genau dasselbe zu tun. Zu sehr fürchte ich, Erwartungen zu wecken, die ich weder erfüllen möchte noch kann. Also: Dies ist nicht ein theologisches Buch, es ist auch nicht das Buch eines Theologen. Es ist eine Sammlung privater Erfahrungen eines Menschen, der im Zweiten Weltkrieg geboren ist und heute die siebzig überschritten hat. Es sind Erfahrungen mit der christlichen Religion protestantischer Prägung, die er an bestimmten Stationen seines Lebens gemacht hat, und es sind Gedanken über Gott und die Bedeutung der Religion für ihn selbst und für die heutige Gesellschaft. Der Autor veröffentlicht diese Erfahrungen, weil er zu einem Gespräch anregen will über diese Themen.
Ich stelle mir vor: Wir sitzen an einem lauen Herbstabend zusammen auf einer Terrasse. Wir sind ins Erzählen gekommen. Da wir uns sympathisch finden, kommen wir auch auf ganz private Erfahrungen. Aus einem Grund, den wir später nicht mehr erinnern, stellt mein Gesprächspartner (meine Gesprächspartnerin?) die sogenannte Gretchenfrage: Wie hältst Du es mit der Religion, glaubst Du an Gott? Das Thema beschäftigt uns Stunden.
Dieses Buch nun enthält meinen persönlichen Anteil an dem Gespräch. Wie oft beim Reden (und Schreiben), wird mir deutlich, dass ich nicht klar umrissene Ansichten abrufe, sondern ich mir im Versuch, meine Gedanken anderen mitzuteilen, dieser selbst erst klar werde, oder sagen wir ehrlicher: etwas klarer werde. Indem ich meine Versuche einer Selbstklärung veröffentliche, hoffe ich, dass ein Leser oder eine Leserin dadurch angeregt wird, sich über eigene Anschauungen und Erfahrungen Gedanken zu machen und diese anderen Menschen mitzuteilen.
In dem vorgestellten Gespräch – so sagte ich - reden wir über Gott und die Welt. Über Gott und die Welt? Unsere Sprache transportiert oft Zustände und Tatsachen, die einer vergangenen Zeit angehören. Wenn wir heute die Redensart – „über Gott und die Welt reden“ – verwenden, kann sie offensichtlich nicht unsere alltägliche Wirklichkeit widerspiegeln. Wir reden über alles Mögliche? Auch über „die“ Welt, ja. Aber über Gott? Sehr selten, und nur die wenigsten, mich inbegriffen.
So mag den Jüngeren unter den Lesern vieles fremd vorkommen, wenn ich über die Selbstverständlichkeit von Gottesglaube und Religiosität in meiner Jugendzeit rede. Die Älteren werden meine wenigen Farbtupfer im ersten Teil des Buches mit ihren eigenen Erinnerungen zu einem Gesamtbild ergänzen können.
Noch eine Anmerkung zum Motto, das ich diesem Buch vorangestellt habe: Zum religiösen Glauben gehört das Eingeständnis, dass wir Menschen die Antworten auf grundlegende existentielle Fragen nicht wissen, nie wissen werden und nie wissen können. Selbstverständlich gilt das auch und besonders für religiöse Fragen. Versuchen wir da doch über Dinge zu reden, die unseren Verstand übersteigen.
An der Kreuzung
Es gibt Wörter, bei denen erinnere ich mich genau an die Zeit und den Ort, wo ich sie zum ersten Mal gehört habe. Das Gleiche gilt für Gedanken, die danach für lange Zeit oder für immer meine Überzeugungen bestimmten.
So trage ich in mir ein Bild von dem Augenblick, als ich gewahr wurde, dass ich meinen Kinderglauben an Gott verloren hatte. Ich war damals achtzehneinhalb Jahre alt; noch ein Jahr würde ich aufs Gymnasium gehen. An dem erinnerten Moment war ich mit dem Fahrrad auf dem Weg vom Zentrum des Stadtteils zu der Stadtrandsiedlung, wo ich zusammen mit meiner Familie wohnte. Ich kam an eine Kreuzung, dort wollte ich auf die Hauptstraße abbiegen. Ich hielt an, setzte meinen rechten Fuß auf die Fahrbahn, um den Verkehr auf der Hauptstraße vorbeizulassen. Bis dahin hatte ich an alles Mögliche gedacht. Als aber mein Fuß den Asphalt berührte, genau in diesem Moment, schoss mir der Gedanke durch den Kopf: “Ich glaube nicht mehr an Gott.”
Es gibt unbewusstes Denken. Demnach muss ich damals, vielleicht Tage, vielleicht Wochen lang – ohne mir dessen bewusst zu sein – innerlich mit einem Widerspruch beschäftigt gewesen sein, der mein Denken und Verhalten bestimmte. Zu der Zeit war ich Teil einer Gruppe von drei Schülern, die sich für die aktuelle existenzialistische Literatur interessierten. Unsere Bitte, in der Schule eine Philosophie-AG einzurichten, war von der Direktion abgelehnt worden. Also trafen wir uns ein oder zwei Mal in der Woche privat in der Wohnung von einem von uns, redeten uns die Köpfe heiß und tranken Rotwein. In der Schule probten wir den Aufstand gegen alle Regeln, die unserer Meinung nach unsere freie Entfaltung einengten. Gleichzeitig aber war ich Leiter einer evangelischen Jugendgruppe, führte sogenannte Bibelstunden durch, ging mehr oder weniger regelmäßig zum Sonntagsgottesdienst. Das Eine, die Philosophie-Lektüre und –Debatten tat ich mit Begeisterung, das Andere, den Kirchenbesuch und die Bibelstunden, aus einem Gefühl der Verpflichtung heraus. Bis zu dem beschriebenen Augenblick.
Die Einsicht, tatsächlich nicht mehr an Gott zu glauben, löste ein Gefühl der Befreiung aus: Der vorher nicht bewusste, aber sehr wohl gefühlte Widerspruch war gelöst. Gleichzeitig empfand ich ein Unwohlsein: Wenn ich aufrichtig leben wollte, musste ich einiges ändern, z. B. die Leitung der Jugendgruppe aufgeben, die Gottesdienstbesuche einstellen. Ich wollte das allerdings so tun, dass es nicht zu einem Streit mit meiner Familie führen würde - mit meiner Mutter, die wegen meines Atheismus traurig sein, und mit meinem Großvater, der darüber zornig werden würde. Innerhalb der Familie würde ich daher meinen Abfall vom Glauben verschweigen.
Wie hatte mein Kinderglaube ausgesehen, von dem ich im Alter von 18 Jahren Abschied nahm? Mir fallen als Antwort auf diese Frage drei Schlagworte ein: Selbstverständlichkeit, Friedfertigkeit, Moral.
Selbstverständlichkeit: Meine Mutter hatte immer mit uns Kindern ein Abendgebet gesprochen; am Tisch meines Großvaters sprach ich vor dem Essen das Tischgebet; seit ich fünf Jahre alt war, besuchte ich die Sonntagsschule, wie man damals den Kindergottesdienst nannte, war dort (wie in der „richtigen“ Schule) aufmerksam und wissbegierig. Ich war Teil einer Welt, in der die Zugehörigkeit zur christlichen Kirche und in weitem Umfang auch der Gottesdienstbesuch den nicht hinterfragten Normalzustand darstellte. Was mich von manchem Gleichaltrigen sicher unterschied: die Ernsthaftigkeit, mit der ich Wort für Wort dem verkündeten Glauben anhing.
Friedfertigkeit: Mein Vater war im Krieg gefallen, eine Tatsache, unter der ich viele Jahre litt und die mir jede Form kriegerischen Handelns verhasst machte. Nicht aggressiv zu handeln war auch, was uns unsere Mutter lehrte – und es war etwas, was mir als ängstlichem Kind nahe lag. Friedfertigkeit stellte für mich als Kind (und stellt für mich heute) den Kern der christlichen Botschaft dar.
Moral: