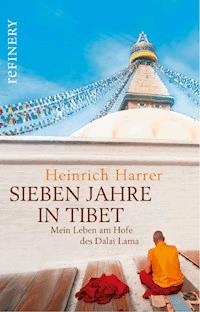7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Heinrich Harrers Expedition zu den eisbedeckten Gipfeln der Tropeninsel Neuguinea wurde zu seinem gefährlichsten und strapaziösesten Abenteuer. Es gelang ihm jedoch als erstem, die Nordwand der berühmten Carstensz-Pyramide, des höchsten Fünftausenders der pazifischen Inselwelt, zu bezwingen. Aber sein Weg führte ihn auch über zahlreiche Gebirgsketten hinweg, durch unwegsame Täler und reißende Urwaldströme in die geheimnisumwitterten Dschungelgebiete zu den Siedlungen der Kopfjäger, die gerade erst aus der Steinzeit erwacht zu sein schienen: den Papuas. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Ähnliche
Heinrich Harrer
Ich komme aus der Steinzeit
Ewiges Eis im Dschungel der Südsee
FISCHER Digital
Inhalt
Alle Aufnahmen stammen vom Verfasser
Vorwort
Der Kreis ist vollendet: Ich hatte die Zivilisation verlassen; war aus dem Jahr eintausendneunhundertzweiundsechzig nach Christi Geburt zurückgewandert in eine Zeit, die etwa 30000 bis 50000 Jahre vor Christi Geburt zu suchen ist, und nun bin ich zurückgekehrt.
Mein Weg in die Steinzeit begann in München, wo die Lufthansa vor meinem Abflug eine erste Pressekonferenz veranstaltete. Der Plan, den ich den Journalisten entwickelte, schien sie zu interessieren. Ich hatte mein festes Haus in meiner Heimat verlassen, ein Haus, in dem es elektrisches Licht gibt, fließendes Wasser, verglaste Fenster und die Geborgenheit hinter gut schließenden Türen. Mein ersehntes Ziel aber war der unerforschte Teil einer Insel auf der rund zweihunderttausend Menschen leben, die schlafen gehen, wenn die Nacht kommt, die Flußwasser aus der hohlen Hand trinken, die noch nie durch eine Glasscheibe gesehen haben, die nicht wissen, was ein Rad ist, und die ein Messer aus Bambus und eine Axt aus Stein bis auf den heutigen Tag für das Optimum technischer Ausrüstung halten. Sie kennen keinen Topf zum Kochen, kein Metall zum Schmieden, kein Tuch zum Schneidern eines Gewandes, keine Schrift zum Aufzeichnen ihres spärlichen Wortschatzes. Sie sind gutmütig und verspielt wie Kinder, hilfsbereit wie Samariter, unberechenbar wie junge Hunde, und ihrer Grausamkeit stehen wir verständnislos gegenüber. Ich meine die Danis, die Bergeinwohner von West-Neuguinea (heute Irian Jaja, Indonesien).
Meine Expedition zu ihnen hat mich durch ihren bestürzenden Reichtum an Erlebnissen glücklich gemacht, obgleich sie die härteste und entbehrungsreichste meines Lebens war, obgleich ich dem Tod mehrmals entkommen bin und obgleich ich die Insel mit zerschundenem Körper und zerschlagenen Knochen verlassen habe.
Die erste Etappe meines Weges in die Steinzeit war die Steinwüste von New York, das zivilisatorische Extrem zum Ziel meiner Reise: Hier war der Stein gequadert und genormt, in Stahl gefaßt, chrom-, nickel- und bronzebeschlagen, von riesigen Glasflächen durchbrochen – hier hatte die Zukunft schon begonnen. In Zentral-Neuguinea aber hat die Vergangenheit noch nicht aufgehört. Hier sieht der Stein noch aus, wie er gewachsen ist, und wo die Danis ihn gespalten haben, hat blinder Zufall mehr zu seiner neuen Form getan als sehender Geist. Der Gegensatz zwischen den hängenden Gärten der Semiramis und den eisfunkelnden Gipfeln des Himalaja kann nicht krasser sein als der zwischen New York und Neuguinea.
Ich bin oft gefragt worden, warum ich mir für meine Unternehmungen Ziele gesucht habe wie die Eiger-Nordwand, den Himalaja, Tibet oder die Steinzeitinsel Neuguinea. Und ich konnte nur antworten, daß mich in meinem Leben immer wieder der Kontrast und Wechsel faszinierten, welcher zwischen unserer zivilisierten Welt und der Begegnung mit fremden, außergewöhnlichen Menschen und Umständen besteht, der neue Maßstäbe vermittelt für die Beurteilung des Lebens. Am Eiger versuchte ich mich zu bewähren, im Himalaja lernte ich die Einsamkeit kennen, in Tibet die außergewöhnlichen Menschen. Im Innern der Insel Neuguinea fand ich alles zusammen: lebensgefährlich reißende Bäche, Flüsse und Ströme, die unbestiegene Nordwand eines über 5000 Meter hohen, wunderbarerweise von Gletschern und ewigen Schnee bedeckten Tropenberges, die Einsamkeit des unberührten Gipfels, die Nächte des Alleinseins im Zelt, auf das der Regen trommelt, und schließlich die Danis, diese für uns nahezu unbegreiflichen Menschen, deren Leben noch heute verläuft wie das unserer Vorfahren in grauer Urzeit.
Eine Ahnung von dem, was mich erwartete, vermeinte ich also zu haben, und ich glaubte mich gut vorbereitet. Aber was wußte ich wirklich?
Im Sommer 1937 – ich bereitete mich gerade für die Besteigung der Eiger-Nordwand vor – hörte ich zum erstenmal etwas von einer holländischen Expedition, die gerade ins Innere Neuguineas vorgedrungen war und dort ein »Eisgebirge« gefunden hatte. Man gab dem Gebirge und seinem höchsten Berg, der 5030 Meter hohen Carstensz-Spitze, den Namen des Mannes, der vor mehr als 300 Jahren als erster Europäer den Schnee über dem Dschungel Neuguineas gesehen hatte: Jan Carstensz, Seefahrer im Dienst der holländischen Krone.
Mir war bekannt, daß es in Südamerika und in Afrika auch in Äquatornähe schnee- und gletscherbedeckte Berge gibt, den rund 6300 Meter hohen Chimborasso etwa in den ekuadorianischen Anden oder den 5200 Meter hohen Ruwenzori im zentralen Afrika. Aber auch auf einer Insel im Pazifik, über Palmen, Orchideen und feuchtwarmen Dschungeln? Ich konnte es kaum glauben.
Die Portugiesen hatten Neuguinea 1526 entdeckt. Aber sie waren an der Nordküste der Insel entlanggesegelt, und vorgelagerte Höhenzüge hatten ihnen die Sicht zu dem Schneewunder versperrt. Fast hundert Jahre später, 1623, segelte ein anderer Europäer, eben Jan Carstensz, mit den beiden Schiffen »Pera« und »Arnheim« an der Südküste Neuguineas entlang. Hier gibt es keine vorgelagerten Höhenzüge, und hier muß zufällig an dem Tag, an dem Carstensz vor der Küste kreuzte, einer jener glasklaren Schönwettertage über Land und Meer heraufgezogen sein, die wohl kaum irgendwo seltener sind als gerade in Neuguinea. Und Jan Carstensz sah als erster Mensch aus unserer Welt – er mag wohl zunächst an eine weiße Wolke gedacht haben – einen schneebedeckten Gipfel über dem Horizont schimmern. Carstensz segelte zurück nach Europa, er erzählte, was er gesehen hatte, und er erntete Gelächter und Unglauben. Aber sein Bericht wurde nicht vergessen, und fast 300 Jahre später brach eine englische Expedition ins Innere der Insel auf. Sie bestätigte, was Jan Carstensz behauptet hatte und was inzwischen bekannt geworden war. Über den Urwäldern Neuguineas thront ein Berg von unvorstellbarer Schönheit und von krassester Gegensätzlichkeit zu seiner tropisch-feuchten Umgebung.
Dorthin war ich nun unterwegs. Doch bevor ich das letzte Stück meiner Anreise in die Steinzeit antrat, leistete ich mir einen Luxus, den nur unsere hochzivilisierte Jetztzeit zu bieten hat: Ich setzte mich in New York in ein Flugzeug, flog nach den Hawaii-Inseln und erfüllte mir als passioniertem Skiläufer einen langgehegten Wunsch, einmal auf dem Ozean Wellen zu reiten.
Das Vergnügen währte nicht lange. Unaufhaltsam schritt das Jahr fort, und spätestens in der ersten Januarhälfte 1962 wollte ich in Neuguinea sein. Andererseits hatte ich mir vorgenommen, soviel wie möglich vom pazifischen Raum kennenzulernen. Die Zeit wurde also knapp. Ich mußte das hawaiische Paradies verlassen, zunächst freilich, um noch ein anderes kennenzulernen: Tahiti.
In Tahiti begann ich meine unmittelbaren Vorbereitungen für die Expedition ins Innere Neuguineas. Ich sammelte Kaurischnecken. Auch das macht deutlich, in welch andersartige Welt ich vordringen wollte. Denn normalerweise geht man, bevor man ein fremdes Land besucht, zu einer Bank, um Geld umzutauschen. Aber die Währung der Danis auf Neuguinea wird an keiner Bank der Erde notiert – man muß sie sammeln: Kaurischnecken. Und als ich Tahiti in Richtung Japan verließ, war ich für Dani-Verhältnisse ein wohlhabender Mann. Ich hatte fleißig gesammelt.
Die nächste Station, Japan, begann mit einer Enttäuschung: Ich wollte den heiligen Berg Fudschijama sehen. Leider war er in dichte Wolken gehüllt. Später indes, nach dem Start zum Flug von Tokio nach Hongkong – ich hatte mich bereits damit abgefunden, den Fudschijama nicht mehr zu sehen –, wurde ich für die erste Enttäuschung reichlich entschädigt. Wir überflogen den heiligen Berg, und sein Gipfel ragte rein und strahlend aus dem Wolkenmeer hervor.
Meinen Aufenthalt in Hongkong habe ich dazu benutzt, nach Kunstwerken und Kultgegenständen aus Tibet zu suchen. Das klingt zunächst absurd, denn Lhasa, die Hauptstadt Tibets, ist immerhin weit mehr als 2000 Kilometer entfernt. Aber es ging lange Zeit das Gerücht, die Rotchinesen hätten nach der restlosen Besetzung Tibets dort nahezu alle Kult- und Kunstgegenstände geraubt und mangels eines eigenen Marktes in Hongkong verkauft. Ich weiß nicht, wie dieses Gerücht zustande kam. Sicher ist, daß ich in Hongkong so gut wie nichts gefunden habe, was es bestätigen könnte.
Von Hongkong ging die Reise weiter nach Bangkog, wo ich mich noch über Möglichkeiten einer späteren Expedition nach dem Norden Thailands informierte, und dann flog ich nach Australien. Dort hielt ich Vorträge bei den Bushwalkers, einer pfadfinderähnlichen Organisation, und dabei lernte ich den Medizinstudenten Russel Kippax kennen. Er ist ein prächtiger Bursche. Und als er hörte, was ich vorhatte, war er Feuer und Flamme – ich hatte meinen Expeditionsarzt gefunden.
Die nächste und letzte Etappe vor Neuguinea war Neuseeland. Hier sprach ich vor dem Alpenklub von Christchurch über Bergsteigen in den Alpen und im Himalaja, und als ich meinem Plan erwähnte, die Carstensz-Spitze in Zentral-Neuguinea zu versuchen, schloß sich der junge Phil Temple an, der ein Jahr zuvor an einer Expedition ins Innere der Insel teilgenommen hatte. Der dritte Mann war da. Im Januar wollte er mir nach Neuguinea nachkommen.
Ich flog zurück nach Sydney und von dort nach Lae im australischen Teil Neuguineas. Anfang Januar traf Kippax dort ein, wenig später auch Temple. Unsere Expedition in die Steinzeit konnte beginnen, der Anmarsch auf die Carstensz-Pyramide stand unmittelbar bevor, genau 339 Jahre nach ihrer Entdeckung durch Jan Carstensz. Wir brachen auf ins Innere der zweitgrößten Insel der Erde, wo die Menschen primitiver, die Dschungel dichter und die Flüsse gefährlicher sind als irgendwo sonst in der Welt. Wir durchschritten das Tor zum größten naturhistorischen Museum, das es gibt. Wir betraten eine Arena, wo jeder falsche Schritt, jede unbedachte Reaktion den Tod bedeuten konnte.
Zusammengekauert im Zelt, auf einem Felsblock hockend oder gegen einen mächtigen Urwaldbaum gelehnt, ausgeruht und müde, hungrig und übersättigt, gesund und mit zersplitterter Kniescheibe, bei Tag und bei Nacht habe ich die Situation meiner abenteuerlichsten Expedition an Ort und Stelle aufgeschrieben. So entstand dieses »Tagebuch aus der Steinzeit«.
In der Zwischenzeit wurde West-Neuguinea (Irian Jaja) Indonesien einverleibt. Die Hauptstadt Hollandia heißt heute Jajapura. Der Ostteil Neuguineas erhielt mit 16. September 1975 die vollkommene Unabhängigkeit und nennt sich Papua Niugini – Papua Neuguinea.
1 Zum Eis am Äquator
Asti, asti bandar ko bakaro!
Langsam, langsam fang den Affen!
(Indisches Sprichwort)
Letzte Vorbereitungen in Lae
Vor uns schimmert der Huon-Golf im letzten Licht des Tages, hinter uns glimmen in Lae die ersten Lichter der Nacht auf. Und noch etwas weiter zurück, unmittelbar hinter der Stadt, beginnt bereits der Dschungel der Huon-Halbinsel. Dunkel und drohend liegt er jetzt da.
Russel Kippax ist angekommen. Der dreißigjährige australische Mediziner gehört zu den drei weißen Männern, die mich zum Carstensz-Gebirge begleiten werden. Jetzt ist unser letzter Abend in Lae angebrochen. Wir sitzen auf der erhöhten Terrasse eines der hier üblichen Pfahlbauhäuser und lauschen den altvertrauten Dschungellauten. Ich muß mich an sie erst wieder gewöhnen, an diese schöne und heimelige Musik aus Tierstimmen, knackenden Ästen und stürzendem Wasser.
Morgen werden wir den australisch verwalteten Teil der Insel Neuguinea mit dem Flugzeug verlassen und in den niederländischen Teil fliegen, nach Hollandia, um dort die letzten Vorbereitungen für den Vorstoß ins Carstensz-Gebirge abzuschließen. Wie lange das noch dauern wird? Ich weiß es nicht. Auch Russel Kippax hebt nur die Schultern und läßt die Mundwinkel sinken. Wir genießen zwar die großzügige Unterstützung der niederländischen Regierung und ihrer gesamten Administration hier im Land, aber man darf da trotzdem keine europäischen Maßstäbe anlegen. In unmittelbarer Äquatornähe haben die Leute es mit nichts besonders eilig. Geduld also.
An Bord der Kronduif Flug von Lae nach Hollandia
Schweißdurchnäßt sind wir ins Flugzeug geklettert, und dann sind wir gesessen und haben, der Erschöpfung nahe, auf den Abflug der Kronduif gewartet. Jetzt haben wir den Start hinter uns und kühlere Regionen erreicht. Doch auch hier oben stehen unserer Stewardeß, einer molligen blonden Holländerin, die Schweißperlen noch auf dem mit rosa Puder geschminkten Gesicht, während sie uns versorgt. Uns – das sind zehn Passagiere. Russel Kippax und ich gelten an Bord als Verrückte, weil wir nur bis Hollandia wollen und nicht weiterfliegen nach Biak, um dort Anschluß an die großen internationalen Fluglinien zu bekommen.
Ich muß mich auf die riesigen Entfernungen erst wieder einstellen. Wir Europäer kennen ja die Karten des Pazifik fast nur im »Weltatlas«-Format, 1:30 oder 1:50 Millionen, und eine Menge Leute zu Hause halten deshalb Neuguinea für eine kleine Insel. Aber allein die Flugstrecke Lae–Hollandia mißt 900 Kilometer, und in ihrer West-Ost-Ausdehnung ist die Insel mehr als 2000 Kilometer lang. Das ist eine größere Entfernung als von der deutschen Nordgrenze über Österreich hinweg bis zum südlichsten Punkt Italiens. Und die Gesamtfläche Neuguineas beträgt mehr als das Zweieinhalbfache des Königreichs Großbritannien. Wir fliegen über eine geschlossene Dschungeldecke, vielfältig gewundene Flüsse und mittelhohe Bergketten. Später tauchen einzelne Rodungen im Urwald auf, kleine Flecken im scheinbar unendlichen Meer des Dschungels, auf denen die Hütten der Eingeborenen kaum mehr zu erkennen sind. Dann wieder Schluchten mit stürzenden Wassern, deren weißer Gischt sonnendurchtränkt aus dem dunklen Dschungelboden hervorzuwachsen scheint.
Früher Nachmittag: Wir kreisen über Hollandia mit seinen malerischen Inseln und Buchten. In der Humboldt-Bucht entdeckte ich mitten im Wasser Häuser auf soliden Pfählen: die ersten Fischerdörfer. Outrigger, wie die schmalen Boote der Eingeborenen heißen, beleben das sonst ruhige Bild. Dazwischen, Zeugen einer unruhevollen Vergangenheit, liegen einige Wracks japanischer und amerikanischer Schiffe, traurige Hinterlassenschaft des zweiten Weltkriegs.
Die Maschine strebt jetzt landeinwärts. Wir überfliegen den großen Sentanisee, und dann nimmt der Pilot Kurs auf das Landefeld des Flugplatzes Hollandia. Der Bug der Kronduif senkt sich dem Boden entgegen. Dem Boden und der feuchten Hitze.
Hollandia (heute Jajapura)
Am Flughafen holte uns Rafer Den Haan, der Kommissar des Neuguinea-Berglands, ab. Er sieht blendend aus, trägt eine dunkle Brille und einen imponierenden Schnurrbart und spricht fließend fünf Sprachen.
Der Zoll war unter Den Haans Geleit nur eine Formalität, und schon bald nach der Landung saßen wir in seinem schwarzen Fiat. Vor uns lagen Kurven, Kurven und nochmals Kurven, 45 Kilometer. So weit ist der Flugplatz von der Stadt Hollandia entfernt.
Die erste Besprechung hatten wir im Büro des Kommissars. Dort stellte uns Den Haan unseren »Patrol officer« vor, Bert Huizenga, einen blonden Hünen von fünfundzwanzig Jahren. Ihn hatte Den Haan mir vorgeschlagen, als ich ihm sagte, daß es wohl fair und unter Bergsteigern recht und billig sei, wenn an der Erstbesteigung des höchsten Gipfels auf niederländischem Gebiet ein Holländer teilnähme. Darüber hinaus hatte die Regierung bei mir angefragt, ob ich bereit wäre, auch noch einen holländischen Geologen auf die Expedition mitzunehmen, und auf meine Zustimmung hin hatte der Vorstand des Bergbauamtes, Dr. Willem Valk, beschlossen, selber mitzugehen.
Morgen soll unser letzter Partner, Phil Temple, der zweiundzwanzigjährige Neuseeländer, zu uns stoßen. Temple war bereits 1961 Teilnehmer einer Expedition ins Hochland gewesen.
Immer wieder wird mir die Frage gestellt, ob ich keine Bedenken habe, unsere Expedition trotz der Gefahr einer Invasion durch die Indonesier durchzuführen. Meine Antwort bleibt stets die gleiche: Wenn man seine eigenen Pläne von drohenden Krisen und politischen Ereignissen abhängig macht, kommt man nie zu einem aktiven Leben. Natürlich treibe ich deshalb keine Vogel-Strauß-Politik. Ich habe mir längst ausgerechnet, welchen Gefahren unsere Gruppe durch eine größere Landung indonesischer Truppen ausgesetzt sein könnte. Ich habe vorgesorgt: Zu unserem Expeditionsgepäck gehören für den äußersten Fall Segelhandwerk, Nadeln, Garne, Taue, Reepschnüre und, als Segel, zehn Ponchos, ferner Land- und Seekarten von Neuguinea bis nach Australien. Zur Not können wir damit von der Südküste nach Australien-Neuguinea, wenn es sein muß, sogar nach Australien segeln. Ich werde also ruhig schlafen können; alles ist gut vorbereitet.
Phil Temple und Bert Huizenga sind schon nach Bokondini geflogen und von dort weiter nach Ilaga, dem Carstensz-Gebirge entgegen. Vielleicht ist Phil von dort aus schon auf dem Weg zu unserem geplanten Hauptlager. Er soll die ihm von seiner vorjährigen Expedition her bekannte Strecke mit Hütten herrichten.
Dr. Valk, Russel Kippax und ich sind noch hier in Hollandia geblieben. Valk und ich haben die Nahrungsmittel gekauft, dazu hundert Äxte und hundert Buschmesser. Außerdem besitzen wir bereits fünfzig Kilo Kaurimuscheln und etwa achtzig Kilo Schmuck, Uhren und Schleifsteine – Lohn für unsere Träger, die wir in Ilaga anwerben müssen. Wir packen den ganzen Tag. Es ist heiß und feucht, und schon nach den ersten Bewegungen steht mir der Schweiß auf der Stirn. Wenn ich mich bücke, läuft er zu dicken Tropfen zusammen und fällt auf die Pakete und Säcke. Expeditionsarzt Kippax strahlt von morgens bis abends über die große Auswahl an Medikamenten, die ich aus Europa mitgebracht habe. Mit Liebe, Fachkenntnis und Sorgfalt stellt er drei Apothekenausrüstungen zusammen.
Morgen werden auch wir Hollandia verlassen. Um neun Uhr soll unsere Kronduif-Maschine starten. Wir fliegen nach Wamena und von dort, vermutlich übermorgen, nach Ilaga zur Vorhut.
Die Drohung Sukarnos, Neuguinea zu »befreien«, hallt wieder energischer aus Djakarta zu uns. Deshalb sind in den letzten Tagen mehr als sechzig Journalisten in Hollandia angekommen und drängeln sich nun in den beiden kleinen Hotels der Regierung. Man spricht von Krieg. Aber wir lassen uns nicht stören. Um acht Uhr früh werden wir morgen mit dem Verladen unserer zweitausend Kilo Expeditionsgepäck beginnen und eine Stunde später starten.
Wamena
Die Organisation klappt weiterhin vorzüglich. Auch hier war bei unserer Ankunft alles vorbereitet. Johansen, der Pilot der »Cama«, startete bald nach unserer Landung mit dem ersten Schub unseres Gepäcks nach Ilaga. Er wird, schätze ich, drei- oder viermal fliegen müssen, und wir drei werden morgen nachkommen. Heute abend wollen wir einige Holländer besuchen, um uns für die großzügige Unterstützung von seiten der Regierung zu bedanken.
Ilaga
Schon als unsere beiden kleinen Maschinen kurz vor der Landung hier kreisten, sahen wir, daß sich eine große Menschenmenge zu unserem Empfang in Ilaga versammelt hatte. Hunderte von Danis, Eingeborene des Berglands, umringten uns dann auf dem Boden mit ihrem charakteristischen »Wa-wa-wa!«-Geschrei, und Phil und Bert hatten Mühe, zu uns vorzudringen. Die Landung auf bergansteigender Bahn war einfacher gewesen, als ich anfangs befürchtet hatte. Später standen wir erleichtert nebeneinander und beobachteten die beiden Maschinen, wie sie den Hang hinunterrollten, schneller und schneller wurden und sich dann, leicht wie Vögel, durch das tiefe Tal wieder hochschwangen. Minuten später verschwanden sie hinter den dschungelbedeckten Bergen im Osten. Ein schönes Bild.
Unser Zeltlager liegt 100 Höhenmeter tiefer als die Landebahn. Eine Kochhütte ist errichtet und ein Graben um den Platz gezogen. Umgeben ist das Lager von Feldern mit süßen Kartoffeln, der Hauptnahrung der Danis. Wie erwartet, regnet es.
Wir richten uns in unseren Zelten bequem ein und sind trotz des Regens guter Dinge. Meine Gedanken sind vollauf mit der Expeditionsplanung beschäftigt. Wenn alles bereit ist, hoffe ich noch Zeit für einige ethnographische Untersuchungen zu finden.
Wie überall in der Welt ist es auch hier schwierig, Träger zu finden. Bert Huizenga ist den ganzen Tag damit beschäftigt, Leute anzuheuern. Trotzdem haben wir erst hundert zusammen, die Hälfte von dem, was wir benötigen. Und natürlich gab es auch schon einige Zwischenfälle mit den eingeborenen Danis. Sie leben über das ganze Hochland verstreut. Man schätzt ihre Zahl auf etwa zweihunderttausend, von denen rund sechstausend den Kessel bei Ilaga bewohnen. Aufgespalten in Stämme, die sich wiederum in Klans unterteilen, sprechen sie die verschiedensten Dialekte, die ich nun während der einzelnen Abschnitte der Expedition lernen muß. Eine Schrift kennen die Danis nicht, und das muß zwangsläufig zu Mißverständnissen führen. Aber noch sind die Zwischenfälle eher heiterer als ernster Natur.
Die Dani-Männer sind kräftige, Respekt einflößende Burschen, groß, dunkelhäutig und mit stolz erhobenen Häuptern. Trotzdem dauert es einige Zeit, bis man sie betrachten kann, ohne heimlich zu lächeln: Sie beschmieren sich ihre Gesichter mit Schweinefett und Ruß und tragen im übrigen nur ein einziges Kleidungsstück, nähmlich eine ausgehöhlte Frucht, eine Art Kürbis verschiedenster Größen, die sie über den Penis stülpen. Und ob sie nun erschrecken oder sich freuen, sie schreien dann aufgeregt »Wa-wa-wa!« und klopfen dabei mit dem Fingernagel des Daumens gegen die trockene Kürbisschale.
Die Dani-Frauen sind zwar kleiner als die Männer, aber kaum weniger kräftig. Sie tragen nur einen Lendenschurz, den sie aus Baumrindenfasern oder aus gelben Orchideenfasern sehr hübsch und sehr geschickt zu flechten verstehen.
Zurückhaltung, wie wir sie kennen, ist den Danis, Männern wie Frauen, fremd. Ob ich über dem Lagerplatz laufe, ob ich sitze, stehe oder liege, sie stehen scharenweise um mich herum, betasten meinen Hut oder meine Tabakspfeife, lachen, gestikulieren und schreien »Wa-wa-wa!« Es hört sich an wie das unruhige Bellen vieler Hunde.
Gestern entstand eine kleine Aufregung, als zwischen unseren Zelten eine Schlange auftauchte. Schreiend rannten die Danis davon, und erst, als Bert Huigenza mit dem Buschmesser der Schlange den Kopf abgeschlagen hatte, kamen sie langsam und vorsichtig wieder.
Heute vormittag ist Phil Temple mit zehn Trägern losgezogen, um das Hauptlager zu errichten und die Unterstandshütten auf dem Weg dorthin zu vervollständigen. Unser Plan ist, zwischen hier und dem Hauptlager noch ein Kartoffellager zu bauen, und wir hoffen, dadurch die zweite Etappe besser zu bewerkstelligen. Dieser Plan baut sich allerdings darauf auf, daß wir genügend Träger finden. Vorsichtshalber haben wir aber auch die Möglichkeit einkalkuliert, Flugzeuge zum Abwurf von Lebensmitteln einzusetzen. Noch drei Tage. Dann, hoffe ich, werden wir aufbrechen. »Asti, asti bandar, ko bakaro«, sagt der Inder: »Langsam, langsam fang den Affen.« Ich muß jetzt täglich an das Sprichwort denken.
Jeder von uns – Dr. Valk, Phil, Bert, Russel und ich – hat einen »Leibdiener«. Meiner heißt für mich Oskar. Aber die Danis können das »s« nicht gut aussprechen. Deshalb haben wir uns auf »Okar« geeinigt. Über das Radio hören wir, daß heute früh indonesische Truppen versucht haben, in der Etna-Bay zu landen. Sie wurden von den Holländern zurückgeschlagen, aber man erwartet neue Angriffe. Verständlicherweise tauchen deshalb bei meinen Partnern wieder Bedenken auf. Aber ich glaube, es ist mir gelungen, ihnen etwas von meiner Begeisterung für die Expedition zu vermitteln. Vorhin sprach ich mit Temple und Huizenga. Sie wollen alle weiter mitmachen. Was immer auch geschieht, wir gehen zum Carstensz. Dr. Valk allerdings muß uns verlassen. Er hat sich eine Darmerkrankung zugezogen.
Meine Pfeife. Ja, hier ist sie nicht nur Rauchgenuß oder, wie daheim im gemütlichen Sessel, Freund, der in besinnlicher Stimmung meine Gedanken gleichsam auf leichten blauen Wölkchen durchs Zimmer trägt. Hier hat sie auch einen ganz und gar praktischen Zweck. Denn unser allmorgendlicher Wecker, die laut schmatzenden Schweine der Eingeborenen, ziehen einen ganzen Schwarm kleiner, ekelhafter Fliegen hinter sich hier. Sie scheinen nichts zu fürchten auf der Welt außer Tabakqualm. Also brenne ich mir jeden Morgen, wenn ich die Schweine quietschen und schmatzen höre, erst einmal die Pfeife an, qualme das Zelt voll und öffne dann erst den Eingang. So habe ich einigermaßen Ruhe vor dem widerwärtigen Fliegengeschmeiß.
Später kommen die Danis und bauen sich in den Zelteingängen auf. Sie drängen, schieben, schnattern und machen einen unbeschreiblichen Lärm. Bert verlor heute früh die Geduld und schoß mit der Pistole in den Boden. Aber er hatte die Rechnung ohne unsere Dani-Wirte gemacht. Zwar flitzten sie erst einmal schreiend auseinander, als aber dann nichts mehr geschah, lachten sie, kamen wieder und begannen ihren Lärm von neuem. Bert gab es auf und zog sich in sein Zelt zurück.
Auch Frauen sind bei solcher Gelegenheit oft mit von der Partie. Sie tragen fast immer ihre Netze voll süßer Kartoffeln bei sich, setzen sich rund um die Zelte und schauen. Einige knüpfen auf runden Rahmen Netze aus Orchideenfasern. Ich bewundere immer wieder ihr Talent, dabei hübsche bunte Muster einzuarbeiten.
Die Hauptbeschäftigung der Danis aber, auch der Männer, ist und bleibt »Schauen«. Es gibt nichts bei unserer Ausrüstung, was sie nicht eingehend betrachten. Sooft sie etwas Neues entdecken, stoßen sie ihre beifälligen »Wa-wa-wa«-Rufe aus, und die Männer klopfen zum Zeichen ihrer Freude mit dem Daumennagel gegen ihr Penisfutteral.
Überhaupt herrscht in unserem inzwischen stattlichen Lager eine vergnügte Stimmung, von der offenbar auch die kleinen, gelb-weißen Hunde der Danis angesteckt sind: von morgens bis abends beschnuppern sie uns und unsere Sachen schwanzwedelnd. Wahrscheinlich gehören sie, wie die Hunde der Pygmäen in Afrika, zu den Pharaonenhunden, denn wie diese bellen sie nicht und sind daher besonders gut für die Jagd geeignet.
Russel Kippax und ich sind nun allein. Dr. Valk ist zurückgeflogen nach Hollandia, Phil Temple baut das Basislager am Fuß des Gebirges auf, und Bert Huizenga besorgt in Wamena Nahrungsmittel. Wir brauchen für weitere Träger mindestens zusätzliche sechshundert Kilo Reis, die über dem Basislager abgeworfen werden sollen.
Ich mußte also den Aufbruch der Expedition wiederum verschieben. Um die Wartezeit zu nützen, sind Russel und ich heute früh zu einer Dreitagetour aufgebrochen. Wir wollen den unerstiegenen, etwas über 4000 Meter hohen Kelabo versuchen und auf den Weg dorthin zum Vonk Lake gehen, ein See, von dem ich so gut wie keine Vorstellung habe und der mich gerade deshalb reizt.
Und nun habe ich meine erste Begegnung mit den pfadlosen, schlüpfrigen Moos- und Regenwald hinter mir und seine Tücken zum Teil schon am eigenen Leib verspürt. Wir sind zuerst vom 2200 Meter hohen Lager zweihundert Meter tief in den Talboden abgestiegen bis an den reißenden Ilagafluß, der in den Rouffaer-Strom mündet. Als Brücke über den Ilaga fanden wir einen großen Baumstamm vor, der zur Hälfte vom Wasser überspült war. Leichtfüßig und elegant liefen die Träger mit ihren Lasten darüber hinweg. Gewohnt, barfuß zu gehen, war das für sie keine Schwierigkeit. Die Nägel meiner Schuhe dagegen gaben mir auf dem glitschigen Stamm keinen ausreichenden Halt. Vorsichtig balancierte ich Schritt für Schritt, links und rechts von mir tobte der Fluß. Auch rittlings wäre es unmöglich gewesen, die andere Seite zu erreichen: Die Strömung war so stark, daß ihr auch die im Wasser hängenden Füße genügt hätten, um uns mitzureißen. Noch sechs, vielleicht auch nur noch fünf Schritte hatte ich vor mir, zum Greifen nah das rettende Ufer, da rutschte mein linker Schuh etwas seitlich ab, ganz wenig nur, aber genug. Rennen, das war in diesem Augenblick mein einziger Gedanke. Doch der rechte Schuh faßte schon nicht mehr den Stamm, beim nächsten Schritt verlor ich die Balance vollkommen. Eine letzte Kraftanstrengung, ein Sprung, Fels unter meinen Füßen, nasser, abschüssiger Fels, und für den Bruchteil einer Sekunde wußte ich, daß ich mit dem Gesicht daraufschlagen würde. Instinktiv warf ich mich bergseitig, also der Strömung entgegen, ins Wasser, und das Wasser warf mich gegen den Baumstamm. Mit aller Kraft versuchte ich mich daran festzuklammern. Aber mein am Berg geschulter Instinkt hatte mich hier am Wasser falsch beraten. Ich geriet in den Sog des unter dem Baum hindurchfließenden Wassers und wurde augenblicklich in die Tiefe gerissen. Es war eine verzweifelte Situation: Den Weg nach oben versperrte mir der Wasserdruck, den nach hinten die Kraft der Strömung, den nach vorn ein Gewirr von Ästen, durch das nur das Wasser ungehindert hindurchgurgelte. Nur keine Panik, war mein einziger Gedanke. Es blieb auch gar keine Zeit mehr, an etwas anderes zu denken. Ich mußte handeln. Doch auch dazu blieb mir nur der Platz, den ich, vom Wasser gegen die Äste gepreßt, mit den Händen abtasten konnte. Und da, endlich fand ich ein Loch zwischen den Ästen. Ich griff zu, zog meinen Körper nach und zwängte mich, halb von der Strömung getrieben, halb von meinen Armen gezogen, durch das Loch. Plötzlich konnte ich mich frei bewegen, und das Wasser schoß mich mit seiner ganzen Kraft wieder an die Oberfläche. Die Gewalt der Strömung ließ nach, ich konnte ohne Schwierigkeiten ans Ufer schwimmen, und mein »Leibdiener« Okar zog mich grinsend an Land. Als ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte, wurde mir klar, was an meinem Verhalten falsch gewesen war. Ich hätte mich nicht gegen die Strömung, sondern mit ihr ins Wasser werfen müssen. Denn erstens wäre ich ohne das Loch in den Ästen rettungslos verloren gewesen, und zweitens war sogar das Loch eine zusätzliche Gefahr. Hier nämlich, wo sich das Wasser durch eine verhältnismäßig kleine Öffnung hindurchpreßte, rast es noch wesentlich schneller als hinter dem Baum, wo es sich wieder auf breiterem Raum bewegen kann.
Okar betastete mich von allen Seiten, ein paar andere Danis sahen zu, und am Schluß riefen sie alle: »Wa-wa-wa!« Sie hatten also festgestellt, daß ich heil geblieben war. Nur mein alter Hut war auf der Strecke geblieben.
Weiter ging es, eine steile Böschung hinauf, weg vom Fluß. Und das hieß: hinein in den Dschungel. Wurzeln versperrten uns den Weg, querliegende Bäume, oft mehrere übereinander, jetzt in einer anderen Richtung niedergestürzt. Wir turnten wie die Affen darüber hinweg, hantelten uns vorwärts, zogen uns hoch, balancierten, bis wir schließlich einen schmalen Pfad erreichten, eine Rinne im dichten Dschungel, häufig steil aufwärtsführend über lianenbezogene, schlüpfrig gewordene Kalkabbrüche.
Fünf Stunden ging das jetzt so. Bald war Russel Kippax vom Schweiß genauso durchnäßt wie ich vom Wasser, und als wir endlich einen Paß erreichten, hatte keiner von uns auch nur noch einen einzigen trockenen Faden am Leib. Höchste Zeit für eine Rast, unsere Knochen waren schwer geworden.
Ganz anders unsere Danis. Sie turnten auch jetzt noch mit der Geschwindigkeit von Wildkatzen über das Wurzel- und Baumgewirr, sie lachten, bellten und waren kaum zur Ruhe zu bringen.
Russel versuchte ein Feuer anzuzünden. Aber seine Zündhölzer waren so naß wie meine, außerdem hatte wieder leichter Regen eingesetzt, und da hockten wir nun mit unseren Errungenschaften der Zivilisation, mit unseren Zauberhölzern, die aber nur Feuer zaubern, wenn sie trocken sind.
Eine Zeitlang sah Okar uns zu, wie wir uns mit den Zündhölzern abmühten. Dann nahm er wortlos einen Ast, spaltete ihn in der Mitte auf und steckte Zunder, wozu ihm das Mark einer Pflanze diente, in den Riß. Danach legte er ein paar dünne Zweige und Laub zu einem kleinen Haufen zusammen und darüber den Ast mit Riß und Zunder. Nun nahm er eine Rotangrolle, die er immer bei sich trug, vom Oberarm, schob den Streifen unter dem Ast durch und begann ihn auf und ab zu ziehen, wobei er links und rechts mit den Füßen auf dem Ast stand. Dadurch war es ihm möglich, den Rotang straff anzuziehen. Immer schneller wurden seine Bewegungen, in immer kürzeren Abständen fegte die Schnur über Holz und Zunder, bis sie plötzlich riß: Sie war durch die Reibungshitze durchgebrannt. Aber auch der Zunder war davon in Brand geraten. Wir hatten die uralte »Feuersäge«.
Russ und ich bereiteten uns Ovomaltine, unsere Danis warfen Steine ins Feuer und brieten dann auf ihnen süße Kartoffeln. Und nach weniger als einer Stunde konnten wir weiterziehen. Unser Rastplatz war 3500 Meter hoch gelegen. Nun ging es wieder abwärts.
Nach einem Abstieg von etwa 200 Höhenmetern standen wir wieder vor einem Fluß, etwa zehn Meter breit, ziemlich ruhig und sicher nicht zu queren. Dafür war er schmutzig. Alles hier war braun und schmutzig, der Boden, das Wasser, die Danis, und als wir den Fluß durchwatet hatten, auch Russel und ich.
Aber nun hatten wir es geschafft. Nach dem Fluß durchquerten wir noch ein paar Lichtungen, es gab, nach der Symphonie in Braun, endlich wieder weißen Kalk und roten Rhododendron, und dann fanden wir, gerade als der Regen wieder anfing, die verlassene Hütte. Wo immer sich Danis niederlassen, und sei es auch nur für eine längere Rast, bauen sie solche Hütten aus Ästen, Bambus, Blättern und Farnkräutern, um sich gegen den Regen zu schützen. Und wenn sie weiterziehen, lassen sie die Hütte stehen oder verbrennen sie unter Gejohle. Am nächsten Rastplatz bauen sie dann wieder eine. Material gibt es in Hülle und Fülle, und gebaut ist eine solche Hütte sehr schnell.
Für Russ und mich war dieser erste Tag mit dem langen Anstieg und den großen Höhenunterschieden etwas zu anstrengend. Wir sind todmüde, beide an den Beinen zerschunden, und ich merke jetzt, daß ich mir bei dem Sturz in den Fluß doch eine heftigere Prellung am Oberschenkel geholt habe, als ich zuerst dachte. Aber in der flachen Hütte ist es gemütlich. Die Träger haben noch mehr Farn aufs Dach gepackt, so daß der Regen jetzt nur mehr als leises Rauschen zu hören ist. Ein Feuer brennt, diesmal mit Zündhölzern gemacht, zwischen heißen Steinen schmoren süße Kartoffeln, Frösche und etwas Gemüse. Wir warten auf ein Steinzeitessen.
Zehn Träger sind bei uns. Eigentlich wollten wir mit der Hälfte auskommen. Aber man braucht eigene Träger, dazu Träger für die Träger, für deren Kartoffeln, und so sind’s am Schluß immer mehr, als man am Anfang gedacht hat.
In 3200 Meter Höhe haben wir übernachtet. Heute früh sind wir zuerst ein Stück abgestiegen und wieder zu einem reißenden Fluß gekommen. Russ klopfte mir auf die Schulter und zeigte auf die einzige »Brücke«: wie gestern – ein Baumstamm. Doch das Wasser schäumte und tobte noch heftiger, ein Sturz würde hier den sicheren Tod bedeuten. Die Danis überwanden den Stamm auf nackten Füßen wieder ohne Schwierigkeiten. Ich ging, durch Schaden gewarnt, nur den ersten Teil aufrecht. Da, wo die Rinde aufhörte und das Holz glatt wurde, rutschte ich im Reitersitz weiter. Russ machte es genauso. Aber hin und wieder schlug das Wasser mit solcher Wucht gegen unsere Füße und Beine, daß wir auch jetzt alle Mühe hatten, heil ans Ufer zu kommen.
Der anschließende Weg durch den Dschungel läßt sich in einem Satz zusammenfassen: Entweder mußten wir durch unvorstellbaren Morast waten, oder wir balancierten auf kreuz und quer niedergebrochenen Baumstämmen über schwarze, von undurchsichtigem Ast- und Pflanzengewirr angefüllte Abgründe. Und so waren wir ständig im Zweifel, welchen Weg wir bevorzugen sollten – den durch den abstoßenden, aber ungefährlichen Schlamm und Schmutz oder den über die sauberen, aber tückischen Baumstämme. Neben uns ständig der tobende Fluß, den ich, da er wohl aus dem Vonk-See kommt, Vonk-Fluß nennen möchte. Und immer wieder mußten wir neue Bäche queren, die ihm aus dem Dschungel zuströmen.
Die Landschaft, durch die wir uns mühsam vorwärts kämpften, ist von märchenhafter Schönheit. Überall wachsen prachtvolle Orchideen, rote und weiße Begonien und andere tropische Blumen; die bemoosten Baumstämme mit ihren Verdickungen erinnern an das Bühnenbild eines Hexenwaldes, durch den Fabelwesen geistern; das vom üppigen Laub gefilterte Licht leuchtet unwirklich.
Über fünf Stunden haben wir gebraucht, um unser jetziges Lager zu erreichen. Eigentlich wollten wir hier in 3800 Meter Höhe nur rasten. Aber Russ und ich merkten sehr bald, daß wir uns für diese ersten Tage etwas zuviel zugemutet haben. Deshalb werden wir hier übernachten. Russ schläft bereits. Er hat, als wir die Zelte aufgeschlagen haben, gesagt, er fühle sich so, als habe er gerade den Gipfel des Mount Everest erstiegen.
Unsere Danis spüren offenbar nichts von der körperlichen Anstrengung, obwohl doch jeder von ihnen fünfzehn Kilo Last getragen hat. Aber sie sind einfach nicht zur Ruhe zu bringen. Überall im Wald höre ich sie bellen und jaulen, manchmal ist kein einziger mehr im Lager. Dann erscheinen sie wieder und drängen sich neugierig in unser Zelt. Das ist typisch für sie; sie fühlen sich in keiner Weise anders als wir, sie verwenden, auch wenn wir gerade selber beim Essen sind, unsere Becher und Löffel, und sie können einfach nicht begreifen, daß Russ oder ich sie manchmal aus dem Zelt hinausdrängen. Vorhin hat Okar entdeckt, daß ich Gold an den Zähnen habe. Jetzt rennt er immer noch draußen herum, klopft aufgeregt mit dem Daumennagel auf seine Penishülle und erzählt den anderen, was mit meinen Zähnen los ist.
Von ihren Streifzügen durch den Wald bringen sie allerlei Eßbares mit, Früchte, ein Fröschlein, manchmal sogar Mäuse und Ratten. Das werfen sie dann einfach ins Feuer, bis die Haare weggebrannt sind, schlitzen es auf, entfernen einen Teil des Gedärms, und den Rest verschlingen sie.
Nun müssen wir doch darauf verzichten, bis zum Vonk-See vorzudringen und den Kelabo zu besteigen. Da wir auf jeden Fall schon morgen wieder in Ilaga sein wollen, sind wir heute früh umgekehrt und haben den Fluß bereits erreicht. Das Carstensz-Gebirge lockt.
Der Rückweg durch den Regenwald war im Vergleich zum Aufstieg ein Vergnügen. Nun machen wir kurze Rast im gestrigen Biwak. Die Träger sengen gerade einem Opossum die Haare weg. Vorhin habe ich es in meiner Leica-Tasche gefunden. Sie hatten es darin aufbewahrt. Man kann nur immer wieder lachen und gute Miene zu ihrem unschuldigen Spiel machen – sie sehen eben alles als ihren Besitz an. Dennoch haben sie für bestimmte Dinge einen ausgeprägten Eigentumsbegriff. Mehrmals schon fanden wir unterwegs Gemüsegärten, bei denen keine Hütten standen, aber es wäre nie einem Dani eingefallen, etwas davon zu nehmen. Das Feld gehörte einem anderen.
Inzwischen sind wir weitergezogen und haben nun unser letztes Nachtlager erreicht. Unser Weg führte über den Gebirgsrücken zwischen Ila- und Kelabofluß. Die letzten 150 Meter Abstieg haben wir uns einen Pfad mit dem Buschmesser geschlagen, bis wir an die riesige Rodung gekommen sind. Mittendrin liegt ein großer Gemüsegarten, umgeben von einem Lattenzaun, der mich an ähnliche Zäune zu Hause in den Alpen erinnert. In dem Garten wachsen Bataten, Mais, Bohnen, Erbsen, Kürbisse und Gurken. Gegen ein paar Kaurischnecken erstehen wir von den Eingeborenen »Spinat« – das Kraut der »Bataten«, der süßen Kartoffel –, für jeden zwei Gurken, Mais und Bohnen, und nun steht uns ein Dani-Schlemmeressen bevor.
Langsam komme ich dahinter, warum die Eingeborenen fast nie Wasser trinken: ihre Nahrung ist so flüssigkeitshaltig, daß ein richtiges Durstgefühl fast überhaupt nicht aufkommt. Da sie nicht einmal das primitivste irdene Gefäß kennen, werden Pflanzen als auch Fleisch zwischen heißen Steinen geschmort und gedämpft. Die Steinzeit kennt nicht unseren Luxus – es wird nur hergestellt, was unbedingt zur Existenz notwendig ist. Und das ist nicht viel. Selbst der Genuß des Badens, den wir uns zur Krönung des Mahls an diesem Abend gönnen, ist – im wahrsten Sinne des Wortes – getrübt. Wir tauchen in die sumpfbraunen Fluten des Ilaflusses.
Ilaga
Sonntag. Fünf Stunden Marsch liegen hinter uns, und wir sind, von Kinderscharen umgeben, wieder ins Hauptlager eingezogen. Obwohl wir weder den Kelabo bestiegen noch den Vonk-See erreicht haben, war es ein schöner und – vor allem nützlicher Ausflug. Wir besitzen jetzt ziemlich genaue kartographische Aufzeichnungen vom Kelabotal, wir kennen die Marschgeschwindigkeiten, die im hiesigen Dschungel möglich sind, und wir konnten unsere Träger »ausprobieren«. Sie sind nicht schlechter als jene, die ich mir in anderen Kontinenten angeworben hatte, hilfsbereit, gutwillig, lustig, stark und ausdauernd, aber auch nicht besser in ihrem Mangel an Verantwortungsgefühl und ihrem Hang zur Faulheit. Nicht zuletzt bedeutete der Ausflug natürlich für Russ und mich ein ausgezeichnetes Training. Wir können zufrieden sein.
Bert Huizenga ist noch nicht aus Wamena zurück, und wir freuen uns über den ausnahmsweise einmal regenlosen Tag ohne Vorbereitungsarbeiten. Aber obwohl es hier heute trocken ist, hängen über dem Ziel unserer Wünsche, dem Carstensz-Gebirgszug, schwere dunkle Wetterwolken.
Russ und ich genießen den Abend und die Ruhe. Jeder hängt seinen eigenen Gedanken nach. Ich stelle mir vor, daß heute in Kitzbühel das Hahnenkammrennen stattfindet. Dort ist jetzt noch heller Tag, die stehen an der Piste und zittern darum, ob »ihr« Mann den Abfahrtslauf gewinnt oder nicht, und wenn ich in Österreich wäre, würde ich auch dabeisein. Hier aber, in Ilaga, sieht mich ein Dani erst interessiert, dann sogar entsetzt an, wenn ich mehrere Zündhölzer brauche, um meine Pfeife anzuzünden. So relativ ist alles im Leben.
Sie sind schon erstaunliche Leute, diese Danis, und sie leben in einer erstaunlichen Welt. Jedes weggeworfene bunte Papier stecken sie sich ins verfilzte Haar, ins Ohr oder ins Bambusarmband. Die Stahlbänder unserer Kisten hämmern sie mit Steinen glatt und tragen sie dann als Gürtel. Und als Russ gleich in den ersten Tagen einen langen Kugelschreiber wegwarf, weil er nicht funktionierte, war sofort ein Dani da, um ihn durch die durchbohrte Nasenscheidewand zu stecken. Dort steckt er wohl heute noch. Diese Art des Nasenschmucks ist den Männern vorbehalten. Schon als Kind wird ihnen von einem Familienangehörigen das Nasenseptum mit einem dünnen Holz durchbohrt. Es folgen immer dickere Stäbe, bis das Loch so groß ist, daß sich der Festtagsschmuck, ein flachgeschliffener Eberzahn, durchstecken läßt. An gewöhnlichen Tagen trägt der Dani-Mann nur einen Vogelknochen oder einen Holzstöpsel. Russ’ Kugelschreiber dagegen wird von seinem glücklichen Finder nun wohl immer getragen. Sicher hält er ihn für den schönsten Nasenschmuck seines Stammes. Auch ihre durchlöcherten Ohrläppchen, meist mit Bambusröhren geschmückt, blieben von unseren technischen Errungenschaften nicht verschont. Schon zerrte einmal die von uns weggeworfene Stablampenbatterie das Ohrläppchen eines Danis bis fast auf die Schulter, und seine Frau war stolz darauf, als Ohrschmuck eine leere Leukoplastrolle erwischt zu haben. Das Komischste leistete sich ein Häuptling, der den Umschlag eines Briefes meiner Frau vergnügt als Lendenschurz trug.
Musikinstrumente sind den Danis, außer einer Bambus-Mundharfe, fremd. Nicht einmal Trommeln kennen sie. Aber sie besitzen durchaus Musikalität. Das haben mir ihre rhythmisch-melancholischen Gesänge bewiesen, als wir unterwegs waren, und hier im Lager lauschen sie begeistert, wenn aus unserem Empfänger europäische oder amerikanische Musik dringt.
Bert Huizenga ist aus Wamena mit der Nachricht zurückgekommen, daß übermorgen unsere restlichen Lebensmittel vom Flugzeug abgeworfen werden sollen, vorausgesetzt, daß das Wetter gut ist. Übermorgen ist Mittwoch. Dann können wir also am Donnerstag aufbrechen. Aber auch wenn das Wetter schlecht ist und der Abwurf sich verzögern sollte, wollen Russ und ich mit einem Teil der Träger losgehen. Bert wird dann hier auf gutes Wetter und auf das Flugzeug warten.
Unser Platz gleicht jetzt einem Heerlager. Überall türmen sich Säcke und Kisten, mehrere tausend Konservendosen liegen auf einem riesigen Haufen. Wir wiegen und sortieren die Lasten. Die Abwurfsäcke, die von hier zum Basislager ins Gebirge geflogen werden sollen, müssen sorgfältig verpackt sein. Sie kommen zuerst in eine wasserdichte Plastikhülle und dann noch in zwei Jutesäcke. Vor allem das lebenswichtige Salz und unsere hochwertigen Nahrungsmittel, wie etwa den Zucker, wollen wir uns damit auch dann erhalten, wenn beim Aufschlag auf dem Boden einmal ein Sack platzt. Die Blechkonserven kommen nur in einen Jutesack. Schweine brauchen wir noch. Wir haben erst eines, das Bert mit dem Revolver erschossen und bereits zum Abwurf verpackt hat.
Wir sind froh, daß nun alles in Schwung kommt. Meine Geduld wurde in diesen Tagen trotz aller Abwechslung auf eine harte Probe gestellt. Aber Geduld gehört bei einer Expedition zum wichtigsten Reisegepäck. Und wenn jemand glaubt, Regierungen, Administrationen oder gar eingeborene Träger hetzen zu können, soll er lieber zu Hause bleiben. »Asti, asti bandar ko bakaro«, sagen die Inder – »Langsam, langsam fang den Affen.« Vor allem in den Tropen, aber auch im Hochland des Himalaja und ganz besonders hier im stickigen Dschungel Neuguineas ist eine solche Philosophie der Gelassenheit unentbehrlich. Nur mit ihr kann sich dem fremden Lebensrhythmus anpassen, und das muß man. Schließlich bin ich es ja, der etwas von den Eingeborenen will. Wir brauchen die Danis und nicht sie uns. Auch bei unserer kleinen Exkursion in die Täler des Ila- und des Kelaboflusses wurde das deutlich. Sie waren natürlich die Führer, nicht Russ oder ich. Sie kannten oder fanden die Pfade, sie jagten die Tiere, sie trugen die Lasten und bestimmten den Lagerplatz.
Heute hat es wiederum sehr wenig geregnet, und jetzt, gegen Abend, tauchen die bizarren Spitzen des Messerschneidgebirges über dem Brodem niedrig ziehender Wolken auf – ein grandioser Anblick. Auch hier noch ein unerforschtes Gebiet auf dieser faszinierenden Insel, auch hier noch Geheimnis, Abenteuer, unbekannte Steinzeit. Alle nur denkbaren Forscherwünsche können hier ihre Erfüllung finden.
Keine Zeit zum Träumen. Vor uns liegen zunächst als Ziel die höchsten Gipfel Neuguineas, die Gipfel im Carstensz-Gebirge.
Bert Huizenga berichtet, daß die holländische Verwaltung gerade wieder ziemliche Schwierigkeiten im Baliem-Gebiet hat. Zwischen den Eingeborenen dort sind blutige Kämpfe ausgebrochen, die Blutrache tobt durch die Stammesgebiete, und es hat wieder mehrere Morde gegeben; auch die Polizeipatrouille der Regierung war dabei mit Speeren angegriffen worden. Während Bert das erzählt, sitzen wir vor dem Zelt im Mondlicht und trinken Genever. Huizenga lebt seit mehreren Jahren als Administrator bei den Bergpapuas – er hat also viel erlebt, was uns interessiert zu hören.
Heute vormittag sind Phil Temples Träger vom vorläufigen Hauptlager zurückgekommen und haben von ihm einen Brief mitgebracht, in dem er drei Träger besonders lobt. Kurz danach zahlte Bert die Löhne aus, und dabei sah ich, was es wert ist, einen Mann wie ihn zu haben. Er weiß, wie man mit den Danis umgehen muß, und deshalb inszenierte er eine regelrechte Auszeichnungs-»Show«: Jeder dieser drei Träger erhielt eine Stahlaxt. Was das für die Danis bedeutete, kann man nur ermessen, wenn man bedenkt, daß für sie ein Steinbeil bereits perfekte, unüberbietbare Technik ist. Und als Bert ihnen sogar noch ein Buschmesser versprach und die schönsten Kaurimuscheln aus Tahiti, waren sie auch bereit, entgegen ihrerer ursprünglichen Absicht, noch einmal ins neue Hauptlager mitzukommen.
Für Russ und mich ist die Verständigung mit den Danis noch immer sehr schwierig. Ihre Sprache scheint sehr primitiv zu sein, viele Wörter sind sich ähnlich, an aussprechbaren Zahlen haben sie nur eins und zwei. Was mehr ist, wird mit den Fingern angezeigt, wobei mir Bert heute erklärt hat, warum ich immer zu falschen Zahlenergebnissen komme. Wenn ein Dani nämlich die rechte Hand hochhebt und den kleinen und den Ringfinger einknickt, dann meint er nicht etwa »drei«, weil Daumen, Zeige- und Mittelfinger noch stehen, sondern er meint »zwei«. Es gelten die eingeknickten Finger, und entsprechend bedeutet eine geballte Faust nicht »null«, sondern »fünf«. Kein Wunder, daß es bei Russ und mir nie stimmte!
Wie einfach und wortarm die Dani-Sprache ist, mag auch daraus hervorgehen: das Dani-Wort für Mutter bedeutet zugleich alles, was mit dem Begriff »Mutter« zusammenhängt, also auch schwanger, gebären, säugen. Einen Satz allerdings habe ich bereits am ersten Tag begriffen, und es vergeht kaum ein Tag, an dem ich ihn nicht mehrmals zu hören bekomme: »Maajo uragin« – »der Regen kommt«. Er kommt immer.
Mit den ersten Vokabeln entwickeln sich natürlich auch die ersten Verbindungen. Man lernt sich kennen, kommt sich näher. Insgeheim statte ich meine Träger mit Namen aus ihrer Sprache aus, was mir das Lernen erleichtert. So heißt einer von ihnen »Tavo«, weil er besonders gern raucht. Er erinnert mich also daran, daß »tavo« soviel wie »Tabak« und natürlich auch »rauchen« bedeutet. Ein kleines Mädchen, das besonders gern lacht, haben wir »Niniki« getauft; das ist das Wort für Herz, Freude, aber auch für Kummer, weinen, für alle Arten von Gemütsbewegungen. Einen Träger wiederum, den stämmigsten von allen, nenne ich »Wameik«, weil er einen besonders schönen Eberzahn in der Nase trägt, und seine Frau heißt in meiner privaten Dani-Sprache »Yawi«, weil sie ein besonders hübsches Bastnetz mit Orchideenfasern um die Lenden trägt. »Yawi« ist der Paradiesvogel.
So komme ich diesen sonderbaren Menschen und ihren Eigenarten langsam näher, und zugleich lerne ich einiges von ihrer Sprache, ihren Gefühlen, ihrem Charakter. Zu den Eigenarten der Männer gehört übrigens, daß sie ständig mit den Zähnen knirschen. Man muß sich daran gewöhnen.
Für Russ bietet sich eine besondere Möglichkeit des Kontakts zu den Danis. Er hält jeden Tag eine »Sprechstunde« ab, behandelt Wunden und Geschwüre, und nichts bindet einen primitiven Menschen mehr, als wenn man ihm Schmerzen stillt und seine Krankheit heilt, die für ihn doch nur von bösen Geistern und Dämonen verursacht werden.
Ich habe noch einiges nachzutragen in diesem Tagebuch, weil mir am Anfang zu wenig Zeit dazu blieb. Vor allem den Besuch des mächtigsten Häuptlings vom Stamm der Uhundunis. Er ist ein Mann, der, was Wissen anbetrifft und die Art zu leben, sicher genauso primitiv ist wie seine Untertanen, und trotzdem strahlt er Würde aus. Er trägt den Kopf stolzer als die anderen, seine Bewegungen sind gemessener. Als ich ihm aber ein paar Bauernkraftspiele aus meiner Heimat zeigte, Fingerhakeln und Handdrücken, da brach sein kindlich-naives Gemüt in voller Stärke durch. Meistens verlor er. Als ich ihm aber versicherte, daß ich ihn gern zum Sohn haben möchte, machte seine Trauer über die Niederlage sofort ausgelassener Freude Platz. Russ sah unseren Spielen zu und entdeckte dabei einen Spezialmuskel der Danis, den sie wahrscheinlich dem vielen Laufen verdanken. Es ist ein Muskel in der Kniekehle, der bei uns natürlich auch vorhanden, aber nicht zu sehen ist, während er bei den Danis wie der Bizeps hervorsteht. Jetzt weiß ich, warum ich nach fünf Stunden Dschungelmarsch müde bin, während unsere Träger dann, statt zu rasten, wie die Affen auf den Baumstämmen herumturnen.
Während ich nun an meinem Tagebuch schreibe, sitzen die drei »Helden«, die von Bert ausgezeichneten Träger Phils, bei mir im Zelt und schleifen ihre neuen Äxte mit Tyrolit. Sie strahlen vor Stolz, und ich sehe ihnen an, daß sie bewundert werden wollen. Drei glückliche Wilde. Aber was heißt überhaupt »Wilde«? Sie sind ja nicht »wild«, ihre Gesellschaft orientiert sich nur an anderen Größenordnungen als unsere, und ganz bestimmt wären sie mit unseren Gesetzen genauso unglücklich, wie wir es mit ihrem Schmutz sind. Sicher ist außerdem, daß es grundfalsch wäre, diesen Eingeborenen unsere Ordnung in kurzer Zeit aufzuzwingen.