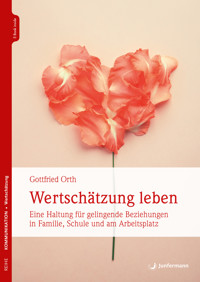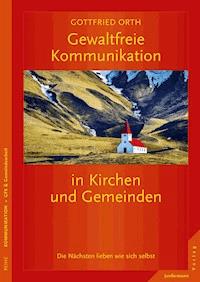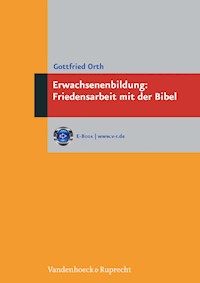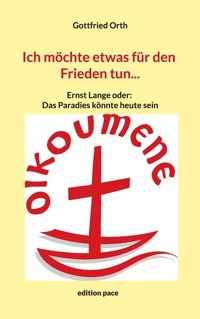
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: edition pace
- Sprache: Deutsch
Ernst Lange (1927-1974) ist wohl neben Dietrich Bonhoeffer der wichtigste und weitsichtigste ökumenische Theologe in Deutschland: Sein Lebensthema war der Frieden auf Erden und im vorherrschenden Friedensdefizit sah er den unausweichlichen Relevanz- und Plausibilitätszusammenhang für das Christentum. Ernst Lange war Autor von Laienspielen und Musicals, Kirchenreformer mit dem Projekt der Ladenkirche am Brunsbüttler Damm, er gilt als einer der bedeutendsten Prediger und Predigttheoretiker des 20. Jahrhunderts. Er war Praktiker und Theoretiker einer konfliktorientierten Erwachsenenbildung. In all dem ging es ihm um die Kommunikation des Evangeliums für die Welt in der Kirche und weit darüber hinaus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Friedensbewegter Christ, Sozialist und Demokrat – Textcollage einer politischen Biographie
Themenfelder Ernst Langes
Laien.Spiele – Ernst Langes Spielstücke
„Eine ökumenische Filiale der Weltchristenheit“ – die Ladenkirche in Berlin-Spandau
Die fantastische Geschichte, wie aus Auschwitz Bethel wurde – Predigt und Predigtlehre
Die ökumenische Bewegung und ihre westdeutsche Provinz – oder: „Was bewegt die ökumenische Bewegung?“
Erwachsenenbildung als „Sprachschule für die Freiheit“
Worauf es ankommt: Das Spiel mit den Möglichkeiten wieder in Gang setzen
„Wer redet liebt, wer liebt redet“
Jenseits konstantinischer Kartelle
„Hütet die Alternativen“
Gegen die Entfremdung anleben – eine praktische Konsequenz aus Ostern
„vita experimentalis“
Experimentelle Theologie
Glauben ist ein Tun-Wort – Zehn Thesen zum Abschluss
Vorwort
Das Buch verdankt sein Entstehen der „Werkstatt kritische Bildungstheorie“ 1 ; ANDREAS SEIFERT und JOACHIM TWISSELMANN, die Initiatoren der Werkstatt, luden mich 2021 zu einem Vortrag zu den Erwachsenenbildungsüberlegungen ERNST LANGES ein.2 Dies nötigte mich zu einer Re-Lektüre der Schriften Ernst Langes nach mehr als 30 Jahren; für diese Nötigung bin ich dankbar, ich entdeckte Bekanntes neu und erlebte mit Langes Texten eine ähnliche Faszination wie vor 30 und 40 Jahren. Ihre Konkretheit und ihre Zeitgebundenheit offenbaren ihre jeweilige Ungleichzeitigkeit und Uneingelöstheit: Das prophetische Moment der Schriften Langes und damit ihr „Mehrwert“ an Hoffnung lassen sie mir ähnlich ‚frisch‘ erscheinen wie einen prophetischen Text aus dem Jesajabuch. Und immer wieder zielt Lange in ganz verschiedenen Kontexten darauf, ‚die Füße auf den Weg des Friedens zu richten‘ (Lukas 1, 79).
Ich entdeckte neu, dass zwischen dem Werk Ernst Langes und den Schriften KARL BARTHs, HELMUT GOLLWITZERs und DOROTHEE SÖLLEs vielfältige Beziehungen bestehen – teils direkter Art durch Namensnennung und Zitate, teils über Umwege von Berlin nach Frankreich und zurück mit GEORGES CASALIS, teils eher ‚untergründig‘ in ähnlichen, freilich unterschiedlich formulierten Gedanken. Auch dies gehört zum Reichtum von Langes Texten.
Diese Texte selbst finden sich vielfach von mir zitiert – nicht zuletzt als Einladung Ernst Lange neu zu lesen. Dabei geht es nicht darum, ihn zu bewundern, sondern sich anstecken zu lassen von seinen Ideen und seinen Fragen, z. B. wie Erfahrungswissen und Glaubenswissen beieinander bleiben – zugunsten des Friedens in unserer Kriegs- und Bürgerkriegswelt. Und dies ist für Lange keine theoretische Frage, sondern er argumentiert nahezu immer im Kontext der Praxis, zuvorderst einer ökumenischen, auf den bewohnten Erdkreis bezogenen: „Was für ein Auftrag stellt sich uns und woher?“ ist eine für ihn zentrale Frage im Interesse des Lebens in Frieden und Gerechtigkeit auf unserer Erde. Diese über sein Leben währende Konstanz an ganz unterschiedlichen Orten, mit verschiedenen Gruppen und in sehr verschiedenen beruflichen Rollen und Kontexten ist wichtig für mich, weil sie voller immer neuer Anregungen und Verknüpfungen erscheint.
Für vielfältige Unterstützung und lebendigen Austausch während der Arbeit an diesem Buch danke ich den Freunden ULRICH BECKER, GERT RÜPPELL und GERHARD KÖBERLIN; ohne die Hilfen von MATTHIAS-W. ENGELKE, dem ich ebenfalls herzlich danke, hätte das Buch nicht pünktlich erscheinen können.
Ernst Langes Todestag jährt sich am 3. Juli 2024 zum 50. Mal. Trotz seines frühen Todes gilt ein Buchtitel, den RÜDIGER SCHLOZ einer kleinen Sammlung von Aufsätzen Ernst Langes gegeben hat: „Nicht an den Tod glauben. Praktische Konsequenzen aus Ostern“. Nehmen wir mit Ernst Lange einen seiner Aufsatztitel in diesem Büchlein ernst: „Today is the first day of the rest of your life. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens.“ Dieses Heute ist immer wieder: jetzt. Jetzt ist die Zeit für die Arbeit für Frieden und Gerechtigkeit und gegen die Zerstörung des Lebens auf der Erde. Jetzt kann aus Auschwitz Bethel werden: „Sie wissen, dass es ein Wunder ist, wenn aus Auschwitz Bethel wird. … Es ist eine Frage auf Leben und Tod für Gott und die Welt. Wenn wir uns das Wunder nicht mehr denken können, kann Gott es auch nicht tun.“ Langes Insistieren auf dieser abrahamitischen „Hoffnung, die gegen alle Hoffnung hofft“ (Röm 4, 17 f) – das ist es, was für mich Glaube und Theologie ausmacht. Weil ‚Tradition nicht das Bewahren der Asche, sondern das Schüren der Flamme ist‘, so der französische Sozialist und Pazifist JEAN JAURÈS in einer Parlamentsdebatte 1910, und Ernst Lange auch in dieser Tradition steht – deshalb dieses Buch.
Es ist Zeit, neu von und mit Langes Texten zu lernen, sein Erbe ist unverbraucht und die Sätze auf dem Titelblatt der Ökumenischen Utopie haben für mich nichts von ihrer Bedeutung verloren: „Es gibt viele Kinder. Manche sind schwarz, manche sind gelb, manche sind weiß. Aber sie haben zusammen ‚nur eine Erde‘. Man muss einen Tanz für alle machen. Dann stimmen die Farben. Das Paradies ist heute. Vielmehr: es könnte sein…“
Rothenburg, an Ostern 2024 Gottfried Orth
„Gott hat nicht die Religion geschaffen, sondern die Welt!“ (Franz Rosenzweig)3
„Bibel und Christentum sind Einweisung in die Welt.“ (Hans Paul Schmidt)4
1www.werkstatt-kritische-bildungstheorie.de
2 Vgl.: G. ORTH, „Ich möchte etwas für den Frieden tun“ – Bildung im Horizont der Ökumene. Ernst Lange heute lesen. In: A. SEIVERTH, J. TWISSELMANN, M. EBNER VON ESCHENBACH (Hrsg.), Zum Selbstbewusstsein der Erwachsenenbildung. Beiträge aus der „Werkstatt kritische Bildungstheorie“. Reihe: EB – LBL. Bielefeld 2023. S. 183-206.
3 Rosenzweig, F. (1925). Das neue Denken: Einige nachträgliche Bemerkungen zum „Stern der Erlösung“. In: Der Morgen: Monatsschrift der Juden in Deutschland, 1(4), S. 426-451.
4 Aus einer nicht mehr auffindbaren Vorlesung von H. P. Schmidt.
Einleitung
ALFRED BUTENUTH, Ernst Langes lebenslanger Freund und Kollege, berichtet von folgender „Erfahrung“: „Je länger ich Ernst Lange kenne, umso mehr habe ich den Eindruck, dass er selbst, aber auch unsere Freundschaft und unsere gemeinsame Arbeit politisch bestimmt sind: politisch sind jedenfalls Motive und die Ziele.“ Und weiter: „Als Ernst Lange nach Genf ging, formulierte er ausdrücklich eine politische Zielsetzung und Motivation. Er schrieb an den Generalsekretär: ‚Ich möchte etwas für den Frieden tun‘.“5 Das Pathos dieser Worte hat er 1972 revidiert: „Heute weiß ich: Man spricht so etwas nicht aus. Man gerät dadurch in eine lächerliche Perspektive, vor allem vor sich selbst.“6 Doch das genannte Ziel „verlor er in allen seinen verschiedenen Funktionen nie aus den Augen“7. Es ging ihm angesichts der ‚gegenwärtigen internationalen Lage‘ (1967/68) darum, ‚vielleicht ein klein wenig für den Frieden in Kirche und Welt zu tun – mehr als gegenwärtig in einer Gemeinde oder an der Universität‘. 8 Dieses Buch in kriegerischer Zeit – wir leben ja längst, wie Papst FRANZISKUS analysiert9, auf einer Erde, die in „einem dritten Weltkrieg“ immer weiter „zerbröckelt“ – ist dieser Handlungsperspektive Ernst Langes verpflichtet.
Der Impetus, mit dem er in Genf an diese Arbeit ging, war der seiner Jonapredigten über „die verbesserliche Welt“, die er im Frühjahr und Herbst 1967 in der Ladenkirche der „Evangelischen Gemeinde am Brunsbüttler Damm“ in Berlin-Spandau gehalten hat: „Liebe Freunde“, so beginnt die letzte dieser Jonapredigten, „das Buch Jona erzählt die fantastische Geschichte, wie aus Auschwitz Bethel wurde. Wie aus der Vorhölle, in der der Mensch des Menschen Wolf ist, – nun, nicht gerade das Himmelreich wurde, aber doch die menschlichere, die brüderlichere Welt, in der die Menschen einander beim Leben helfen. … Wenn das Volk Gottes nicht mehr an Wunder glauben will, wird Gott eigentümlich hilflos. Seine Buße bekommt in der Welt nicht Hand noch Fuß, bewirkt also auch nicht die Buße Ninives, wenn das Volk Gottes seinen Wunderglauben verliert und also auch nicht mehr als Assistenz, als Helfershelfer, als Ansager des Wunders aufzutreten vermag. Gottes überraschender Entschluss, Ninive zu retten, kann dann im Sande verlaufen, im Sande unseres Unglaubens. … Wenn wir uns das Wunder nicht mehr denken können, kann Gott es auch nicht tun.“10
Es geht um die Menschen, wenn es um Gott geht.
Die politischen – vor allem auch die gesellschafts(!)-politischen – Motive und Ziele, die die Arbeit Ernst Langes – wie Alfred Butenuths – bestimmten, fielen freilich nicht vom Himmel. Sie stehen im Kontext der frühen pädagogischen und theologischpolitischen Impulsfelder des jungen Ernst Lange, die wenigstens genannt sein sollen.11
Dabei ist zunächst eine frühe Bildungserfahrung zu nennen: Langes Schulzeit im Landschulheim in Schondorf am Ammersee. Er und seine Schwester Ursula besuchten seit 1937 diese von dem Reformpädagogen HERMANN LIETZ geprägte Schule; während URSULA LANGE dort 1939 Abitur machte, musste Ernst Jakob Lange die Schule 1943 aufgrund der sich verschärfenden Rassegesetzgebung – er war von den Nationalsozialisten als „Halbjude“ eingestuft – verlassen. Doch Jugendbewegung und Reformpädagogik mit musischer und ästhetischer Bildung und eine auf Eigenverantwortung und Selbstätigkeit zielende Erziehung waren im Landschulheim so selbstverständlich wie ein ‚Lernen mit Kopf, Herz und Hand‘ – ein erstes Feld pädagogischer (Selbst-)Erfahrung.
Während seiner Schulzeit begegnete Lange dem schlesischen Pfarrer GEORG NOTH, ein Freund seines Vaters, den dieser für die beiden Kinder als Vormund eingesetzt hatte. Georg Noth gehörte dem radikalen Flügel der Bekennenden Kirche Schlesiens an und in seinem Haus fanden, so schreibt es Lange in einem Brief an RUTH KRAFT, Gespräche „in einem sehr anregenden Kreis“ statt, „der vorwiegend aus Pastoren oder doch Leuten, die sich wenigstens mit dieser wichtigsten aller Fragen auseinanderzusetzen wagen, besteht (alle anderen sind nämlich dazu zu träge oder zu feige)“. Über diese wichtigste aller Fragen hat Lange zuvor geschrieben: „Darüber dürfen wir uns, glaub‘ ich, keinen Illusionen hingeben, es wird eine Zeit kommen, die uns so tief in den Dreck wirft, dass wir froh sein können, wenn es nicht über uns zusammenschlägt. Aus dem Chaos, das der Zusammenbruch jeder alten Ordnung notwendig zur Folge hat, werden ein paar Menschen neu erstehen und aus ihrem Glauben eine neue Form schaffen, in der sich eine neue Ordnung entwickeln kann. Und zu dem Kreis dieser Menschen müssen wir uns berufen fühlen, dem gemäß müssen wir unseren Weg finden, der uns vom Chaos frei macht. Dazu sind wir aber wohl noch nicht tief genug gefallen. Das klingt wahnsinnig pathetisch, aber Du siehst daran, womit ich mich hauptsächlich beschäftige und wo ich mir meine Aufgabe gestellt sehe.“12
1946 lernt Ernst Langes seine spätere Frau BEATE HEILMANN in einem „Sonderkurs zur Erlangung der Reife für rassisch Verfolgte“ in Berlin kennen. Auch sie war von den Nationalsozialisten eingestuft als „Mischling ersten Grades“. Ihr Vater war der letzte Fraktionsvorsitzende der SPD im Preußischen Landtag, gehörte auch ab 1928 der sozialdemokratischen Fraktion des Reichstages an und wurde sogleich nach dem Ermächtigungsgesetz verhaftet und 1940 im Konzentrationslager Buchenwald ermordet. Beate Heilmann und ihre Familie „konfrontierten Lange mit einer ihm gänzlich neuen Perspektive“. Die kirchenkritische Haltung der Familie Heilmann – der Vater Ernst war bereits mit 17 Jahren in die SPD eingetreten – forderte Ernst Lange dazu heraus, nach der gesellschaftlichen Relevanz der Kirche zu fragen, und führte dazu, dass er sich selbst sozialdiakonisch (Berliner Stadtmission) und sozialpolitisch engagierte. Beate Heilmann und Ernst Lange – sie heirateten 1947 – traten 1946 in die SPD ein.13
Ein zweites Feld pädagogischer (Selbst-)Erfahrung war das Studiensemester im Winter 1947, das Lange gemeinsam mit Butenuth in der von NIKOLAI FREDERIK SEVERIN GRUNDTVIG geprägten und von NATHAN SÖDERBLOM ins Leben gerufenen „Sigtuna Folkehøjskoler“ in Schweden verbrachte. Diesen schwedischen Volkshochschulen ging es um eine möglichst weitgehende Partizipation aller Menschen an einem freiheitlich-demokratischen Umgang miteinander. So waren hier für Lange intellektuelle und musische Bildung ebenso erfahrbar wie Gemeinschaft und eine selbstverständliche Spiritualität in dieser ‚Evangelischen Akademie‘, die 1917 gegründet wurde und als die älteste ihrer Art in Europa gilt.
Schließlich sind Ernst Langes theologische Lehrer, die er in seinem Studium 1946-1950 in Berlin und Göttingen gehört oder deren Schriften er gelesen hatte, zu nennen: KARL BARTH, HEINRICH VOGEL, GEORGES CASALIS und MARTIN ALBERTZ in Berlin sowie HANS IWAND in Göttingen. Barth, Vogel, Albertz und Iwand waren Mitglieder der Bekennenden Kirche und nach dem Krieg waren sie alle Mitbegründer oder Mitglieder der Christlichen Friedenskonferenz (CFK), engagiert im christlich-marxistischen Dialog mit einer jeweils eigenständigen sozialistisch-demokratischen Orientierung. Hinzukam eine große Übereinstimmung dahingehend, dass ‚Dogmatik‘ und ‚Ethik‘, ‚Theorie und Praxis‘ aufs Engste und unlöslich zusammengehören.
Von großer Bedeutung war sodann DIETRICH BONHOEFFER, dessen Schriften EBERHARD BETHGE in jenen Jahren herauszugeben begann. Dazu kamen insbesondere sein Lehrpfarrer im Vikariat: der Bonhoeffer-Schüler Pastor WINFRIED MAECHLER sowie die Sozialarbeiterin GERTRUD STAEWEN.14 So erscheint es nur konsequent, dass Ernst Lange zu dem aus den Bruderschaften der Bekennenden Kirche entstandenen Berliner Unterwegskreis 15 fand, in dessen Zeitschrift „Unterwegs“ er 1951 auch seinen ersten Aufsatz mit dem Titel „Von der sozialen Lage Westberlins“16 veröffentlichte. Nicht von ungefähr ist dies ein Aufsatz, der – ohne jede theologische Konnotation – die soziale Situation der Menschen analysiert und aufgrund dessen „eine gesellschaftliche Umwandlung grundlegender Art" fordert.
Es geht um die Menschen, wenn es um Gott geht.
Und „Theologie und Kirche sind geeignete Instrumente für die Arbeit an der ‚verbesserlichen Welt‘.“17 Dies galt in der Wahrnehmung Alfred Butenuths für das Leben und Werk Ernst Langes: Seine Theologie entstand im Kontext gesellschaftlicher und kirchlicher Praxis. 1992 sagte Alfred Butenuth in einem Vortrag zur Eröffnung des Ernst Lange-Instituts in Rothenburg ob der Tauber: „Unsere Kirche gleicht inzwischen einem schweren Tanklastwagen, der in eine Sackgasse gefahren ist, an deren Ende es keine Wendemöglichkeit gibt.“18 Und 2003 sagte er in einem Interview: „Wir (erg. Ernst Lange und Alfred Butenuth) haben uns in unserem Denken beim Eintritt in die Kirche, davor und danach, heraus entwickelt aus der Kirche. Ernst Lange würde heute, ich wage das zu behaupten, überhaupt nicht bei der Kirche sein. Also überhaupt nicht. Der könnte das nicht aushalten … diese nationale Engstirnigkeit, diese Lernunfähigkeit. ... Ich habe den Eindruck, dass die Kirche eigentlich nur versteht, was sie schon weiß.“19
In diesen Sätzen steckten auch Zorn und vielleicht Resignation.
Und doch halte ich es für bedeutsam, heute oder vielleicht gerade heute – in den 2020er Jahren – an Ernst Lange zu erinnern, nachzulesen, was wir von ihm lernen können – nicht zuletzt angesichts des weiter bestehenden konstantinischen Kartells von Staat und Kirchen, angesichts gebliebener nationalkirchlicher Engstirnigkeit, angesichts eines andauernden „Prozesses der De-Ökumenisierung“ und des ‚Verharrens der Evangelischen Kirche in Deutschland in kolonialistischen und rassistischen Strukturen‘.20
So frage ich in diesem Buch zunächst in Form einer chronologischen Collage21 aus seinen Texten nach der gesellschafts-politischen Biographie Ernst Langes unter der Überschrift „Friedensbewegter Christ, Sozialist und Demokrat“; hier werden seine politischen Optionen und seine zeitdiagnostischen und analytischen Überlegungen, Stichworte und Hoffnungen zu Gesellschaft und Kirche deutlich. Davon ausgehend werde ich in einem zweiten Teil eher systematisch folgenden Themen nachgehen:
Laien.Spiele – Ernst Langes Spielstücke: Es geht um Modelle gelingender und scheiternder Praxis.
„Eine ökumenische Filiale der Weltchristenheit“ – Die Ladenkirche in Berlin-Spandau als Gemeindepraxis ‚im Übergang‘.
Die fantastische Geschichte, wie aus Auschwitz Bethel wurde – Predigtpraxis und Predigtlehre.
Die ökumenische Bewegung und ihre westdeutsche Provinz – oder: „Was bewegt die ökumenische Bewegung?“ – ökumenische Praxis im „gelobten Land“ gelebt und aus der Nähe bedacht.
Erwachsenenbildung als „Sprachschule für die Freiheit“, die in der Ladenkirche begann, sich in Genf fortsetzen sollte und die Lange nach der Begegnung mit Paulo Freire als Theorie formulierte.
Das Buch endet im dritten Teil mit Überlegungen zu Gedanken Ernst Langes, die Theologie als experimentelles Denken im Dienste des Lebens auf der Erde und Kirchen als Orte des Spiels und der Experimente des Lebens für diese Erde verdeutlichen können, konnte sich doch Ernst Lange, lange bevor er es 1970 notierte, „Theologie nur noch als experimentelles Denken im Doppelsinne des Wortes, als Nachdenken der vita experimentalis und als Denkexperiment vorstellen“22.
5 A. BUTENUTH, Ernst Lange: Versuch eines Zugangs zu seiner Person und seinem Werk. In: Ernst Lange-Institut für ökumenische Studien (Hrsg.), Chancen des Alltags zwischen Wirklichkeit und Verheißung. Rothenburg o.d.Tbr. 1992. S. 3-10. Zitat S. 3 und 7. Das eingangs genannte Zitat von JEAN JAURÈS, das aus einem Parlamentsdisput im französischen Parlament mit dem antisemitischen, rechtsnationalen Schriftsteller und Politiker MAURICE BARRÈS stammt, lautet vor seiner vielfachen Umformung und Zuschreibung an andere Autoren von Konfuzius bis Gustav Mahler folgendermaßen: „Herr Barrès fordert uns öfter auf, in die Vergangenheit zurückzugehen; für die, die nicht mehr sind und die, die zur Unbeweglichkeit erstarrt, gleichsam heilig geworden sind, hegt er eine Art pietätvolle Verehrung. Nun, meine Herren, auch wir verehren die Vergangenheit. Aber man ehrt und achtet sie nicht wirklich, indem man sich zu den verloschenen Jahrhunderten zurückwendet und eine lange Kette von Phantomen betrachtet: die richtige Art, die Vergangenheit zu betrachten, ist, das Werk der lebendigen Kräfte, die in der Vergangenheit gewirkt haben, in die Zukunft weiterzuführen.“
6 Ernst LANGE, Die ökumenische Utopie oder Was bewegt die ökumenische Bewegung? Stuttgart 1972. S. 208.
7 A. BUTENUTH, aaO. S. 8.
8 W. SIMPFENDÖRFER, Ernst Lange. Versuch eines Porträts. Berlin 1997. S. 145.
9 Vgl. dazu: St. A. WAHL, St. SILBER, Th. NAUERTH (Hrsg.), Papst Franziskus: Mensch des Friedens. Zum friedenstheologischen Profil des aktuellen Pontifikats. Freiburg 2022.
10 E. LANGE, Die verbesserliche Welt. Möglichkeiten christlicher Rede erprobt an der Geschichte vom Propheten Jona. Stuttgart/Berlin 1968. S. 45 f.
11 Vgl. dazu ausführlicher: Gerhard ALTENBURG, Der Frühzeit trauen. Theologische Impulsfelder des jungen Ernst Lange (1927-1974). In: Pastoraltheologie 102. Jg. 2013. S. 507-521. Vgl. dazu ausführlich: ders., Kirche – Institution im Übergang. Eine Spurensuche nach dem Kirchenverständnis Ernst Langes. Reihe: Kirche in der Stadt, Bd. 21. Berlin 2013. Vgl. dazu auch: Martin BRÖKINGBORTFELDT u.a. (Hrsg.), Ernst Lange, Briefe 1942-1974. Berlin 2022. Insbes. S. 1949. Vgl. weiter: W. SIMPFENDÖRFER, aaO., insbes. S. 11-39.
12 Ernst LANGE, Briefe 1942-1974. AaO. S. 24 f.
13 Vgl. W. SIMPFENDÖRFER, aaO. S. 26 ff.
14 Zu weiteren Prägungen der Jugend- und jungen Erwachsenenzeit Langes vgl. die hervorragende Dissertationsschrift von Gerhard ALTENBURG, Kirche – Institution im Übergang. AaO. Diese Schrift ist wie die von Markus RAMM, Verantwortlich leben. Entwicklungen in Ernst Langes Bildungskonzeptionen im Horizont von Theologie, Kirche und Gesellschaft. EvThR 1. Regensburg 2005 im Blick auf die Quellen zu Ernst Lange – auch dort, wo ich Situationen und Entwicklungen anders gewichte und sehe – von herausragender Bedeutung.
15 Zum Unterwegskreis vgl. Gerhard ALTENBURG, „Junge Draufgänger“ unterwegs. In: BThZ 27 (2010). S. 351-373; zusammenfassend in: ders.: Kirche – Institution im Übergang. AaO. S. 185 ff.
16 In: Unterwegs 5, 1951. S. 246-249. In diesem Aufsatz analysiert er die „schlechthin verzweifelte Lage“ , kritisiert den Verlust des elementarsten Menschenrechtes, des Rechtes auf Arbeit und hält fest: „Auf keinem Gebiet ist es heute im Grunde mit Notmaßnahmen getan, was nottut ist eine gesellschaftliche Umwandlung grundlegender Art.“ (S. 249) S. u. S. 23 f.
17 A. BUTENUTH, aaO. S. 7
18 Ebd.
19 M. Ramm, Interview mit Alfred Butenuth am 5. 02. 2003 zu Ernst Langes Bildungsverständnis und Wirkung. In: M. RAMM, Verantwortlich leben. AaO.. S. 324-352. Zitat S. 342.
20 Vgl. Zur Beendigung kolonialistischer Beziehungen der EKD. Ein Aufruf anlässlich der Vollversammlung des ÖRK 2022 in Karlsruhe. Für die Solidarische Kirche im Rheinland und den Mainzer Arbeitskreis Südliches Afrika. Oktober 2021. Frauke HEIERMANN und Dr. Markus BRAUN. In: Deutsches Pfarrerinnen- und Pfarrerblatt. 2/2022. S. 106-108. Zitat S. 106.
21 Aufgrund dieser Chronologie zu Beginn des Buches erscheinen wenige Zitate im Buch zweimal, einmal in der Chronologie und einmal an ihrem systematischen Ort.
22 Ernst LANGE, Nachwort. In: W. BERNET, Gebet. Mit einem Streitgespräch zwischen Ernst Lange und dem Autor. Stuttgart/Berlin 1970. S. 154-163. Zitat S. 158. Vgl. dazu auch das Buch eines Freundes von Ernst Lange: Hans SCHMIDT, Vita experimentalis. Ein Beitrag zur Verkündigung und Gestaltwerdung in der sogenannten Bildungsgesellschaft. München 1959.
Friedensbewegter Christ, Sozialist und Demokrat – Textcollage einer politischen Biographie
Ernst Lange „hatte nie einen Standpunkt – in Deutschland ein schlimmer Mangel; verlor aber zugleich in all seinen verschiedenen Funktionen ein Ziel – die Arbeit für den Frieden – nie aus den Augen“23. Dies wird auch darin deutlich, dass Ernst Lange in den 1950er Jahren nahezu jedes Jahr und auch später in großer Intensität Texte zu diesem Thema publiziert. Doch die Bemerkung des Freundes Alfred Butenuth macht es nicht leichter, Ernst Langes politische Optionen und seine zeitdiagnostischen und analytischen Überlegungen und Stichworte zu Gesellschaft und Kirche im Kontext seiner gesellschaftlichen, politischen und kirchlichen Praxis darzustellen.24 Ich werde biographisch-zeitgeschichtlich vorgehen und orientiere mich dabei an biographischen Daten Ernst Langes sowie den Erscheinungsjahren seiner Veröffentlichungen.25 So möchte ich ein chronologisches Bild seiner sich in Texten findenden politischen Optionen und zeitdiagnostischen und analytischen Überlegungen und Stichworten zu Gesellschaft und Kirche in kurzen Zusammenfassungen und Originalzitaten26 zeichnen.
*
1946-1949
Beitritt zu den „Falken“ – 1946
1946 trat Ernst Lange der Sozialistischen Jugendorganisation der „Falken“ bei und arbeitete in einer „Falkengruppe“ in Berlin-Wilmersdorf mit.27
Sigtuna, die Heimvolkshochschule in Schweden – 1947
Ernst Langes marxistische Bildung hatte früh begonnen. JAN HERMELINK machte dies 1997 in seinem Aufsatz „Gibt es eine kirchliche Effizienz?“28 deutlich und er beginnt dabei in Sigtuna (1947): „Alfred Butenuth erzählte mir, Ernst Lange habe ihm – wohl schon zu Beginn ihrer Freundschaft29 – gestanden, er kenne das ‚Kapital‘ von Karl Marx eigentlich viel besser als die Bibel. Es ist deshalb vielleicht nicht erstaunlich, wie intensiv sich der Sprachkünstler Lange, der seine Bilder verschiedensten Lebensbereichen entnahm, gerade der Sprache der Ökonomie bedient hat. … In der Skizze zur Theorie kirchlichen Handelns von 1972 erscheint die Kirche selbst bekanntlich als ‚das Produkt eines Kartells zwischen dem Christentum und einer bestimmten Gesellschaft‘, eines Kartells, das beständig vor der Frage der ‚Bestandserhaltung‘ steht.“ 30 Seit den frühesten Schriften Langes lässt sich die Begrifflichkeit marxistischer Ökonomie nachweisen: Bilanz, Mehrwert, Gewinnung, Kartell, Kredit, Bürgschaft u.a.m. So fasst Hermelink zusammen: „Wenn der marxistisch gebildete Ernst Lange die Kirche als ein ‚Kartell‘ bezeichnete, dann dürfte er also gewusst haben, was er tat: Er stellte implizit die These zur Diskussion, dass das gesamte kirchliche Handeln den zweckrationalen Bedingungen kapitalistischer Ökonomie unterliegt.“31
Eine zweite Erfahrung in der Heimvolkshochschule war die der Gleichheit und Mitbestimmung, des demokratischen Verhältnisses von Lehrern und Schülern: Lehrer waren zugleich Schüler und Schüler waren zugleich Lehrer – sehr viel später in der Zusammenarbeit mit PAULO FREIRE begegnet dies Thema explizit wieder.
Theologiestudium an der Friedrich-Wilhelm-Universität, ab 1949 dann Humboldt-Universität genannt
1948 engagierte sich Ernst Lange – er war gewähltes Mitglied des Fakultätsrates der Theologischen Fakultät – als „Wortführer des Protestes“32 gegen die Relegation von drei studentischen Vertretern durch die Sowjetische Militäradministration in Deutschland; er wollte nicht mehr „Mitglied einer Körperschaft sein, die nur dazu dient, den Schein einer demokratischen Selbstverwaltung aufrechtzuerhalten“.33
*
1950-1959
Ernst Lange arbeitete im „Zehlendorfer Jugendhof“ mit, einem Reformprojekt der Berliner Justizbehörde für Strafentlassene und im Rahmen des von Gertrud Staewen initiierten Projektes der „Schutzfreundschaften“ in der Haftanstalt Berlin Tegel.34
„Ein frommer Fehlschlag“ (1950)
Das erste Spielstück Ernst Langes „Ein frommer Fehlschlag“ erschien im Frühjahr 1950. In der „Geschichte der Gertrud Staewen 1894-1987“, die MARLIES FLESCH-THEBESIUS unter dem Titel „Zu den Außenseitern gestellt“ veröffentlicht hat, finden Ernst Lange und sein erstes Laienspiel Erwähnung: GERTRUD STAEWEN arbeitete nach dem 2. Weltkrieg als „kirchliche Fürsorgerin in der Männer-Strafanstalt Berlin-Tegel. … Sie liebte alle diese Männer, die Mörder und Heiratsschwindler, die Scheckfälscher und Einbrecher. Den Grund der jeweiligen Haftstrafen erwähnte sie höchstens beiläufig. Vergehen und Strafe waren Sache des Richters, und der hatte gesprochen. Jetzt ging es darum, den Boden für ein neues Leben zu bereiten. Dazu suchte sie sich Helfer. Sie setzte eine Anzeige in der Zeitschrift ‚Unterwegs‘, warb bei Vorträgen in den Gemeinden und fand junge Männer, meist Studenten der Theologie, die Patenschaften bei den Häftlingen übernahmen. ‚Schutzfreundschaften‘ nannte sie das – eine raffinierte Wortbildung, die nicht erkennen ließ, wer wen beschützte. Die Studenten schützten die Häftlinge vor dem gefährlichen Einerlei des Strafvollzugs, und die Häftlinge schützten die Studenten vor der Illusion einer heilen Welt. Viele der jungen Männer nahmen aus dieser Arbeit Eindrücke mit, die für ihr Leben bestimmend wurden. … Die nachhaltigste Spur hinterließ Ernst Lange. … Er bediente sich einer neuen Form der Verkündigung, des Laienspiels. Zu dieser Zeit arbeitete er im ‚Zehlendorfer Jugendhof‘, einem Reformprojekt der Berliner Justizbehörde für Strafentlassene, dem Getrud Staewen höchste Aufmerksamkeit widmete. Was er dabei erlebte, setzte er um in dem Spiel ‚Ein frommer Fehlschlag‘35, das begeisterte Resonanz fand. Es zeigt einen Strafgefangenen, der während seines Freigangs von einer gutwilligen christlichen Familie zum Mittagessen eingeladen wird, wobei sich unglücklicherweise herausstellt, dass er nicht, wie angenommen, wegen Diebstahls verurteilt wurde, sondern wegen Totschlags. Einen Totschläger aber will die Familie nicht an ihrem Tisch haben, und es kommt zum Eklat. … Der Gastgeber verweist ihn des Hauses. Resigniert zieht der Sohn der Familie die Schlussfolgerung: Wir beten jeden Tag, ‚Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast‘, und wenn er kommt, schmeißen wir ihn hinaus.“36 Es kommt zu einem Projekt in der Haftanstalt: Die jungen Helfer führen gemeinsam mit den Häftlingen ein Laienspiel auf: „Dass Ernst Lange bei diesem Projekt der große Anreger war, wird nicht erwähnt, steht aber außer Frage.“37
„Von der sozialen Lage Westberlins“38 (1951)
Ernst Lange plädiert in diesem Text – er war jetzt Vikar in Westberlin – für das Recht auf Arbeit, „weil eine Gesellschaft, die nicht fähig ist, ihren Gliedern das Recht auf Arbeit zu garantieren, nicht lebensfähig ist“. Er kritisiert „Wohnungsnot, Verwahrlosung, Jugendkriminalität, die Krankheits- und Selbstmordstatistik sowie das Schulwesen und allgemeine Bildungsniveau“ und resümiert: „Wir befinden uns in einer schlechthin verzweifelten Lage. Auf keinem Gebiet ist es heute im Grunde mit Notmaßnahmen getan, was nottut ist eine gesellschaftliche Umwandlung grundlegender Art.“ Er kritisiert Kapitalismus und Kommunismus und plädiert für das „selbstverantwortliche Leben des Menschen in den ihm gemäßen Zusammenhängen – Familie, Nachbarschaft, Staat“ –, zu dem jeder Einzelne etwas beitragen könne.
„Bibel oder Zeitung?“39 (1951)
Der Text ist wie sehr viel später „Die ökumenische Utopie“ eine Collage aus Zeitungsbericht (Metallarbeiterstreik), Bibeltext (Lukas 5, 32: Die Kranken bedürfen des Arztes) und Ernst Langes Text, die jeweils typographisch unterschiedlich gesetzt sind. Ganz auf der Linie Karl Barths40 schreibt Lange programmatisch für sein späteres Leben: Wenn wir die Bibel lesen ohne die Zeitung, „dann ist Gott schon in der Kirche eingesperrt, dann ist das Christentum weltfremd und das Reden von Vergebung und Nächstenliebe und Gehorsam ein einziger großer Selbstbetrug. … Bibel und Zeitung gehören zusammen. Je entschlossener wir uns in das Leben hineinstellen, von dem die Zeitung redet, in das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben, desto lebendiger und hilfreicher wird uns die Bibel werden und der, von dem sie zeugt.“
„Wählt das Leben“41 (1952)
In dieser „Richtung und Linie“ spricht Ernst Lange als einer von drei Vertretern der jungen Generation auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 1952 in Stuttgart zu dessen Motto „Wählt das Leben“ und konkretisiert, was es heißt, ‚sich in das Leben hineinzustellen‘; er sagt u.a.: „Das Leben der Zeit ist nicht in Kirchenräumen, nicht an Lagerfeuern und in Freizeitheimen. Das Leben der Zeit ist in Menschenhallen, an Werkbänken und Schreibtischen. Da ist das Leben unserer Mitmenschen, da ist, wenn wir ehrlich sind, auch unser Leben. Jesus Christus will nicht ein Scheinleben neben dem Leben sein, sondern er will dieses wirkliche Leben retten. … Das Leben der Massen ist unser Leben und unsere Aufgabe. Dort, wo die Menschen in Massen leben, müssen wir bewähren, dass Gottes Wort uns zu Menschen macht, nicht in den windstillen Räumen der Gemeindehäuser, denn das Leben Christi will hinein in den Alltag, in das Leben der Zeit. … Es ist an der Zeit, dass wir die Fragen der weltlichen Probleme – der Betriebsverfassung und des Klassenkampfes – als unsere Fragen ernstnehmen, als Fragen nämlich, die Gott uns um des Nächsten willen stellt. Niemand nimmt uns die Verantwortung für unser Werk ab, dem berühmten Konstrukteur so wenig wie dem jüngsten Lehrling, der nur einen Handgriff am Fließband tut. Wir sind gefragt, ob dieser Handgriff Frieden schafft oder Unfrieden, ob der dem Nächsten dient oder nur uns selbst.“ Es ist die Zeit der beginnenden Debatte um die Wiederbewaffnung Westdeutschlands, in der Lange das Thema „Frieden“ im Kontext der Produktionsbedingungen thematisiert und damit zur Frage an jeden einzelnen macht.
„Evanston 1954“42 (1954)
Als Jugenddelegierter nimmt Ernst Lange an der Zweiten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1954 in Evanston teil und verfasst für die Zeitschrift „Unterwegs“ einen ausführlichen Bericht: Gleich zu Beginn weist Ernst Lange auf den‚ an allen Ecken und Enden spürbaren Einfluss der nichttheologischen Faktoren hin und nimmt damit ein Thema auf, was später zentrale Bedeutung gewinnt: Was die Welt trennt, trennt auch die Kirchen. In seinem Bericht über die Sektion III „Verantwortliche Gesellschaft in weltweiter Sicht“ kritisiert er, dass aus dem Text von Amsterdam lediglich die Kritik des Kommunismus, nicht aber die des Kapitalismus in den Vollversammlungstext aus Evanston übernommen ist. Besondere Bedeutung misst Lange der Rolle HROMADKAS bei, den er als einen „der populärsten Persönlichkeiten in Evanston“ kennzeichnete und dessen Vortrag zur Bedeutung der Kirche in der Welt mit dem Titel „Die Abhängigkeit der Kirche von Gott und ihre Unabhängigkeit vom Menschen“ Lange breit referiert.
„Die Jugend und die Pariser Verträge“43 (1955)
Im „Deutschen Manifest“, das der Versammlung in der Frankfurter Paulskirche am 29. Januar 1955 vorgelegt wurde, heißt es: „Die Aufstellung deutscher Streitkräfte in der Bundesrepublik und der Sowjetzone muss die Chancen der Wiedervereinigung für unabsehbare Zeit auslöschen und die Spannung zwischen Ost und West verstärken. … In dieser Stunde muss jede Stimme, die sich frei erheben darf, zu einem unüberhörbaren Warnruf vor dieser Entwicklung werden. … Die Verständigung über eine Viermächte-Vereinbarung zur Wiedervereinigung muss vor der militärischen Blockbildung den Vorrang haben.“
Doch die außerparlamentarische Mobilisierung gegen das Vertragspaket änderte nichts an den Mehrheitsverhältnissen in Bonn: Am 27. Februar 1955 stimmte der Bundestag zu. 314 Ja-Stimmen der Regierungsparteien standen gegen 157 Nein-Stimmen, die vorwiegend aus den Reihen der SPD und der KPD kamen. Infolgedessen wurde die Bundesrepublik am 9. Mai 1955 Mitglied der NATO. Fünf Tage später gründeten die Sowjetunion und weitere Staaten Osteuropas den Warschauer Pakt.
Bei der Versammlung in der Paulskirche hielt Ernst Lange die Rede „Die Jugend und die Pariser Verträge“. In ihr heißt es: „Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass ein großer Teil der jungen Generation diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs zur Wiederaufrüstung in West und Ost leidenschaftlich Nein sagt.“ Stattdessen fordert Ernst Lange Verhandlungen zur Wiedervereinigung „hier und heute“. „Wir sagen Nein zu den Pariser Verträgen auch um unserer selbst willen. Wir glauben nicht, dass wir ein Recht haben, heute schon wieder, 10 Jahre nach dem letzten Krieg, Waffen in die Hand zu nehmen. … Wir sehen den alten Ungeist sich jetzt schon wieder unter uns ausbreiten. Wir sehen die alten Gesichter in den Zeitungen und Filmen. Wir lesen die alten Schlagwörter wiederum in den Zeitungen, und wir fragen uns, wie das weitergehen soll, wenn erst wieder Uniformen auf den Straßen sind. Schon heute ist nahezu jede Überzeugung wieder salonfähig, sofern sie nur antikommunistisch ist. … Wir glauben, dass in der Politik der Stärke, in deren Zeichen die beiden Teile Deutschlands gegeneinander wiederbewaffnet werden sollen, in Wahrheit eine Politik der Angst ist. Angst schafft nie echten Frieden. … Man kann der Sache des Friedens und der Freiheit keinen schlechteren Dienst erweisen als auf diesem Weg der Angst und des Misstrauens weiterzugehen.“
„Nehmt den Marxismus ernst!“44 (1955)