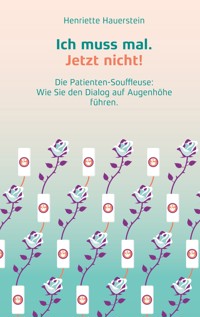
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Henriette Hauerstein wagt einen Blick auf das Wohl und Wehe von Patienten, Pflegebedürftigen und Angehörigen und auf die Professionellen, die in dieser Branche ihre Arbeit tun. Als Insiderin in diesem Bereich zeigt sie Ihnen, wie beide sich begegnen können, damit der Dialog auf Augenhöhe gelingt. Die wahren Geschichten in diesem Buch liefern Ihnen eine wirkungsvolle Medizin - ohne Risiken und Nebenwirkungen! Heilsame Wechselwirkungen hingegen sind erwünscht... Ein kostbarer Ratgeber nicht nur für Patienten und pflegebedürftige Menschen, sondern für Jedermann - ein nützlicher Lesestoff für deren Angehörige - eine hochinteressante Lektüre für Brancheninsider - ein besonderes Lehrbuch für Auszubildende im Gesundheits- und Pflegewesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Teil I
Vorhang auf, es wird ein Blick in Arztpraxen und Krankenhäuser gewagt
1. Tür zu
2. Die tickende Zeitbombe
3. Das Bestellkärtchen und die skrupellosen Zeiträuber
4. Der Schlafanzug verändert uns
5. Nur ein quälendes Pfeifen im Ohr
6. Privat oder gesetzlich?
7. Die Visite im Visier
8. Die viersprossige Leiter
9. Ruhigstellen
10. Auf einen Schlag
Teil II
Vorhang auf, es wird ein Blick in Pflegeheime und ambulante Pflegedienste riskiert
1. Tour 5
2. Die Schneider und die Klingelei
3. Der Fritz vom Bau
4. Ich muss mal. Jetzt nicht!
5. Gemeinschaftsunterbringung lautet der Deal
6. Ihr Danke zählt ein Vielfaches mehr
7. Schöne Momente im Abseits
8. Lügen haben kurze Beine
9. Alte Menschen nerven einfach
10. Die drücken sich die fetten Ärsche platt
11. Ich gehe auf die 70 zu
Teil III
Vorhang auf für einen erweiterten Blick
1. Wovon Sie die Finger unbedingt lassen müssen
2. Ich bin eine Last und komme ins Heim
3. Fehlhandlungen und Ausraster
4. Der Riss im Team – Covid beutelt die Branche
5. Die Pflege-Personal-Debatte
6. Wie alles begann
Glossar
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Vorwort
Die Patienten-Souffleuse »Ich muss mal. Jetzt nicht!« spielt nicht in der Theaterwelt, sondern auf der echten Lebensbühne, auf der Sie sich irgendwann einmal bewegen, sei es als Patient, Pflegebedürftiger oder Angehöriger. Es wird in der für Sie passenden Dosis, der richtigen Lautstärke und mit klaren Worten souffliert, sodass der Dialog auf Augenhöhe, in den Zeiten von Abhängigkeit, funktioniert. Manchmal wird es lauter und die Wirkstoffmenge erhöht, damit es die anderen hören – die, die Sie betreuen. Das ist gewollt! Denn ich wünsche mir sehr, dass viel von diesem Text nach außen in das wahre Leben dringt und eine manierliche Gesprächskultur erwächst.
Ihnen werden wahrhaftige Geschichten offeriert mit Tipps für das Gelingen. Und es wird kritisch über Einwände diskutiert, damit Sie meiner Erlebens- und Gedankenwelt noch besser folgen können. Für die eiligen Leser unter Ihnen, halte ich am Ende jedes Kapitels eine kurze Zusammenfassung bereit.
Sehr wichtig: Fast alle Personennamen sind frei erfunden. Doch die Geschichten selbst sowie die Namen Flora, Luise, Wanda, Eike, Erdmute, Schwester Käthe, Elisabeth und Eva, die sind allerdings echt!
Lesen Sie langsam, lesen Sie schnell, lesen Sie vom Anfang bis zum Ende, lesen Sie jeden Tag ein kleines Stück oder lesen Sie das, was Ihnen auf den ersten Blick am meisten ins Auge sticht, egal wie Sie es tun, das Wichtigste ist: Lesen Sie dieses Buch und erobern Sie das, was für Sie das Richtige ist!
Ihre Henriette Hauerstein
Im ersten Teil des Buches wird der Vorhang gelüftet und ein Einblick in Arztpraxen und Krankenhäuser gewährt. Wie Medizinische Fachangestellte ihren Dienst mit dem Coronavirus jonglieren und ob sie sich erdreisten dürfen, energisch und unfreundlich zu sein. Wie ein netter Vater durch Homeoffice zur tickenden Zeitbombe wird. Wie es sein kann, solange beim Arzt im Wartezimmer zu sitzen, obwohl auf dem Bestellkärtchen eindeutig die Zeit draufsteht. Was der Schlafanzug aus einem Menschen machen kann und wie man seine alte Form zurückgewinnt. Was passiert, wenn Patienten ihre Krankenkassenkarte nicht bei sich tragen, es nicht um Leben und Tod geht, sondern nur um ein quälendes Pfeifen im Ohr. Welchen Unterschied es macht, privat oder gesetzlich versichert zu sein. Warum die Visite im Krankenhaus nicht mit dem Patienten spricht, und wie das mit der Hierarchie der Ärzte im Krankenhaus ist. Warum eine Patientin Geburtsjahr 1929 im Ausnahmezustand ist und sich alle Strippen und Schläuche rausreißt und wie Patienten schlagartig handlungs- und planungsunfähig sind.
Teil I
Vorhang auf, es wird ein Blick in Arztpraxen und Krankenhäuser gewagt
1. Tür zu
Entscheiden Sie, ob Schwester Pia zu energisch und zu unfreundlich ist!
Frühjahr 2020. Die Corona-Pandemie hatte uns damals das erste Mal total im Griff. Das erste Mal ein kompletter Shutdown. Ein Erleben, was völlig neu für alle war, auch für meine Arbeit als Coach. Mein gut gefüllter Kalender war auf einen Schlag leer. Alle Kliententermine waren auf Eis gelegt. Der leibliche Kontakt zu meinen Kunden, der wie das Salz in der Suppe ist, fehlte von jetzt auf gleich. Diese Gesundheitskrise kam nahezu ungebremst auf uns alle zu und verursachte blitzartig wirtschaftlichen und sozialen Stillstand im ganzen Land. Bestimmt können Sie sich daran noch sehr genau erinnern, wie alles begann. Eine Ausnahmesituation: ungewohnt, bedrohlich und ungewiss, und wir alle waren mittendrin.
Seit dem 17. März 2020 gab es zunehmend verschärfte Regelungen, um Covid-19 die Stirn zu bieten. Alle Maßnahmen waren darauf gerichtet, die Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland zu verlangsamen, die Krankenhäuser und intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten nicht kollabieren zu lassen, Schwerstkranke gut zu behandeln und Risikopatienten zu schützen. Abstand halten, mit Maß und Verstand anderen Menschen begegnen, Hände desinfizieren, Hände mit Seife waschen und zweimal Happy Birthday dabei singen, viel öfters frische Handtücher benutzen, Gummihandschuhe anziehen und hygienekonform wechseln und Mund- und Nasenschutz tragen, das stand tagtäglich auf dem Plan.
Viele Menschen wurden in Deutschland in Kurzarbeit geschickt und gingen von heut auf morgen nicht mehr zur Arbeit. Viele Menschen durften arbeiten, nur nicht an ihrem gewohnten Ort, sondern bei denen war Homeoffice angesagt. Diese Menschen mussten rasant schnell lernen, ihren Arbeitstag von zu Hause aus zu organisieren, das kostete Energie und erforderte Flexibilität. Kinder gingen schlagartig nicht mehr in die Kita, in die Schule oder in den Hort. Eltern wurden zu Ersatzlehrern und viel Kraft und Geduld wurde von ihnen abverlangt. »Systemrelevante« Berufe standen an vorderster Front, mitten im Keimgedrängel. Mediziner, medizinisches Fach- und Pflegepersonal und Schwester Pia gehörten dazu.
Es war der 20. April 2020. Ein Vormittag in einer allgemeinärztlichen Doppelpraxis: Die Routinesprechstunde ging nur von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags. Am Nachmittag wurden keine Patienten mehr behandelt, weil Covid-19 das verbot, so hieß es damals.
Schwester Pia war vorbildlich. Sie war schon seit 7.45 Uhr für die Patienten da. Sie managte das Patientenaufkommen so, dass Wartezeiten kurz und Patientenbegegnungen überschaubar waren. Sie saß am Tresen vor einer Plexiglasscheibe, die vor einer Woche noch nicht dort war. Sie trug einen Mund- und Nasenschutz und das Atmen war erschwert. Ihre Tür war geschlossen und die Patienten warteten im Gang. Ein weißer A4-Zettel mit großer schwarzer Schrift wies darauf hin: Halten Sie bitte Abstand und treten Sie einzeln ein!
Das ging eine ganze Weile gut. Ankommende Patienten hielten auf dem Gang den Abstand ein. Sie klopften und betraten erst nach Aufforderung von Schwester Pia das Wartezimmer, schlossen rasch die Tür hinter sich zu und folgten den Anweisungen der Sprechstundenschwester. Diese war sehr genau, passte auf und dirigierte eintretende und gehende Patienten so, dass der notwendige Abstand von mindestens 1,50 m gesichert war. Schwester Pia arbeitete nicht nur für sich so genau, sie machte es auch für ihre Patienten. Sie beherrschte das Hygieneregime wie aus dem Effeff, so schien es auf den ersten Blick. Doch als ein Patient nicht in der von Schwester Pia erwarteten Geschwindigkeit die Tür ins Schloss fallen ließ, sagte sie in einem forschen Ton: »Tür zu!« Sie sagte es einmal, zweimal und dreimal und ihr Ton wurde immer lauter und energischer! Erst nach der dritten Aufforderung gelang es dem Patienten, dem Befehl zu folgen und die Tür zu schließen. Es wurde lauter im Gang. Zwei Wartende empörten sich: »Was fällt der Schwester Pia ein? Kann sie nicht wenigstens bitte sagen und das gefälligst in einem anderen Ton?« Ein dritter Patient in Gummistiefeln brabbelte in seinen Bart: »Wir fahren das Heu hier ein, da kann die Pia schon netter sein!«
Was ich Ihnen dazu sagen möchte: Schwester Pia hat einen schweren Job. Jeden Tag geht sie zum Dienst. Jeden Tag hat sie ein großes Risiko selbst zu erkranken. Die Nerven liegen blank. Trotzdem kümmert sie sich um ihre Patienten schon eine Viertelstunde vor der Zeit. Sie sitzt am Tresen, bedient zwei Ärzte, läuft hin und her. Das Telefon klingelt in einer Tour. Patienten brauchen Termine, einen Krankenschein und das Rezept, am liebsten alles sofort und zugleich. Nett und zugewandt will Schwester Pia sein. Doch die Corona-Angst ist eins zu viel. Alle zerren an ihr, die Patienten vor Ort, die Anrufer, die Ärzte und der unsichtbare Keim.
Es stimmt, die Patienten spielen das Geld für die Arztpraxis ein. Ohne Patienten würden Mediziner und medizinisches Fachpersonal nichts im Geldbeutel haben. Dennoch verzeihen Sie den Ausrutscher in diesem Fall! Bleiben Sie nett! Bringen Sie der Schwester Pia ein: »Entschuldigung bitte, ich war nicht so schnell.« über Ihre Lippen. Ich versichere Ihnen, Sprechstundenschwestern, wie Schwester Pia eine ist, merken recht schnell, dass sie mit ihrer barschen Kommunikation danebenliegen. Ein kurzer Blickkontakt mit einem Lächeln von ihr wird Sie ganz sicher entschädigen. Vielleicht auch ein paar Worte mehr, indem sie Ihnen sagt, wie turbulent und angespannt das Ganze ist. Hören Sie ihr zu und bleiben Sie kulant. Sagen Sie ihr ein Dankeschön für ihren Einsatz Tag für Tag!
Wie könnte jetzt Ihr Einspruch lauten? Sicher gibt es forsches und energisches und wenig empathisches medizinisches Personal am Tresen schon immer, auch ohne der Corona-Gefahr. Deshalb sollten Sie unbedingt mindestens drei Typen von Sprechstundenschwestern, Arzthelferinnen oder Medizinischen Fachangestellten unterscheiden.
1. Die EINEN, lassen Sie mich diese Rezeptionsdrachen nennen, die den Patienten immer und immer wieder ein ungutes Gefühl einflößen. Die Patienten kuschen lassen, wenig Verständnis für die in Sorge und Not geratenen Patienten und Angehörigen aufbringen. Die einen herben Ton am Leibe tragen, als sei es eine Sportart, die sie mit Ausdauer und Leidenschaft betreiben.
2. Die ANDEREN, die sonst recht umgänglich und so wie Schwester Pia sind und nur ab und an neben ihrer professionellen Rolle stehen.
3. Der dritte Typ, das sind die BESONDEREN, die immer den Takt bewahren, deren Verhalten von einer inneren Haltung getragen wird, die dem Menschen zugewandt ist. Denen es wichtig ist, Patienten und Angehörige in ihrer von Krankheit bestimmten Situation zu verstehen, ihnen zuzuhören und mit den passenden Worten und Gesten entgegenzugehen. Die BESONDEREN sind Menschen, die das richtige Maß zwischen Nähe und Distanz blitzschnell finden, sodass Patienten sich geborgen und sicher fühlen. Stehen die BESONDEREN mal so richtig unter Strom und ein Fehltritt passiert, dann zeigen sie eine für Patienten wertvolle Kompetenz. Sie reflektieren und regulieren ihr Verhalten sofort, und können ohne große Überwindung eine Entschuldigung für den Patienten finden. So wird die Spannung ausbalanciert und eine gesunde Beziehung zum Patienten produziert.
Exkurs zu den EINEN – den Rezeptionsdrachen. Bei den Rezeptionsdrachen ist eine Frage besonders interessant, nämlich: Was berechtigt diese Menschen, so zu Patienten zu sein? Was glauben Sie und fallen Ihnen Argumente ein, mit denen dieses Verhalten legitimiert werden kann?
Ich habe ebenfalls darüber nachgedacht und meine Antwort auf diese Frage lautet: Gar nichts! Einfach überhaupt gar nichts, berechtigt die Rezeptionsdrachen so zu sein! Deshalb lohnt es sich, den Rezeptionsdrachen etwas auf die Sprünge zu helfen und mit einem bisschen Glück den Schalter der Selbstreflexion von off auf on zu legen.
Probieren Sie eine der nachfolgenden Varianten aus und glauben Sie mir, hinterher fühlen sich die Begegnungen mit den Rezeptionsdrachen anders, nämlich besser an.
Variante 1: Einen Aha-Effekt initiieren. Sie dürfen den Rezeptionsdrachen mit gutem Gewissen fragen, aus welchem Grund Sie gerade so scharf angesprochen werden. Machen Sie sichtbar, was den Rezeptionsdrachen dazu bewegt, so ungehalten, so streng oder so abweisend zu sein. Fragen Sie: »Was ist passiert, dass ich im Moment so viel Ablehnung oder so viel Strenge spüre?« Oder fragen Sie: »Was hält Sie zurück ›Bitte‹ oder ›Danke‹ zu sagen oder etwas geduldiger mit mir zu sein?«
Das ist Ihr Gewinn dabei: Egal, welche Antwort Sie erhalten:
ob eine Ausrede, welche Sie mit einem Augenzwinkern hinnehmen,
ein Abstreiten, welches Sie souverän wegstecken oder – im besten Falle gar einen Hauch Einsicht, welche Sie mit einem verständnisvollen Blick und einem lieben Wort würdigen,
signalisieren Sie mit Variante 1 dem Rezeptionsdrachen, welche Kultur Sie als Patient pflegen möchten. Im hoffnungsvollsten Falle geht dem Rezeptionsdrachen ein ganzer Kronleuchter auf, der den Weg zur Kommunikation auf Augenhöhe hell erleuchtet. Vielleicht reicht das Licht nicht für alle Patienten, aber für Sie ganz bestimmt.
Variante 2: Ihr Bedürfnis formulieren. Vielleicht sagen Sie zum Rezeptionsdrachen: »Wissen Sie Schwester Iris, mir bekommt der raue Ton nicht gut. Ein Fünkchen Herzlichkeit wäre Balsam für meine Seele.«
Das ist Ihr Gewinn dabei: Für sich sorgen und nur zwei Dinge sagen: Was gefällt mir nicht und was benötige ich, mehr brauchen Sie bei dieser Variante gar nicht tun. Ihre persönliche Klarheit bringt den Rezeptionsdrachen auf Kurs, zumindest, wenn es sich um einen Rezeptionsdrachen handelt, bei dem nicht komplett Hopfen und Malz verloren ist, sondern noch ein Fünkchen Berufsethos und Menschlichkeit im Inneren verborgen ist.
Wissen Sie, was mir augenblicklich durch den Kopf geht? Ich stelle mir gerade Ihren nächsten Arztbesuch und den Kontakt mit einem der Rezeptionsdrachen vor und überlege, was passieren würde, wenn Sie diese Variante einfach einmal ausprobieren und Ihrem Rezeptionsdrachen liebevoll sagen, was gut für Sie ist.
Exkurs zu den ANDEREN – den sonst recht Umgänglichen. Bei den sonst recht Umgänglichen, also denen, die nur manchmal neben der Spur laufen und genervt sind, ist es vielleicht wie bei Schwester Pia, nur eben ohne die Corona-Situation. Vielleicht kämpfen diese Medizinischen Fachangestellten, Sprechstundenschwestern oder Arzthelferinnen mit einem großen Patientenansturm, einer Fülle von Rezepten, Telefonaten, Krankschreibungen, Terminvergaben, Abfragen bei Laboren, Blutentnahmen, Injektionen und Verbänden. Vielleicht tragen sie die Last von zwei Mitarbeitenden auf ihren Schultern, weil jemand aus dem Team sich kurzfristig krankgemeldet hat. Vielleicht quälen sie sich mit fordernden und ungehaltenen Patienten oder Angehörigen herum oder mit einem Chef, der einfach unausstehlich und mit nur sehr wenigen Dingen zufrieden ist. Unabhängig davon, welcher Grund ein unangemessenes Verhalten bei den sonst recht Umgänglichen auslöst, versuchen Sie es mit ehrlichem Interesse an der Person. Fragen Sie beispielsweise so:
»Wie geht es Ihnen heute, Schwester Lena?«
»Wie läuft der Tag bei Ihnen, Schwester Judith?«
»Wie zufrieden sind Sie mit dem heutigen Tag, Schwester Annabell?«
»Frau Keizer, wann werden Sie heute in den Feierabend gehen können?«
»Frau Körner, wie schaffen Sie das, so viele Dinge fast gleichzeitig zu erledigen?«
»Was stresst Sie heute am allermeisten, Schwester Miriam?« oder sagen Sie am Telefon: »Ich habe Geduld – ich bleibe dran.«
Das ist Ihr Gewinn dabei: In den meisten Fällen wird es Ihnen gelingen, mit einer kleinen Prise Einfühlungsvermögen die unterkühlte oder angespannte Atmosphäre aufzulösen und das Eis zu brechen. Diese kleine Prise Einfühlungsvermögen wird Ihnen helfen, nicht wie ein hypnotisiertes Eichhörnchen zu erstarren und im Nachgang ärgerlich zu sein oder wie ein Rumpelstilzchen umher zu hüpfen und sich maßlos über die unfreundliche, sonst umgängliche Medizinische Fachangestellte aufzuregen, sondern gelassen mit dem, was ist, umzugehen.
Handlungsempfehlung für die EINEN und die ANDEREN, wenn Sie felsenfest der Auffassung sind: Es wird sich eh nichts ändern. Diejenigen unter Ihnen, die nicht intervenieren, weil sie überzeugt davon sind, es wird sich eh nichts ändern, egal was man tut, denen rate ich dringendst stillzuhalten und nichts zu tun. Nur rate ich Ihnen eben auch der Fairness halber, die Konsequenz des Nichtstuns anzunehmen und mit den Folgen zu leben und weiterhin in gebückter Patientenhaltung zu verharren. Entscheiden Sie sich für diese Strategie, dann dürfen Sie sich innerhalb und außerhalb der Arztpraxis nicht mehr echauffieren, nicht mehr andere mit dieser Wut und diesem Ärger infizieren und nicht mehr alles dafür tun, Ihren Blutdruck weiter steigen zu lassen. Gelingt Ihnen die Annahme der Folgen Ihrer Passivität im störenden Moment nicht, dann werden Sie den Kürzeren ziehen. Alles bleibt beim Alten, auch die EINEN und die ANDEREN, nur Ihre Verbitterung nicht, denn die wird größer und verhärtet sich.
Das ist Ihr Gewinn dabei: Sie bleiben in gewohnten Mustern, Sie brauchen sich nicht an etwas Neues gewöhnen. Sie müssen nicht nachdenken und auch nicht mutig sein und einem Menschen sagen, was und wie Sie es brauchen. Wenn Sie im gewohnten Fahrwasser weiterschwimmen und die gesamte Situation mit all den Folgen für die Nichtveränderung bedingungslos annehmen und dabei Ihren frohen Mut behalten, dann ist das der richtige Weg für Sie. Wenn nicht, dann wählen Sie unbedingt eine andere Strategie!
Für die eiligen Leser unter Ihnen
Es war der 20. April 2020. Schwester Pia steht im Keimgedrängel, ihre Nerven liegen blank. Aus ihrem Munde tönt energisch: »Tür zu!« – nicht nur einmal oder zweimal, sondern dreimal schmettert sie dem Patienten ihre Gereiztheit frontal ins Gesicht. Sie erfahren nicht nur, warum der kommunikative Fehlgriff passiert, sondern wie Sie eine solch missliche Situationen sofort parieren können. Dabei lernen Sie drei Typen von Medizinischen Fachangestellten kennen und begegnen dabei den EINEN – den Rezeptionsdrachen, den ANDEREN und den BESONDE-REN. Natürlich begreifen Sie auch in Windeseile, wie dieses Personal zu »handhaben« ist.
2. Die tickende Zeitbombe
Wie der kulturvolle Sven Müller bei der Kinderärztin explodiert.
Sven Müllers Zündschnur ist sehr kurz. Das war nicht immer so. Corona hat ihm eine dünne Haut verschafft. Fast zwei Jahre Homeoffice liegen hinter ihm und es sieht so aus, als wenn noch kein Ende naht. Seine Kunden sind international und persönliche Kontakte waren zwar schon immer rar, weil der Austausch über die Entfernungen hinweg mit Videokonferenzen gut abgesichert war. Nur vor der Corona Pandemie fuhr Sven Müller jeden Tag in sein Büro. Dort konnte er ungestört und sehr konzentriert arbeiten und wenn es ihm danach war, traf er sich in den Pausen mit Arbeitskollegen, die immer für ein Späßchen und seinen trockenen Humor zu haben waren. Jetzt sitzt er zu Hause vorm PC, jeden Tag von 8 bis 17 Uhr und manchmal noch eine Schicht danach. Kein Smalltalk mit Kollegen, keine Dienstberatungen im schönen Saal, kein Mittagessen von Gabi der Küchenfee, keine Autofahrt mit guter Musik, sondern zwei Grundschulkinder im Gepäck, die manchmal großen Antrieb haben und manchmal angetrieben werden müssen: Das ist Sven Müllers Alltagsleben jetzt. Auch rappelt es mitunter gewaltig im Karton, weil Fanny (10) Mutti spielt und Nelly (6) das nicht will. Abliefern muss Sven Müller jeden Tag, da beißt die Maus keinen Faden ab, egal wie schön oder wie schwer der Tag verläuft und egal wie viel die Kinder stressen. Sven Müller hält das alles ganz gut aus. Doch als Nelly frühmorgens kaum noch schlucken konnte, vor Schmerzen weinte und hohes Fieber hatte und Sven kurzerhand mit der kranken Maus zur Ärztin fuhr, war bei ihm der Ofen aus. Er wurde weggeschickt, weil seine Nelly da nicht als Patientin in der Kartei gelistet war. Wie auch, er wohnte erst seit kurzem in der Stadt und brauchte bisher nie einen Arzt für die Kinder. Die Medizinische Fachangestellte Frau Kiesel, eine junge Frau, interessierte sich wenig für das kranke Kind und noch viel weniger für die anfangs noch höflichen und salonfähigen Worte des Vaters. Ohne richtig zuzuhören, verwies sie Sven Müller zu einem anderen Arzt, der angeblich wohnortmäßig eher zuständig war. Sie sagte zu ihm in einem kurzangebundenen Ton: »Neue Patienten nehmen wir nicht an. Bei Dr. Schmidt können Sie Ihr Glück versuchen.« Diese eiskalte und aalglatte Sachlichkeit, dieses Gefühl abgefertigt zu werden, dieses Gefühl nicht mehr dazuzugehören, war das Tröpfchen – nein der Wasserstrahl, der das Fass bei Sven Müller zum Überlaufen brachte. Er wurde laut, empfindlich laut und ungerecht. Er sagte verletzende und vorwurfsvolle Worte, die so nicht richtig waren – nicht richtig für Frau Kiesel und auch nicht richtig für die kleine Nelly. Frau Kiesel schoss zurück, sie war gekränkt und nahm den Spielball an. Sie war nicht souverän. Sie zeigte nicht ihre professionelle Seite und es gelang ihr nicht, das Wortgefecht in einen Waffenstillstand zu verwandeln. Im Gegenteil, das Spektakel war so laut und drang bis in das Behandlungszimmer vor, sodass die Kinderärztin zur Hilfe kam. Sie wusste nicht genau, was da geschah und blieb ganz ruhig, weil Nelly mitten im Wortgemetzel war. Sie nahm das Kind an ihre Hand und sagte liebevoll: »Bring den Papa mit – du bist jetzt dran!«
Was ich Ihnen dazu sagen möchte: Gibt es gleiche Pflichten, Regeln und Rechte für Patient und Personal? Ein bisschen JA und ein bisschen NEIN.
Zuerst zum bisschen JA: Wenn eine Begegnung zwischen Menschen gut und ausgewogen verlaufen soll, dann hat sowohl der eine als auch der andere einen nahezu gleichwertigen Beitrag zu leisten. Worin die Gleichwertigkeit besteht, kann situativ und von Person zu Person ganz unterschiedlich sein. Auf den anderen Rücksicht nehmen, den Macken des anderen tolerant begegnen, ohne Vorwurf dem anderen sagen, was stört, Grenzen aufzeigen und in einer Sprache sprechen, die wertschätzend ist, sind elementare Anteile einer gelingenden Kommunikation – einer Verbindung zwischen dem einen und dem anderen, die sich gut anfühlt. Was aber das Allerwichtigste dabei ist, ist eine Grundhaltung, die das Bedürfnis und die Bereitschaft in sich verknüpft, den anderen verstehen zu wollen, mit dem anderen auskommen zu wollen und sich vom anderen etwas sagen zu lassen, ohne dass es gleich als eine Majestätsbeleidigung gewertet wird. Diese Grundhaltung ist der Schlüssel zum Erfolg, sowohl in der Alltagskommunikation als auch im professionellen Bereich. Wenn diese dem Menschen zugewandte Haltung ganz fest mit uns verwurzelt ist, fließen Worte und Handlungen aus uns heraus, die einem selbst und dem anderen eher willkommen sind. Was glauben Sie, wie viel von dieser Haltung haben Sie in sich vereint?
Wo stehen Sie auf einer Skala von 1 bis 10? Bewegen Sie sich schon im oberen Bereich bei sieben, acht, neun oder gar zehn? Wenn ja, dann bleiben Sie dran und behüten Sie das!
Wenn nein, dann fangen Sie an und werfen die Negativlast über Bord. Beginnen Sie stärker das Positive, das Gute, die Stärken bei Menschen zu sehen. Stürzen Sie sich nicht sofort auf das, was Ihnen missfällt. Selbst dann, wenn sich bei Ihnen diese defizitäre Sichtweise ganz automatisch einstellt, ohne bewusst etwas dazu zu tun, registrieren Sie das Verhalten und bieten Sie diesem Muster die Stirn. Lernen Sie, mit dem Auge des Gelingens zu sehen. Trainieren Sie Ihre Sehkraft und schärfen Sie Ihren Blick für das, was im Moment noch verschwommen ist und nur zarte Konturen des Positiven, des Faszinierenden und des Bemerkenswerten erblicken lässt. Wenn diese Bilder klarer werden, dann sehen Sie die Menschen in einem anderen Licht – in einem Licht, welches Sie auf neue Denkweisen bringt. Sie können beide Seiten der Medaille sehen, das Gute und das, was in Ihren Augen weniger perfekt bei diesem Menschen erscheint. Schon, wenn Sie nur zwei Seiten betrachten, weitet sich Ihr Horizont. Sie entdecken mehr und können entscheiden, was Sie in die Plus- und in die Minus-Waagschale tun. So gelingt es Ihnen, die Beziehung zum anderen unbefangener und achtsamer zu tarieren. Ist Ihr Blick jedoch nur auf das Nervende und auf das Verwerfliche gelenkt, dann wissen Sie selbst am besten, in welche Richtung sich die Waage Ihrer Wahrnehmung hin schwenkt. Ihnen ist bekannt, wie problembeladen dann die Kommunikation abläuft und welche gravierenden Kerben in die Beziehung zum anderen eingeschlagen werden. Deshalb probieren Sie es unbedingt so oft wie möglich aus, mindestens zwei Seiten der Medaille aufzuspüren.
Ihr Gewinn für diese Sicht: Es lohnt sich sehr, denn Sie verschaffen sich mit dieser Doppelsicht ein solides Handlungsrepertoire, was Sie nicht nur beim Ärger mit Menschen erfolgreich weiterbringt.
Nun zu dem bisschen NEIN: Gibt es gleiche Pflichten, Regeln und Rechte für Patienten und das Personal? Meine Überzeugung ist, beruflich in einer Arztpraxis Beschäftigte brauchen mehr Knowhow in puncto Kommunikation. Sie haben eine größere Verantwortung, besonders in angespannten Situationen bewusst das Gebührende und das Geeignete zu tun. Daher reichen hier alltagspsychologische Erkenntnisse und Erfahrungen bei weitem nicht aus. Menschen, die beruflich mit Menschen in Verbindung stehen, die von beunruhigenden, beängstigenden und gar bedrohlichen Ereignissen umzingelt sind, sind verpflichtet, diese besonderen Zustände emotionaler Anspannung zu erkennen und ihr Kommunikationsgeschick nach professionellen Regeln auszurichten. Dabei steht die von Carl Rogers postulierte Grundhaltung für eine positive Kommunikation, die auf Annahme, Wertschätzung, Empathie und Echtheit basiert, ganz oben auf der Handlungsliste, gefolgt von einem wohlgefüllten Methodenkoffer mit kommunikativem Handwerkszeug zur Gestaltung einer auf Augenhöhe ausgerichteten Beziehung zum Patienten. Das, was ich hier in einem Satz aufgeschrieben habe, klingt nicht viel. Es ist allerdings eine ganze Menge. Aber selbst, wenn Frau Kiesel nur ein winzig kleines Puzzleteil daraus verwendet hätte, dann wäre der sonst kulturvolle Sven Müller nicht explodiert.
Was hätte Frau Kiesel vorsorglich tun können, wenn die Kinderarztpraxis mit Patienten überfüllt ist und nur die eine Option besteht, neue Patienten an einen anderen Arzt zu verweisen?
Prophylaxe betreiben. Sie hätte mit etwas Feingefühl sich vorstellen können, wie es abgewiesenen Patienten ergeht. Mit dieser Antizipation, der Vorwegnahme von Gedanken und Gefühlen, wie sie beispielsweise in Sven Müllers Situation entstehen, wäre sie gut vorbereitet gewesen. Ihr wären ganz bestimmt gleich zu Beginn die passenden Worte eingefallen. Vielleicht so: »Herr Müller, ich kann gut verstehen, dass Sie unsere Hilfe benötigen, nur sind wir überfüllt. Deshalb gebe ich Ihnen eine Adresse eines anderen Kinderarztes. Der hat einen guten Ruf und ich weiß von ihm, dass er noch neue kleine Patienten aufnimmt. Und noch etwas, Dr. Schmidt hat seine Praxis nicht weit von Ihrem Wohnort entfernt, vielleicht ist das für die Zukunft ganz komfortabel für Sie.« Sven Müller hätte bestimmt genickt und danke gesagt, weil es einleuchtend für ihn gewesen wäre und weil er sich in seiner Not gut aufgehoben gefühlt hätte und nicht abgeschoben, nicht eiskalt abserviert, so wie es in Tatsache vonstatten ging.
Sich fortbilden. Zwar lernen Medizinische Fachangestellte zu einem gewissen Teil in ihrer Berufsausbildung das, was ich hier mit der Grundhaltung für positive Kommunikation und dem Methodenkoffer meine, nur reicht das in der Praxis oft nicht aus. Es ist ein ständiger Prozess, sich intensiv und reflektiert mit den Fragen sozialer Interaktion und Kommunikation fallbezogen auseinanderzusetzen. Es ist mindesten genauso bedeutungsvoll, wie das aktuelle Abrechnungssystem oder medizinische Fachwörter zu kennen.
Für die eiligen Leser unter Ihnen
»Die tickende Zeitbombe« ist eine gute Medizin zur Reflexion für Menschen, deren Haut dünn geworden ist und für Praxispersonal, das Nachholbedarf in puncto Kommunikationsgeschick und Kommunikationssensibilität feststellt.
Haben die Patienten und das Personal die gleichen Rechte und Pflichten, Kommunikationsregeln einzuhalten? Ein bisschen JA und ein bisschen NEIN, meine ich. Meine Begründung dazu steht in diesem Text. Außerdem lesen Sie hier, warum es sich lohnt, die Sehkraft des Gelingens zu trainieren.
3. Das Bestellkärtchen und die skrupellosen Zeiträuber
Wie es sein kann, solange beim Arzt im Wartezimmer zu sitzen, obwohl auf dem Bestellkärtchen eindeutig die Zeit draufsteht und Sie pünktlich sind.
Hand aufs Herz, wie oft waren Sie auf der Palme, weil Sie viel Zeit im Wartezimmer verbringen mussten, obwohl Sie ein bestellter Patient waren? Ich vermute, Ihre Antworten fallen ganz unterschiedlich aus. Vielleicht reichen Sie von: Es ist schon okay, es geht so, bis hin zu – einfach eine bodenlose Zumutung!
Wenn Sie im Internet stöbern, welche Wartezeiten rechtlich angemessen sind, dann finden Sie dort eine Angabe von ca. 30 Minuten. Es gibt statistische Erhebungen über das Warten auf den Arzt. Allerdings möchte ich hier auf derartige Zahlen verzichten, weil es mir nicht um einen Durchschnittswert des Wartens von gesetzlich oder privat Versicherten geht. Auch geht es mir nicht darum, wie viele Patienten bis zu einer halben oder bis zu zwei, drei oder gar vier Stunden gewartet haben. Mir geht es vielmehr darum, dem skrupellosen Zeitraub Paroli zu bieten und der Zeit auf dem Bestellkärtchen zweiseitige Verbindlichkeit zu geben.
Wozu sind Termine da? Ist es denn nicht so, dass Termine uns helfen, Abläufe zu strukturieren, einen Plan zu haben, um das private und berufliche Tageswerk gut zu schaffen?
In der Schule. Nehmen wir uns als erstes die Schule und die dort gültigen Zeitvorgaben vor. Meine Enkel sind angehalten, 7.30 Uhr in der Grundschule zu sein und zügig ins Klassenzimmer zu gehen. Bis zum Vorklingeln um 7.40 Uhr müssen ihre Arbeitsmaterialien gerichtet sein und pünktlich um 7.45 Uhr müssen sie in den Bänken sitzen. Lehrer müssen pünktlich zum Stundenklingeln im Klassenzimmer stehen und den Lernprozess der Kinder und Jugendlichen in Gang bringen. Kompetente Pädagogen meistern die nicht 100-prozentig sichere Vorausschau des Stundenverlaufs und agieren flexibel im Spannungsfeld von Lernzielen und individuellen Lernverhalten ihrer Schüler. Diesen fachlich versierten Lehrkräften gelingt es nach 45 Minuten oder einer Doppelstunde, den Stundenabschluss mit guter pädagogischer Qualität zu gestalten. Dann folgt die erste Pause und danach geht es planmäßig mit der nächsten Lerneinheit weiter, so wie es im Stundenplan steht. Stellen Sie sich bitte einmal vor, was passieren würde, wenn der Lehrer oder meine Enkel oder andere Kinder nicht 7.45 Uhr pünktlich am Start wären oder die wohlverdiente Pause weggelassen wird und das nicht nur einmal, sondern immer wieder und immer wieder. Der Protest wäre groß! Schulleiter würden die Lehrer tadeln, Lehrer würden mit rot ins Hausaufgabenheft einen fetten Eintrag niederschreiben, Eltern würden zum Gespräch eingeladen werden und Schüler würden sich lautstark die Pause einfordern oder in den größeren Klassen einfach den Unterrichtsraumverlassen.Eltern würden auf die Barrikaden gehen, wenn ihre Schützlinge nicht im vollen zeitlichen Umfang lernen könnten, keine Pausen hätten oder ständig eine Stunde über die Zeit nach Hause kämen.
Im Friseursalon. Schauen Sie mit mir in eine weitere Branche und der Bedeutung von Terminvorgaben. Jeder von uns geht irgendwann einmal zum Friseur. Diejenigen unter uns, die einen Friseurtermin haben, müssen heutzutage nur wenige Minuten warten, bis ihnen der Kopf gewaschen, die Haare geschnitten und die Locken gelegt werden. Überlegen Sie bitte, was würden Sie tun, wenn Sie um 15 Uhr beim Friseur bestellt sind und erst 16.15 Uhr der lauwarme Wasserstrahl Ihre Kopfhaut benetzt und diese Zeitverzögerung keine Eintagsfliege ist?
In der Fortbildung. Oder was glauben Sie, würde passieren, wenn ein Dozent seine Fortbildungsteilnehmer immer wieder eine halbe Stunde und länger auf sich warten ließe? Hätte dieser Dozent eine Chance auf dem Bildungsmarkt?
In diesem Zusammenhang stellt sich mir die Frage: Hat das Einhalten von Terminen und vorgegebenen Zeiten in der Schule, beim Friseur, bei der Fort- und Weiterbildung oder beim Arzt die gleiche Funktion? Grundsätzlich ja, weil Lehrer und Schüler, Friseure und Kunden, Dozenten und Fortbildungsteilnehmer, Ärzte und Patienten durch die zeitliche Taktung ihr Tagesgeschäft planen und gut absolvieren können. In der Schule wachen der Schulleiter und die Lehrer über die Pünktlichkeit. Beim Friseur achten der Chef und die Friseure auf zufriedene Kunden. Bei der Fortbildung sucht die Firma zuverlässige Dozenten für seine Mitarbeiter aus.
Nur, was passiert in der Arztpraxis? Dort wird als erstes gleich einmal vorgebeugt. In den meisten Wartezimmern hängt ein Hinweisschild, das sinngemäß so lautet: Bitte haben Sie Verständnis, wenn aufgrund medizinischer Indikation das Aufrufen der Patienten nicht nach dem zeitlichen Erscheinen der Patienten erfolgt. Damit werden wir sofort gebrieft und auf Zeitabweichungen eingestimmt und zum solidarischen Verhalten anderen Patienten gegenüber aufgerufen, obwohl wir diese gar nicht kennen und auch nicht wissen, in welcher Not sie sich befinden. Dennoch vertrauen wir blind dem medizinischen Personal der Arztpraxis. Ich denke an dieser Stelle, dass dieser Vertrauensvorschuss gut und richtig und die damit verbundene Terminverschiebung erlaubt ist, denn jeder kann einmal in einer solchen Situation sein und dann sind wir froh, dass die Aufrufreihenfolge abgewandelt wurde. Bestimmt tolerieren auch viele Patienten eine 30-minütige Wartezeit, weil eben nicht jedes Anliegen des Patienten minutiös getaktet sein kann. Jeder von uns ist daran interessiert, wenn einem im Behandlungszimmer zugehört wird und genügend Zeit für Fragen ist. Für kranke Menschen ist es wohltuend, sich in einer schützenden und umsorgenden Hand zu befinden und nicht das Gefühl des abgefertigt Werdens in den Gliedern zu spüren. Dennoch räumen Patienten mit dieser halben Stunde Wartezeit dem Arzt bereits einen luxuriösen Spielraum ein, den wir anderen Branchen mit einem Bestellsystem, einer zeitlichen Taktung oder einem Stundenplan, nicht so ohne weiteres geben würden. Von den Kindern, den Lehrern, den Friseuren oder dem Dozenten verlangen wir, ihre Arbeitsabläufe im Griff zu haben und nur Termine zu vergeben oder zeitliche Abläufe zu erstellen, die nahezu präzise eingehalten werden.
Ehrbare Zeitwächter. Warum funktioniert diese Termintreue nicht auch in einer Arztpraxis? Wissen Sie, was das Erfreuliche an meiner Frage ist? Ich kann sie mit positiven Ergebnissen belegen, denn es existieren in Deutschland eine Reihe von Arztpraxen, die über ein ausgezeichnetes Terminmanagement verfügen. Diese Arztpraxen haben sich ernsthaft damit beschäftigt, welche Patienten zu ihnen kommen. Sie haben beispielsweise analysiert, wie viel Zeit ein Hautkrebsscreening, ein Gesundheitsscheck, ein EKG oder eine 85-jährige Patientin zum Ausziehen ihrer Bluse, der Strickjacke, der Strumpfhose und der dicken Wollsocken benötigt. Diese Arztpraxen haben geprüft, zu welchen Jahreszeiten, an welchen Tagen und zu welchen Tageszeiten besonders viele Akutfälle in die Praxis kommen. Diese Praxen kennen ihre Großkampftage, an denen besonders viele unbestellte Patienten in die Sprechstunde kommen. Sie wissen, an welchen Tagen in der Stadt Markttag ist und Patienten vom Lande den Einkauf mit einem Arztbesuch verbinden. Diese Praxen sehen nicht nur sich und ihren wirtschaftlichen Gewinn, sondern auch die Bedürfnisse ihrer Patienten. Für Ärzte und das Sprechstundenpersonal wird mit einem klugen Bestellsystem die Arbeitsbelastung optimiert, Pausenzeiten und ein pünktlicher Feierabend ermöglicht. Patienten dieser Arztpraxen warten nicht länger als eine halbe Stunde auf den Arzt. Wenn dieser Zeitrahmen doch einmal überzogen werden muss, weil ein Notfall dazwischen kam oder die Behandlung aus wichtigem Grund mehr Zeit in Anspruch nahm, dann erfahren die Patienten durch das Praxispersonal unaufgefordert, dass es diesmal etwas länger dauert als sonst. Für die meisten Patienten ist diese Zeitverschiebung dann kein Grund zur Beschwerde. Sie ahnen, was das Geheimrezept dieser Arztpraxen ist? Eine Begegnung auf Augenhöhe und eine Kommunikationskultur, wo Patienten Partner sind. Mit dieser Haltung werden diese Ärzte nicht zu skrupellosen Zeiträubern, sondern zu seriösen Zeitwächtern – für sich, für die Patienten und das Personal.
Denkanstöße. Und dennoch existieren diese rücksichtslosen Zeiträuber. Noch viel zu viele Arztpraxen rauben heute bestellten Patienten wichtige Lebenszeit durch das Warten auf den Arzt. Welche Motive dahinterstecken, weiß ich nicht punktgenau. Aber vielleicht regen nachfolgende Fragen zum Denken und Verändern an? Ich würde es den lange wartenden Patienten sehr wünschen!
Wird im Medizinstudium zu wenig Wert auf eine gute Praxisorganisation im Sinne von zufriedenen Mitarbeitern und Patienten gelegt, sodass dieses Thema nur eine untergeordnete Rolle bei praktizierenden Medizinern spielt?
Ist es dem Arzt egal, wie lange Patienten auf ihn warten, denn schließlich will ja der Patient etwas vom Arzt und nicht umgekehrt?
Wenn es dem Arzt nicht egal ist, dass die Wartezeiten lang sind, warum ändert er nichts daran?
Ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass Patienten zu warten haben?
Ist die Medizin ein Lebensbereich, wo andere Spielregeln gelten? Wenn ja, welche Argumente sprechen dafür und welche dagegen?
Weiß der Arzt überhaupt, dass Patienten 90 Minuten auf ihn gewartet und sie dadurch einen wichtigen Anschlusstermin sausen gelassen haben? Oder wenn sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren und den nächsten Bus verpasst haben?
Weiß der Arzt, dass dem Patienten die lange Wartezeit viel Kraft gekostet hat? Der Patient Schmerzen ertragen musste, nicht mehr auf den unbequemen Stühlen sitzen konnte und er am liebsten nach Hause gegangen wäre, wenn da nicht die Notwendigkeit eines Rezeptes, einer Untersuchung oder einer Krankschreibung gewesen wäre?
Oder kennt der Mediziner die Beschwerde, den Ärger, die Wut oder das Unverständnis über die einseitige Verbindlichkeit der Zeiten auf dem Bestellkärtchen überhaupt? Und wenn er das alles weiß, warum unternimmt er nichts, sondern ist erhaben darüber und maßt sich an, mit der Zeit anderer Leute so achtlos umzugehen?
Was ich Ihnen dazu sagen möchte: Suchen Sie sich Ärzte, denen Sie wichtig sind und nicht nur Ihre Krankheit. Dazu gehört auch ein funktionierendes Bestellsystem, wie eine gute fachliche Expertise, ein zugewandtes Sprechstundenteam und eine große Portion Menschlichkeit. Wenn Sie das Gefühl haben, dass lange Wartezeiten zu oft vorkommen und Sie nicht sicher sind, ob Ihr behandelnder Arzt sich dessen bewusst ist, dann sprechen Sie mit ihm darüber. Sagen Sie ihm, in welche Schwierigkeiten Sie geraten. Welche wichtigen Termine Sie versäumt haben. Welcher Aufwand aufgrund der langen Wartezeiten beispielsweise mit der Unterbringung Ihrer Kinder oder zu betreuender Angehörigen verbunden sind. Reden Sie darüber, wie anstrengend das Warten war. Sagen Sie auch, welche Erwartungen Sie an die Vergabe und Einhaltung von Terminen haben. Stellen Sie einen Vergleich zu Ihrer Arbeit und Ihrem Verantwortungsbereich hinsichtlich von Pünktlichkeit und Termintreue her. Sagen Sie, welche Folgen in Ihrem Beruf nichteingehaltene Termine auslösen. Nur dann, wenn Sie darüber sprechen; nur dann, wenn Sie Anschaulichkeit erzeugen; nur dann, wenn Sie mit Nachdruck das Thema der langen Wartezeiten benennen, kann von Ärzten begriffen werden und Normalität in diese vermeintlich allmächtige Welt der Weißkittel Einzug halten. Damit das gelingt, regen Sie sich nicht im Wartezimmer sinnlos auf oder beschimpfen am Tresen das Praxispersonal, sondern bleiben Sie höflich und sachlich am Dilemma dran und das bitte im Sprechzimmer des Arztes.
Emotionalität schlägt Rationalität. Denken Sie daran, wenn Sie vor Ärger ganz oben auf der Palme sind, dann hört das Gehirn auf zu denken und Ihre negativen Emotionen bekommen freien Lauf. Das ist gefährlich, weil mit den dann folgenden Worten kaum ein Arzt und auch das Sprechstundenpersonal nicht zu beeindrucken ist. Im Gegenteil: Sie bekommen eine Abfuhr, die sich gewaschen hat. Denn schließlich wollen Ärzte nur Ihr Bestes, sie arbeiten viel, ihre Verantwortung ist hoch und wenn dann noch unsachliche Kritik geäußert wird, ist mit Heilkundigen nicht gut Kirschen essen, glauben Sie mir! Deshalb sprechen Sie erst, wenn sich Ihre Betriebstemperatur im Normalbereich eingepegelt hat, Sie wieder klar denken und sinnstiftende Sätze über Ihre Lippen bringen können.
Ein letzter Tipp. Trennen Sie sich von einem Arzt, dem es egal ist, wie lange Patienten warten müssen. Diese Ärzte erheben sich über Sie und regieren über Ihre Lebenszeit. Bestimmt ist eine solche Entscheidung nicht ganz leicht und noch schwieriger wird sie, wenn dieser Arzt einer fachlichen Koryphäe gleicht. Hier sollten Sie abwägen, was Ihnen wichtiger ist: eine hohe fachliche Expertise und eine Niete als Mensch oder ein wertschätzender Umgang mit Ihnen als Patient. Ich habe einmal in meinem bisherigen Leben eine solche Entscheidung getroffen und konnte mir anfangs nicht vorstellen, dass es noch weitere Experten des Faches gibt. Aber glauben Sie mir, es gibt sie und oft haben die etwas Leiseren die ausgereifteren Qualitäten als Mensch.
Für die eiligen Leser unter Ihnen
»Das Bestellkärtchen und die skrupellosen Zeiträuber«, hier diskutiere ich kritisch und direkt das, was sich manche Ärzte im Umgang mit unserer Zeit als Patienten anmaßen. Ich beleuchte, warum Termine wichtig sind. Sie finden schnell heraus, dass Sie anderen Branchen gegenüber bei weitem nicht so tolerant in Hinsicht auf (Un-) Pünktlichkeit sind. Das wird Sie motivieren, für weniger Wartezeit beim Arzt nach Ihrer Fasson zu intervenieren.





























