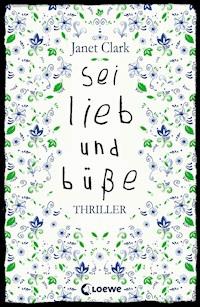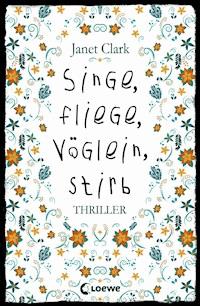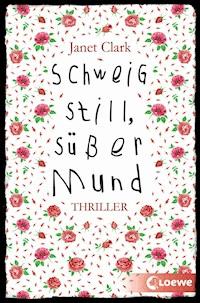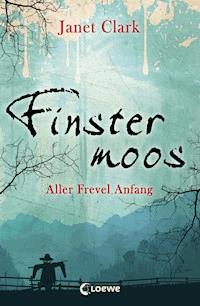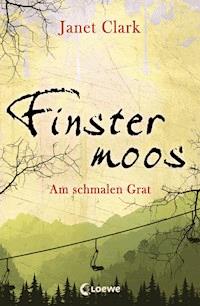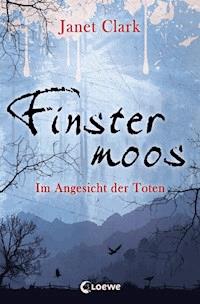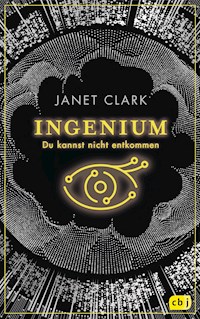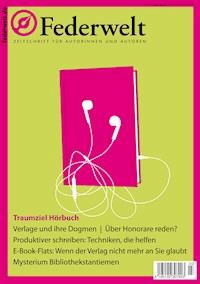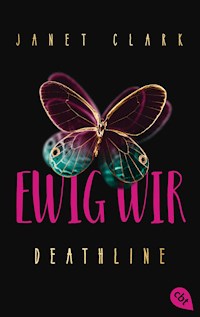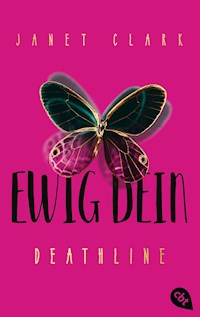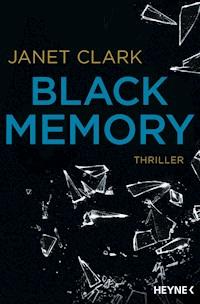Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Die größte Gefahr lauert in deinem eigenen Zuhause: Der packende Psychothriller »Ich sehe dich« von Janet Clark jetzt als eBook bei dotbooks. Während die junge Journalistin Sara in einer unglücklichen Beziehung gefangen ist, scheint ihre Schwester Tini die perfekte Ehe zu führen. Doch als ihr Mann plötzlich tot aufgefunden und Tini zur Hauptverdächtigen wird, scheint ein hässliches Geheimnis ans Licht zu kommen: Hat Paul sie geschlagen? Überzeugt von Tinis Unschuld, beginnt Sara zu recherchieren – und stößt auf ein anonymes Online-Forum für misshandelte Frauen, angeführt von der mysteriösen »Valeska«. Was für eine Verbindung hatte Tini zu dieser Gruppe … und wie weit würden ihre Mitglieder gehen, um sich von ihren brutalen Männern zu befreien? Entschlossen, die Wahrheit herauszufinden, schleust sich Sara bei den Frauen ein – nicht ahnend, dass sie so bald selbst zur Zielscheibe wird … »Janet Clark hat mit ihrem Debüt einen spannenden Psychothriller über die Abgründe der Liebe, Schweigen und Angst in Beziehungen geschrieben.« TV extra Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Thriller »Ich sehe dich« von Janet Clark wird alle Fans der Bestseller von Joy Fielding und Mary Higgins Clark begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Während die junge Journalistin Sara in einer unglücklichen Beziehung gefangen ist, scheint ihre Schwester Tini die perfekte Ehe zu führen. Doch als ihr Mann plötzlich tot aufgefunden und Tini zur Hauptverdächtigen wird, scheint ein hässliches Geheimnis ans Licht zu kommen: Hat Paul sie geschlagen? Überzeugt von Tinis Unschuld, beginnt Sara zu recherchieren – und stößt auf ein anonymes Online-Forum für misshandelte Frauen, angeführt von der mysteriösen »Valeska«. Was für eine Verbindung hatte Tini zu dieser Gruppe … und wie weit würden ihre Mitglieder gehen, um sich von ihren brutalen Männern zu befreien? Entschlossen, die Wahrheit herauszufinden, schleust sich Sara bei den Frauen ein – nicht ahnend, dass sie so bald selbst zur Zielscheibe wird …
»Janet Clark hat mit ihrem Debüt einen spannenden Psychothriller über die Abgründe der Liebe, Schweigen und Angst in Beziehungen geschrieben.« TV extra
Über die Autorin:
Janet Clark arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin, Dozentin und Marketingchefin in Belgien, England und Deutschland, bevor sie sich ganz ihrer Leidenschaft, dem Schreiben, widmete. Sie lebt mit ihrer Familie in München und engagiert sich für AutorInnenrechte.
Die Website der Autorin: janet-clark.de/
Die Autorin auf Instagram: instagram.com/janetclarkautorin/
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre Thriller »Ich sehe dich«, »Black Memory« und »Rachekind«.
***
eBook-Neuausgabe August 2023
Copyright © der Originalausgabe 2011 by Janet Clark
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Covergestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-804-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Ich sehe dich«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Janet Clark
Ich sehe dich
Thriller
dotbooks.
Meiner Mutter in Liebe und Dankbarkeit
Das grelle Rot des Fruchtmantels schreit mir seine Warnung ins Gesicht. Doch ich sehe nur die winzigen Samen und das neue, bessere Leben, das sie mir versprechen.
Immer wieder drücke ich meine Fingernägel in das weiche Fleisch der Eibenfrucht, pule die dunkelbraunen Samen heraus und lege sie auf ein Holzbrettchen. Die Hüllen werfe ich in den Abfall, wo sie sich mit den noch feuchten Kartoffelschalen vermischen. Das Häufchen Samen zerstoße ich mit dem Mörser aus Stein, bis nur noch ein Pulver übrig ist, das auf der klebrigen Kuppe meines Zeigefingers einen schmutzigen Film hinterlässt.
Seine Hand auf meiner Schulter jagt eine Hitzewelle durch meinen Körper. Ich weiß nicht, wie lange er schon hinter mir steht, und wage kaum zu atmen, fürchte, dass er das Rasen meines Herzens bemerkt.
»Was machst du?«
»Curry.« Ich schiebe mit zitternder Hand das Brettchen von mir weg.
»Curry?« Er tritt neben mich, packt mein Kinn und zwingt mich, ihn anzusehen. Sein Atem riecht nach Schnaps. Sein Blick ist misstrauisch. »Du hast noch nie indisch gekocht.«
»Du tust mir weh.«
Er lässt mich los, doch er fixiert mich, als wolle er meine Gedanken lesen.
»Du lügst.«
Ich tunke einen Löffel in die brodelnde Soße, führe ihn an meinen Mund, probiere und reiche ihn dann weiter. Meine Hand ist ruhig. Meine Stimme fest.
»Noch etwas Würze, was meinst du?« Ohne auf seine Antwort zu warten, nehme ich das Brettchen und ein Messer, gebe das tödliche Pulver hinzu und rühre es langsam in seine Lieblingsspeise ein.
»Du kannst nicht indisch kochen.«
Schokobraune Pulverfäden durchziehen die Oberfläche wie das Farbspiel eines Kreisels und verschmelzen unaufhaltsam mit dem gelblichen Grundton.
»Ich hatte nie die richtigen Zutaten.«
»Du wolltest nie.«
Ich drehe die Temperatur herunter und ziehe den Holzlöffel aus dem Curry. Die Oberfläche glättet sich und bedeckt mein Geheimnis.
»Ich wollte dir eine Freude machen.«
Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie er sich von mir ab- und dem Kühlschrank zuwendet. Gleich wird er einen Schritt machen. Zögernd. Dann noch einen. Die Tür öffnen, vorsichtig, damit die Flaschen nicht klirren, ein Bier herausnehmen, mit dem Feuerzeug den Kronkorken wegschnippen und einen großen Schluck aus der Flasche nehmen.
Da. Das Plopp. Das leise Klirren des Metalls auf den Küchenfliesen. Schlucken. Stumm zähle ich bis fünf. Dann drehe ich mich zu ihm um. Mit dem Handrücken wischt er sich über die bierfeuchten Lippen.
»Sind Kartoffeln drin?«
»Und Hühnerbrust. Freust du dich?«
Mit einem Schulterzucken schlurft er aus der Küche. Im Türrahmen bleibt er stehen.
»Ich hätte mir eh ein Curry geholt.«
Ich lächle ihn an. »Ich weiß.«
Sonntag, 7. Dezember
Kapitel 1
Die junge Frau stand reglos vor dem Grab.
Er beobachtete, wie ihre Lippen sich bewegten, ein stummes Zwiegespräch, an dessen Ende sie vor dem Grabstein in die Hocke ging und vorsichtig darüberwischte, so als streichelte sie den Stein. Beim Anblick der zärtlichen Geste zuckte er zusammen. Er sah, wie sie vier Rosen auf das Grab legte, dunkelrote Blüten im Weiß des Schnees, und hörte das Rauschen in seinen Adern, das sich zu einem Brausen steigerte und schließlich wild in seinen Schläfen pochte.
Das hätte mein Grab sein können. Aber mir würde sie keine Rosen bringen.
Er ballte seine Hände zu Fäusten. Sein Puls beschleunigte sich, die Fingernägel gruben sich tief in seine Haut. Er fühlte den Schmerz und verstärkte den Druck.
Plötzlich bemerkte er den Mann neben sich.
»Alles in Ordnung?« Die Hand des Mannes schwebte über seinem Arm, berührte ihn aber nicht. Erst jetzt hörte er sein eigenes Keuchen.
Ohne dem Mann zu antworten, wandte er sich ab und lief zum Ausgang. Die Abenddämmerung über der Stadt tauchte die Fußgänger in geheimnisvolles Licht, das sie mit ihren eigenen Schatten verschmelzen ließ.
Verdammt, was ist nur los mit dir, wie kannst du dich so gehenlassen? Willst du alles ruinieren? Hast du vergessen, was sie dir angetan hat?
Er hatte es nicht vergessen. Fünf Jahre und vier Monate lang hatte er es nicht vergessen. Eintausendneunhundert und einunddreißig Tage. Er legte die rechte Hand über die linke und drückte mit dem Daumen einen Finger nach dem anderen nach unten, bis er das leise Knacken des Gelenkes vernahm.
Kapitel 2
Lydia spürte, wie die Nässe durch ihre Hose kroch. Trotzdem verharrte sie in der gleichen Position, die Knie auf dem grauen Stein, den Oberkörper nach vorne gebeugt. Vorsichtig, als befreie sie uralte Knochen von feinem Wüstensand, wischte sie den Schnee von den kupferfarbenen Buchstaben, bis die Inschrift vollständig zu lesen war. Dann nahm sie die Rosen, die sie auf dem Stein abgelegt hatte, und platzierte sie sorgfältig unterhalb der Inschrift.
Anina 28 * Lucca 8 * Neni 6 * Nora 5
Die Sonne ging unter, bevor es Abend wurde.
»Ach Anina, warum hast du nicht auf mich gehört? Wir hätten zusammen neu angefangen, weit weg von hier.« Sie öffnete ihren Rucksack und holte eine Grabkerze heraus. »Wen hätte es gekümmert? Mich nicht. Ich wollte eh nicht in München bleiben.«
Sie legte die Kerze auf ihrem Schoß ab und griff wieder in den Rucksack. »Wir hätten in Berlin eine neue Gruppe gründen können. Oder in Hamburg. Oder ... ach egal, irgendwo, wo er dich nicht gefunden ... wo er euch nicht gefunden hätte.«
Die dritte und vierte Kerze stellte sie aufrecht in den Schnee, dann nahm sie eine Schachtel Zündhölzer, holte eins heraus und fuhr damit an der Reibefläche entlang. Das dünne Hölzchen entflammte kurz und erlosch, bevor sie es in die Nähe der Kerzen bringen konnte. Sie versuchte es wieder und wieder, doch kaum bewegte sie das Streichholz, flackerte die Flamme und ging aus. Mit einem unwilligen Laut warf sie die Schachtel in den Schnee und begann, ihren Rucksack nach einem Feuerzeug zu durchwühlen.
»Du könntest jetzt hier sein! Du und dein dämlicher Dickschädel. Weißt du eigentlich, was du mir abverlangst? Oder wie oft ich alles hinschmeißen will? Einfach hier weg und abhauen.« Ungestüm riss sie am Reißverschluss der äußeren Tasche. »Weißt du, wie oft ich mich frage, ob ich das Richtige tue? Du hättest natürlich keine Zweifel, du würdest mich auslachen, nein, du würdest mir die Leviten lesen, weil ich an unserer Sache zweifle.«
Mit der rechten Hand zog sie ein Feuerzeug aus dem Rucksackfach. Dann flüsterte sie kaum hörbar: »... und wahrscheinlich hättest du sogar Recht. Aber was hilft mir das?«
Sie nahm die Kerzen hoch, eine nach der anderen, hielt sie schräg und zündete sie an. Die Flamme des Feuerzeugs wehte nach hinten und versengte die Haut an ihrem Daumen. Lydia ließ das Feuerzeug fallen und tauchte die Hand in den Schnee, spürte, wie die kalten Kristalle um ihren Finger herum schmolzen und den Schmerz betäubten.
Dann platzierte sie die leuchtenden Grablichter sorgfältig über den Namen. »Ihr seid nicht umsonst gestorben. Das verspreche ich dir.«
Kapitel 3
Ziellos schlenderte er die Straße entlang, bis zum Nymphenburger Kanal, dessen schnurgerader Verlauf ihn immer wieder aufs Neue faszinierte. Dort blieb er, wie so oft, stehen und verlor sich in der Betrachtung der geraden Linie des künstlichen Gewässers, das auf seiner gesamten Länge nicht einen Zentimeter von seinem vorgesehenen Weg abwich. Nur so funktioniert es, dachte er, man muss dem einmal eingeschlagenen Weg bis zum Ende folgen.
Das fröhliche Treiben einer Gruppe Jugendlicher, die auf der gefrorenen Wasseroberfläche Eishockey spielte, irritierte ihn. Schnell überquerte er die Fußgängerbrücke und verschwand in der Dunkelheit des Grünwaldparks. Er genoss den Schutz des dichten Nadelwalds, der ihn von dem Trubel der Kanalbesucher abschottete, und verlangsamte seinen Schritt. Als sei es ein Spiel, lauschte er dem Knirschen seiner Sohlen auf dem Schnee und achtete darauf, genau in der Mitte des Weges zu bleiben.
Es war kalt, der Wetterbericht hatte weiterhin Minustemperaturen vorhergesagt. Er sah seinen warmen Atem in der eisigen Luft, doch er spürte die Kälte nicht. Er berauschte sich an der Vorstellung, wie er seine Hände um ihren Hals legte. Seine Hände an der Kehle dieses Luders. Bald.
Viel zu schnell erreichte er die in weihnachtlichen Lichterglanz getauchte Hauptstraße. In der beleuchteten Auslage eines Buchladens stapelten sich Bücher und festliche Päckchen vor einer mit Kunstschnee bestäubten Trennwand. Er blieb stehen und betrachtete sein Spiegelbild im Schaufenster. Blaue Augen. Schmale Lippen.
Sein Handy klingelte. Prüfend blickte er auf die Nummer im Display, doch er wusste bereits, wer dran war. Es war so weit. Die Zeit des Wartens war vorbei. Die Jagd begann. Jetzt.
Montag, 8. Dezember
Kapitel 4
Sara stellte das Telefon auf Lautsprecher und betrachtete sich im Spiegel. Mit einer raschen Bewegung zog sie den Bleistift aus dem zu einem Knoten geschlungenem Haar. Wie sehr sie doch ihrem Vater ähnelte. Im Gegensatz zu Tini hatte sie seine dunklen Haare, fast schwarzen Augen und dichten Wimpern geerbt. Sie drehte ihre Haare zu einer Schnecke und befestigte diese von neuem mit dem Bleistift im Nacken. Aus dem Lautsprecher tönte noch immer das Freizeichen. Sara griff nach dem Telefon, um aufzulegen, als sie endlich Tinis verschlafene Stimme hörte.
»Ja?«
»Tini! Endlich! Wo warst du, verdammt? Ich hab mir Sorgen gemacht!«
»Hallo Sara.«
Sara hörte Tini gähnen.
»Liegst du noch im Bett?«
Im Hintergrund lief der Fernseher. Tini musste davor eingeschlafen sein, sie sah nie tagsüber fern.
»Nein.«
»Du klingst verschlafen.« Mit einem Buch in der Hand ging Sara zu dem Bücherregal auf der anderen Seite des breiten Altbauflurs. Sie suchte nach einer Lücke in den Bücherreihen und quetschte das Buch schließlich zwischen Die Buddenbrooks und einen Krimi. Aus dem Telefonhörer schallte die hektische Stimme eines Moderators.
»Wie spät ist es?«, fragte Tini.
Sara warf einen Blick auf ihre Uhr. »Fünf vor halb neun.«
»Kacke!«
»Du liegst doch noch im Bett.« Sara sah ihre Schwester vor sich. Wie sie die blonden Haare hinter ihre Ohren strich, obwohl sie dort nie lange blieben, während ihre blauen Augen einen so intensiv musterten, als versuche sie, Gedanken zu lesen. »Wir waren verabredet, bei Edina, erinnerst du dich? Wegen dem Interview. Du hattest versprochen, dass du pünktlich kommst.«
»Ja ... Sorry. Ich hab verpennt.« Die Stimme des Moderators im Hintergrund verstummte.
»Toll. Ich ...«
»Sara, reg dich ab, ja? Ich bin gestern nach der Weihnachtsfeier auf dem Sofa eingeschlafen. Im Wohnzimmer. Da höre ich den Wecker nicht.«
»Aber ich hab dich doch angerufen.«
»Und ich hab’s nicht gehört. Okay? Wahrscheinlich habe ich gestern zu viel Wein erwischt. Ich fühle mich, als hätte mir jemand mit dem Hammer auf den Kopf gehauen. Sag lieber, wie’s gelaufen ist.«
»Naja, mäßig. Mit dir wäre sie sicher offener gewesen.«
Sara spürte, wie ihre Verärgerung wieder hochkam. Wäre Tini wie versprochen um halb sieben am Treffpunkt gewesen, hätte sie nicht die Hälfte der Zeit damit verbringen müssen, Edinas Vertrauen aufzubauen, um überhaupt verwertbare Aussagen für ihren Artikel über häusliche Gewalt zu erhalten.
»Hat es dir was gebracht?« Tinis Tonfall nahm eine versöhnliche Note an. Sara überlegte kurz, ob sie darauf eingehen sollte.
»Schon.« Sie ging weiter in ihr Arbeitszimmer. »Allein ihre Reaktion, als ich sie auf ihr Baby angesprochen habe.«
»Ja, traurige Geschichte.«
»Ich versteh das nicht. Warum geht sie nicht? Hat er sie nicht auch geschlagen?« Sie setzte sich an ihren Schreibtisch und schaltete den Computer an.
»Ja klar. Der behandelnde Arzt hat das Jugendamt eingeschaltet. Wegen dem Baby. Seitdem betreue ich sie.« Tinis Stimme klang jetzt resigniert, wie so oft, wenn sie über ihre Arbeit als Sozialarbeiterin sprach.
»Warum also?«
»Weil sie glaubt, dass sie keine Chance hat, wenn sie sich wehrt. Ich erlebe das doch jeden Tag, was glaubst du, wie mich das frustriert.« Tini seufzte. »Und weil sie nichts anderes kennt und sich verantwortlich fühlt.«
»Verantwortlich? Für einen Mann, der sie schlägt, und eine Familie, die sie wie Dreck behandelt?«
»Ach, Sara, würdest du aufhören, dich verantwortlich zu fühlen?«
»Ja. Allerdings.« Sie bemerkte die Schärfe in ihrem Tonfall und riss sich zusammen. »Wenn mein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit angegriffen wird ...«
»Man muss die Hand nicht heben, um jemanden zu verletzen«, unterbrach Tini sie.
»Ich weiß nicht, worauf du hinauswillst.«
»Natürlich weißt du das.«
Sara hörte, wie ihre Schwester Geschirr aufeinanderstapelte. »Unglaublich, Paul schafft es nicht mal, seinen Dreck wegzuräumen. Hier stinkt’s wie in einer Currybude. Widerlich. Egal, ich wollte nur sagen, dass du ein Grundrecht auf körperliche und seelische Unversehrtheit hast. Du berufst dich nur auf die körperliche.«
»Und? Körperliche Gewalt ist nun mal die offensichtlichere.«
»Eben. Aber nicht unbedingt die schlimmere. Was tut Edina wohl mehr weh – die angebrochene Rippe oder die Tatsache, dass sie ihr Kind aufgeben muss?« Tini stellte das Geschirr lautstark ab. »Schwieriges Thema, ich weiß. Vielleicht kannst du das ja in deinem Artikel berücksichtigen.«
»Ich werd sehen«, antwortete Sara.
»Ich muss jetzt Schluss machen, sonst verpasse ich meinen nächsten Termin auch noch. Soll ich später bei dir vorbeikommen? Dann kann ich dir helfen, falls dir noch Infos zu Edinas Geschichte fehlen. So gegen sechs?«
»Isst du mit?«
»Gern. Und, Sara?«
»Ja?«
»Tut mir leid, wegen ...«
»Schon gut, bis später.«
Kapitel 5
»Ich kann dir nicht folgen.« Saras Freude wich langsam der Verärgerung über Ronnies abfällige Worte. Als die Redakteurin von Nova heute Mittag angerufen und ihr eine Teilzeitstelle angeboten hatte, war sie jubelnd durch die Wohnung gehüpft. Eine Festanstellung!
»Du willst mir nicht folgen«, sagte Ronnie. »Schatz, glaub mir, wenn du jetzt das Angebot von Nova annimmst, legst du dich fest. Und zwar langfristig.«
Vielleicht hatte er Recht. Vielleicht wollte sie seiner Argumentation wirklich nicht folgen, sondern einfach auf ihren Erfolg mit Champagner anstoßen. »Ja und?«
»Wegen ein paar Euro musst du dein Talent nicht dieser Art von Schundjournalismus opfern.«
Schundjournalismus?
»Wie kannst du so was sagen? Was ist mit dem Artikel, an dem ich gerade arbeite? Wie kann es schlecht sein, unterdrückten Frauen eine Stimme zugeben?«
»Du weißt genau, was ich sagen will.«
Er faltete die Zeitung sorgfältig auf DIN-A-4-Format und legte sie auf den Couchtisch neben den Adventskranz.
»Wenn du in einem Provinzkrankenhaus –«
»Wir reden nicht über mich.« Er neigte den Kopf und betrachtete das Revers seines Jacketts.
»Wenn du in einem Provinzkrankenhaus operierst statt in der Uniklinik, sagt das nichts über die Qualität deiner Arbeit aus.«
Ronnie zupfte eine Fluse vom Revers. »Sara, Schatz, ich will nur dein Bestes.«
»Mag sein, aber du machst es dir leicht. Du sitzt als Oberarzt fest im Sattel. Ich muss als freie Journalistin um jeden Job kämpfen. Und außerdem kennst du Nova überhaupt nicht. Das ist eine anspruchsvolle Frauenzeitschrift.«
»Klar.« Sein abgehacktes Lachen erinnerte sie an eine von Jonas’ sprechenden Star Wars-Figuren. »Und das Tolle am Playboy sind die Reportagen.« Ronnie erhob sich aus seinem Sessel und stand jetzt vor ihr. Einen guten Kopf größer als Sara, grinste er auf sie herab. Sie verschränkte die Arme vor der Brust.
»Du kannst doch Nova nicht mit dem Playboy vergleichen!«
»Ich vergleiche nicht. Ich veranschauliche.« Er strich ihr eine Haarsträhne aus der Stirn. »Im Ernst. Nova ist ein Hochglanzblatt mit Fokus auf Mode und Promis. Wenn du dich dort siehst – bitte. Ich glaube nicht, dass du dort glücklich wirst.«
Sara blickte ihrem Mann nach, der kopfschüttelnd den Raum verließ.
Schundjournalismus?
Machte sie wirklich einen Fehler? Sie folgte ihm in die Küche und lehnte sich an den Türrahmen. Schweigend beobachtete sie, wie Ronnie die Steaks aus dem Kühlschrank holte und auf einem Holzbrett ausbreitete. Wie attraktiv er noch immer wirkte, mit seiner großen Statur und dem ebenmäßigen Gesicht, dabei wurde er nächstes Jahr vierzig. Die grauen Strähnen in den dunkelbraunen Haaren standen ihm. Eigentlich sah er heute besser aus als damals, vor fast zehn Jahren, als sie ihn kennengelernt hatte. Sie stellte sich vor, wie er in seinem Arztkittel den Krankenhausgang entlangschritt, an jeder Seite eine Krankenschwester, die mit schmachtenden Augen an ihm hing.
»Tini isst mit uns.«
Ronnie, der konzentriert das Fleisch marinierte, drehte sich zu ihr um und runzelte die Stirn. »Ich habe nur drei Steaks.«
»Hau halt noch ein Stück Pute mit rein. Ist mir sowieso lieber.«
»Und wann kommt deine Schwester?«
»Gegen sechs.«
Er schaute auf die Uhr. »Es ist halb sieben.«
»Dann kommt sie sicher gleich.«
»Wir essen in genau acht Minuten. Mit oder ohne die Königin von Saba.«
»... und dann hat der Stefan dem Tom den Ball an den Kopf geschossen, und jetzt sagt der Tom, dass er ihn nicht auf seiner Party haben will, aber wir wollten Tom den Lego-Racer doch zusammen schenken, das haben wir doch gesagt, oder Mami?«
Sara nickte.
»Oder Mami?«
»Ja, das haben wir.«
»Und du holst uns mit dem neuen Auto ab.« Jonas fixierte seinen Vater. »Gell, Papa, das hast du versprochen.«
»Wenn du das sagst.«
Jonas blickte erst zu ihr, dann zu seinem Vater und konzentrierte sich schließlich auf sein Steak. Die plötzliche Stille ließ Sara aufhorchen. Ob Jonas jetzt dachte, sie seien ihm böse? Vielleicht sollte sie bei der Geschichte mit dem Ball etwas nachhaken.
»Du hast dich schon dafür entschieden, oder?« Ronnies Messer fuhr mit lautem Quietschen über den Teller.
»Nächsten Montag fange ich an«, antwortete sie und aß weiter, ohne ihn anzublicken.
»Und wie stellst du dir das vor?« Sein Ton war sachlich distanziert, aber nicht unfreundlich.
»Was meinst du?«
»Was ist mit Jonas? Wird er jetzt ein Schlüsselkind?«
Jonas sah sie erschrocken an.
»Er geht zur Schule, was denn sonst?« Sara zerteilte die Ruccolablätter auf ihrem Teller in kleine Fetzen. »Die Mittagsbetreuung der dritten Klasse soll sehr gut sein.«
»Und wenn er krank ist?«
»Nehme ich mir frei.« Sie schnappte sich die Pfeffermühle und würzte mit drei energischen Drehungen das Fleisch nach. »Was soll das? Fragst du das die Bewerberinnen im Krankenhaus auch? Das ist sexistisch.«
Ronnie setzte zu einer Antwort an, als das Telefon klingelte.
»Das wird Tini sein.« Sie stand auf. »Hallo?«
»Sara, Tini ...« Die Worte ihrer Mutter gingen in Schluchzen unter. Saras Herz zog sich zusammen.
»Mama! Was ist mit Tini?«
Kapitel 6
Der Raum war leer. Lydia blickte auf die große Wanduhr über dem Eingang. Zwanzig vor sieben. Das Treffen begann um sieben. Sie öffnete ihre Jacke und überlegte, ob sie die Zeit nutzen sollte, um in dem kleinen Büro neben dem Veranstaltungssaal ihre Mails abzurufen, als sie aus der Kochnische am hinteren Ende des Saales ein Hämmern hörte. Sie legte die Jacke über einen der bereits im Kreis aufgestellten Stühle und ging zur Kochnische.
»Petra! Was machst du denn schon hier?«
»Diese Scheißmaschine! Erst braucht sie Wasser, dann Bohnen, dann muss sie spülen und jetzt soll ich sie auch noch reinigen. Nur Kaffee macht sie nicht.« Petras sonst so blasses Gesicht hatte rote Flecken, ihr strenger Dutt hing schief zur Seite.
Lydia lachte. »He, es ist nur eine Kaffeemaschine. Komm mal wieder runter!« Sie ging zur Kaffeemaschine und schaltete sie aus. »Was hältst du davon, wenn wir eine Kanne Tee kochen? Ist eh besser am Abend.«
Petra trat einen Schritt zurück. »Seit wann gibst du so leicht auf?«
»Seit wann lässt du dich von so einer Lappalie aus der Ruhe bringen?« Lydia öffnete den kleinen Hängeschrank und entnahm ihm zwei rote Tütchen. »Links oder rechts?«
»Ich hasse es, wenn die einfachsten Dinge nicht funktionieren.« Die Flecken in Petras Gesicht verblassten langsam.
»Was ist wirklich los?« Lydia musterte Petra aufmerksam. »Hat er wieder gegen die Auflagen verstoßen?«
»Nein es ist wegen dir. Ich kann dich nicht ersetzen!« Sie stieß die letzten Worte mit einer Heftigkeit hervor, die Lydia erschreckte. »Wie soll das gehen? Die Gruppe wird mich nie als Leiterin akzeptieren. Ich bin doch nur eine von ihnen!«
»Petra. Ganz langsam. Du bist am längsten dabei, und du hast den Absprung geschafft. Du weißt, durch welche Hölle die anderen gehen, und du weißt, dass man sich daraus befreien kann.« Lydia legte ihre Hand auf Petras Schulter. »Und außerdem musst du mich nicht völlig ersetzen, sondern nur ab und zu vertreten. Ich habe Berlin abgesagt.«
»Du... du bleibst? Du nimmst den Job nicht an?« Petra blickte Lydia skeptisch an, als wolle sie den Wahrheitsgehalt der Aussage testen.
Lydia nickte und wandte sich ab. Sie wollte nicht, dass Petra ihr die Enttäuschung ansah, die sie bei dem Gedanken an Berlin wieder überfiel. Schweigend löffelte sie die Teemischung in eine Filtertüte und goss den Tee auf.
»Aber ich dachte, das sei deine Chance, endlich diesen blöden Job bei dem Versicherungsheini aufzugeben und für deine Frauenarbeit bezahlt zu werden. Wie lange arbeitest du jetzt schon ehrenamtlich für die Selbsthilfegruppen? Vier Jahre? Fünf Jahre?«
»Ich gehöre hierher.«
»Es ist wegen Anina, oder?« Petra senkte ihre Stimme. »Du bist noch immer nicht darüber hinweg?«
Mit einem Ruck hob Lydia die Filtertüte aus der Kanne und warf sie ins Waschbecken. Sollte sie Petra den wahren Grund für ihre Entscheidung sagen? »Unsinn! Meine Entscheidung hat nichts mit Anina zu tun.«
»Die Rosen auf ihrem Grab waren von dir, oder?«
Lydia schaute sie überrascht an. »Du warst dort?«
»Natürlich.« Petra hob die Arme wieder zum Kopf und löste ihren Dutt. »Ich bringe ihr immer Nelken am Todestag.« Geschickt drehte sie die langen, graublonden Haare zu einer ordentlichen Schnecke und steckte sie mit drei Nadeln fest.
»Ihr hattet große Pläne, ich weiß das von Anina. Ihr zwei gegen den Rest der Welt.« Petra lächelte jetzt, ihr Blick schweifte ab, als könne sie etwas sehen, das Lydia verborgen blieb.
Kapitel 7
Er stand ganz still. So still, dass seine Gestalt mit dem Busch verschmolz, in dem er sich versteckte. Konzentriert beobachtete er die Szene hinter dem Fenster, das ihm Woche für Woche das gleiche Schauspiel bot. Doch etwas stimmte heute nicht. Er brachte seinen Kopf näher an die Scheibe heran.
Plötzlich wusste er, was nicht passte. Der Mann. Der Mann, der gerade in seine Richtung schaute. Hastig zog er seinen Kopf zurück, spürte, wie ein Dorn seine Wange zerkratzte. Dann wagte er erneut einen Blick in den hell erleuchteten Raum. Neben ihm, auf beiden Seiten, saßen Frauen, die er noch nie gesehen hatte. Und daneben saß SIE.
Und wie sie da saß: Die Arme vor der Brust verschränkt, den Kopf in den Nacken gelegt, leicht zu einer Seite gebeugt. Respektlos. Furchtlos.
Ahnungslos.
Du fühlst dich so sicher unter deiner Perücke. Als ob mich das auch nur eine Sekunde täuschen könnte. Da hast du gesessen. Auf dem Stuhl, genau gegenüber vom Fenster. Ich habe dich sofort erkannt. Nach fünf Jahren.
Ja, er hatte sie sofort erkannt, aber er hatte nur dagestanden. Hatte den Anblick in sich aufgesaugt wie ein Verdurstender Wasser.
Wieder verspürte er den Impuls, hineinzurennen und sie aus dem Raum zu zerren, seine Beute in Sicherheit zu bringen. Seine Beine kribbelten. Seine Hände juckten. Sie waren bereit. Er war bereit.
Nein! So lange hatte er gewartet, jetzt wollte er sie in die Enge treiben, zusehen, wie sie immer panischer wurde, während er die Schlinge um ihren Hals langsam zuzog.
Du hast verloren. Ich sehe dich, egal wo du bist.
Er lächelte. Er wusste genau, was er mit ihr vorhatte.
Kapitel 8
»Und die Polizei glaubt wirklich, dass Tini Paul getötet hat?« Sara schüttelte ungläubig den Kopf. »Das ist doch völlig absurd!« Sie beobachtete das Mienenspiel ihrer Mutter. Wie alt und müde sie auf einmal aussah. Schnell wandte Sara den Blick ab, und versuchte die wenigen Informationen zu ordnen, die sie von ihrer Mutter erhalten hatte.
Ihr Schwager war tot. Tini musste Paul kurz nach ihrem gemeinsamen Telefonat heute früh gefunden haben. Er hatte seltsam gekrümmt neben dem Bett in seinem Erbrochenen gelegen. Angeblich vergiftet. Von Tini, behauptete die Polizei. Mutmaßlich. Blödsinn. Es musste eine andere Erklärung für Pauls plötzlichen Tod geben. Sie zwang sich, ihre Mutter wieder anzusehen.
»War Paul wirklich Alkoholiker? Hast du das gewusst?«
»Nein. Ich dachte, sie wären glücklich.«
»Ich auch.« Sara seufzte. »Wie klang Tini denn, als du mit ihr telefoniert hast?«
»Ich fand sie erstaunlich gefasst«, sagte die Mutter nach einer kurzen Pause. »Vielleicht lag das auch an den Beruhigungstabletten, die sie bekommen hat. Sie stand völlig unter Schock, nachdem sie Paul gefunden hatte.«
Die Stimme der Mutter brach. »Unsere arme Tinimaus«, flüsterte sie, »das muss so furchtbar gewesen sein.« Sie tupfte sich mit einem zerknüllten Taschentuch die Tränen aus den Augenwinkeln.
Wieder entstand eine Pause. Sara sah der Mutter an, wie sehr die Ereignisse in ihr arbeiteten. Schließlich brach sie das Schweigen.
»Ich überleg schon die ganze Zeit, ob sie etwas angedeutet hat, oder ob sie anders war in letzter Zeit ...«
»Und?« Ihre Mutter beugte sich vor, ein paar Zentimeter nur, doch Sara erkannte in dieser winzigen Bewegung ihre Hoffnung, endlich Aufschluss über die ungeheuerlichen Geschehnisse zu bekommen.
»Ja nichts! Überhaupt nichts!« Sie bemerkte, wie sich der Oberkörper ihrer Mutter zurückzog und Enttäuschung sich auf ihrem Gesicht ausbreitete. »Ich wusste zwar, dass er viel Druck in der Bank hatte und oft gestresst war, aber das war auch alles.«
»Über was habt ihr dann immer geredet?«
»Über alles Mögliche halt.« Sara rief sich die letzten Treffen und Telefonate mit Tini in Erinnerung. In den letzten Tagen drehten sich die meisten Gespräche um den Artikel, den sie über Edina schreiben wollte. Und sonst?
»Ja, über was denn, zum Beispiel?«
Sara zuckte mit den Schultern. »Über ihre Arbeit, oder Ronnie ...«
»Ronnie?«
Sara spürte den prüfenden Blick ihrer Mutter. »Dies und das, wenn ich mich halt geärgert hab oder so ...«
»Habt ihr denn auch Probleme?«
»Mama!« Sara sah die Sorge in den Augen ihrer Mutter. »Nur weil ich über meinen Mann rede, muss doch nicht gleich der Haussegen schief hängen!«
»Ihr redet also über Ronnie, aber nicht über Paul – obwohl er getrunken hat?«
Sara schwieg. Wie hatte Tini ihr das verheimlichen können? Und wieso hatte sie es nicht selbst bemerkt? Zitternde Hände, eine Fahne zur falschen Tageszeit, eine lallende Aussprache, ein aufgedunsenes Gesicht, hätte es nicht genug Warnzeichen geben müssen? Wann hatte sie Paul eigentlich das letzte Mal gesehen? Tini war in letzter Zeit immer allein gekommen, weil Paul so viel arbeiten musste. Sie schien das nie gestört zu haben. Hätte ihr das nicht auffallen müssen? Sie erhob sich und ging zum Fenster. Die klare Winternacht war vom Mond hell erleuchtet. Der erste Schnee des Jahres bedeckte den Rasen.
Paul hatte heimlich getrunken. Wie hießen die? Deltatrinker. Hatte sie nicht vor kurzem etwas darüber gelesen? Sara lehnte ihre Stirn an das kühle Fenster. Konstanter Alkoholspiegel, zumeist versteckter Konsum, seltener Rauschzustand, unauffälliges Verhalten. Ob man mit Kaugummi eine Fahne vertuschen konnte? Sie musste unbedingt mit Tini reden. Wo steckte sie bloß? So ein Verhör konnte doch nicht so lange dauern!
»Ich muss morgen auf die Polizei, eine Aussage machen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.« Die Stimme der Mutter riss Sara aus ihren Gedanken. Sie hob ihren Kopf und drehte sich zu ihr um.
»Na, dass Tini niemals ihren Mann umgebracht hätte, natürlich. Vielleicht war er total dicht, als er ins Bett ist, und Tini hat nicht gemerkt, wie schlecht es ihm ging, weil sie im Wohnzimmer eingeschlafen ist.« Sie ging zu ihrem Sessel zurück und blieb daneben stehen. »Kann man an einer Alkoholvergiftung sterben?«
Kapitel 9
Sara lehnte am Steingeländer der Brücke und sah den dick vermummten Frauen und Männern zu, die ihre Curlingstöcke über die vom Schnee befreite Oberfläche des Nymphenburger Kanals schlittern ließen. Der Geruch nach Glühwein hing noch in der Luft, obwohl der kleine Kiosk, an dem man sich an kalten Wintertagen Eisstöcke leihen und Getränke und Hotdogs kaufen konnte, schon geschlossen hatte. Es musste kurz nach zehn sein. Früher waren sie oft zu viert hier gewesen, Paul, Tini, Ronnie und sie, hatten Glühwein getrunken und ihre Füße beim Eisstockschießen steifgefroren. Früher ... Wie das klang. Als wäre es Jahre her, dabei waren sie doch erst ... Sie schüttelte ungläubig den Kopf. Es war über zwei Jahre her.
Jetzt war Paul tot.
Angeblich ermordet.
Und Tini wurde noch immer verhört.
Es war unfassbar.
Wie oft hatte sie Tini um ihre harmonische Ehe beneidet, sich gewünscht, dass Ronnie so verständnisvoll und tolerant wäre wie Paul, sie auch so aktiv darin unterstützte, beruflich Fuß zu fassen. Und auch so einen tollen Humor hatte. Deswegen hatte Tini sich in ihn verliebt, sie erinnerte sich noch gut daran. Wie unglaublich blind sie gewesen sein mussten, dass Tini und Paul ihnen ihre Probleme so lange verheimlichen konnten. Eigentlich sollte sie Ronnie Abbitte leisten, vielleicht war sie wirklich einfach zu empfindlich, was seine Kommentare betraf. Oder erwartete sie schlicht zu viel? Empfand sie deshalb ihre Ehe nicht als glücklich?
Dabei war Ronnie ein vorbildlicher Vater. Überhaupt, was war Glück? Rosarotes Abendglühen bei Rosamunde Pilcher?
Sie blickte unschlüssig auf das Päckchen Zigaretten, das sie vor etwa zehn Minuten gekauft hatte, und begann langsam die Folie abzuziehen. Vorsichtig öffnete sie die Schachtel, entfernte das Silberpapier und roch mit geschlossenen Augen an dem Tabak. Dann steckte sie die Packung zurück in ihre Manteltasche. Wie schnell sich eine Situation ändern konnte. Heute früh waren sie eine ganz normale Familie gewesen, jetzt war ein Familienmitglied tot und ein weiteres stand unter Mordverdacht.
Was war nur geschehen? Sie nahm eine Zigarette und sah sich um. Knapp einen Meter neben ihr stand ein Mann. Sein Blick war starr geradeaus gerichtet, als wäre er in seiner eigenen Welt versunken, mit einem zufriedenen Lächeln, das seine schmalen Lippen umspielte.
Was soll’s. Sie machte einen Schritt auf ihn zu und bat ihn um Feuer. Bemerkte, wie er sie musterte, als das Feuerzeug ihr Gesicht im Schein der Flamme kurz erhellte.
»Was macht so eine hübsche Frau wie Sie hier ganz allein?«
»Ich denke nach.«
»Ein guter Ort dazu, nicht?«
»Ja, still und ungestört.« Sara hoffte, dass er den Wink kapieren würde. Er blieb stumm neben ihr stehen. Dann hakte er nach: »Liebeskummer?«
»Glücklich verheiratet.« Sie hob die Hand, in der sie die Zigarette hielt, um dem Fremden ihren Ehering zu zeigen.
»Na dann, schönen Abend noch«, murmelte der Mann und ging davon.
Glücklich verheiratet, äffte sie sich im Stillen nach und wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte.
Dienstag, 9. Dezember
Kapitel 10
Die Haustür stand offen. Trotz der eisigen Temperaturen, trotz des Hinweisschildes Türe bitte immer schließen. Sara klingelte mehrmals. Dann trat sie entschlossen in den Eingangsbereich mit dem blauen Mosaikboden und lief an Briefkästen und Lift vorbei zur Treppe. Die Absätze ihrer Stiefel klapperten auf den Steinstufen. Vielleicht schlief Tini noch und hatte deshalb nicht auf das Klingeln reagiert. Wie lange sie gestern wohl noch auf der Polizeistation gewesen war? Sicher war sie völlig fertig.
Vor der Wohnungstür hielt sie inne. Sie war versiegelt. Der Anblick versetzte ihr einen Schlag in den Magen. Es war wirklich so – Paul war tot. Mit Siegel. Amtlich.
Wenn Tini nicht hier war, wo war sie dann? Unschlüssig lehnte Sara sich an die Tür.
»Frau Neuberg? Sind Sie Frau Neuberg, Christinas Schwester?«
Ein Mann kam auf sie zu. Groß, mit dunkelblonden Haaren und einem freundlichen Lächeln, das ihn auf Anhieb sympathisch machte. Er trug Jeans und eine Lederjacke, darunter einen schwarzen Rollkragenpullover mit auffälligem Reißverschluss am Hals. Er musste gerade mit Tinis Nachbarin geredet haben. Die alte Frau stand vor ihrer Tür, die geblümte Schürze straff über den Bauch gebunden, und blickte ihm skeptisch nach. Ob er ein Zivilpolizist war?
»Frau Neuberg?«
»Wie kommen Sie darauf?«
Er zog ein Foto aus seiner Innentasche und hielt es Sara hin.
Sie betrachtete es. Paul, Tini und sie selbst, jeder eine Radlermaß in der Hand, im Hintergrund das Klettergerüst eines Spielplatzes. Ihr letzter gemeinsamer Biergartenbesuch. Sie schluckte. Der Mann streckte ihr seine Hand hin.
»Michael Seitz. Christinas Anwalt.« Sein Händedruck fühlte sich gut an.
»Wo ist Tini? Haben Sie mit ihr gesprochen? Wie geht es ihr?«
»Sie ist... noch verhindert«, sagte er leise und beugte sich dabei noch etwas vor. Sie nahm den Geruch seines Eau de Toilette wahr. Moosiger Fels im klaren Bergbach, sie erkannte es sofort, so hatte sie ihren Favoriten bei der Dufttestreihe für Nova beschrieben.
»Verhindert?«
Seitz schwieg.
»Sie hat ihn so geliebt.« Sara schüttelte den Kopf, als könne sie noch immer nicht glauben, dass Tini Witwe war. Witwe? Wie das klang, Witwe. Tini war siebenundzwanzig. »War es ein Unfall, also ich meine, hat Paul aus Versehen zu viel getrunken? Er ist doch an einer Alkoholvergiftung gestorben? Oder...« Sie senkte ihre Stimme. »Selbstmord?«
Er drehte sich um, zur Nachbarin, die immer noch in der Tür stand.
»Ich bringe Sie nach Hause, Frau Neuberg.« Noch während er sprach, umfasste er ihren Oberarm und zog sie sanft zum Aufzug.
»Warum ist die Wohnung versiegelt?«
»Die Spurensicherung wird noch nicht fertig sein.«
»Spurensicherung?« Sie musste zu laut gesprochen haben, denn er legte seinen Finger an den Mund und machte eine Kopfbewegung in Richtung der Nachbarwohnung.
»Spurensicherung?«, flüsterte sie. »Dann denkt die Polizei tatsächlich, es ist Mord? Oder?«
Er nickte.
»Das ist doch nicht ...? Glauben Sie das auch? Ein Unfall ... Es muss ein Unfall gewesen sein!«
»Das ist unwahrscheinlich. Oder eher: ausgeschlossen.«
Endlich kam der Aufzug. Mit einem blechernen Knarren öffnete sich die Tür. »Die braucht Öl.« Er drückte auf E.
»Und Selbstmord?« Sie hörte, wie ihre Stimme quiekte.
»Kein Abschiedsbrief. Auch wie er gestorben ist, spricht dagegen.«
Der Lift hatte sein Ziel erreicht.
»Jetzt sagen Sie nicht ... Tini hat damit nichts zu tun, das wissen Sie doch, oder?« Der Gedanke, er könnte ihre Schwester für eine Mörderin halten, traf sie so plötzlich, dass sie Seitz am Ärmel packte und ihn zwang, sie anzusehen. Sie schluckte den Kloß, der sich in ihrer Kehle festsetzen wollte, hinunter. »Tini hat damit nichts zu tun!«
»Der Staatsanwalt sieht das anders.«
»Und Sie, was denken Sie?«
»Ich halte das für Unsinn«, antwortete er. Sein Blick war weich.
Gemeinsam traten sie auf die Straße. Sofort kroch die Kälte unter ihren Lammfellmantel. Sie fröstelte und wickelte den Wollschal noch einmal um ihren Hals, bis nur noch Nase und Augen zwischen Schal und Mütze zu sehen waren.
»Sind Sie öffentlich oder mit dem Auto da?«, fragte Seitz und zog einen Autoschlüssel aus seiner Lederjacke.
»U-Bahn. Ich wohne gleich an der Haltestelle Rotkreuzplatz.«
»Darf ich Sie heimfahren? Dann können wir ungestört reden.«
»Gerne.« Ungestört reden. Ja! Sie hatte tausend Fragen, die nach einer Antwort schrien, sich aber gegenseitig im Weg standen.
Schweigend gingen sie den Gehweg entlang, zu einem schwarzen Alfa Romeo. Er öffnete die Beifahrertür. Auf dem Sitz stapelten sich Zeitungen.
»Entschuldigen Sie, ich hatte nicht mit Begleitung gerechnet.« Er warf die Zeitungen in den Fond des Wagens. Sie stiegen ein. Als er den Motor starten wollte, jammerte der Anlasser nur kurz, dann war es still. Eine Zornesfalte bildete sich auf seiner Stirn.
»Komm schon.« Er drehte den Schlüssel noch einmal um, es gurgelte, Stille. »Scheißkarre. Typisch Alfa. Wenn es zu kalt ist, fährt er nicht, wenn es zu heiß ist, fährt er nicht, und wenn es zu nass ist –«
»Sowieso nicht. Ich weiß. Schönheit hat ihren Preis.«
Der nächste Versuch klang besser, heulend sprang der Motor an.
»Wie kommt der Staatsanwalt darauf, dass Tini etwas mit Pauls Tod zu tun haben könnte?«
»Die Ehefrau ist in der Regel die erste Person, auf die die Polizei ihr Augenmerk richtet.«
»Ist das nicht ein bisschen einfach?«
»Nein, das ist Statistik.«
»Aber Sie sind doch ihr Anwalt!«
»Deswegen war ich eben bei der Nachbarin. Ich kann ihr nur helfen, wenn ich Beweise finde, die die Theorie der Polizei widerlegen.«
»Braucht die Polizei keine Beweise?«
»Doch. Sicher.«
»Gibt es denn ...« Sara räusperte sich. »Hat sie denn irgendwelche ...«
Seitz ließ seinen Blick von der Straße zu ihr wandern. Vorsichtig. Fragte er sich, wie viel er ihr anvertrauen konnte? Oder was sie wusste?
»Tini und ich haben keine Geheimnisse voreinander. Sie können ruhig reden.«
»Dann wissen Sie, dass sie geschlagen wurde?«
Sie starrte immer noch wie betäubt ins Leere. Gedankenverloren nippte sie an ihrem Milchkaffee. Seitz hatte seine Aufmerksamkeit auf die Speisekarte gerichtet. Den Espresso hatte er in einem Zug geleert, wie ein Koffeinjunkie auf Entzug. Wer war dieser Mann, der ihr diese Ungeheuerlichkeiten erzählte? Woher wusste sie, dass sie ihm trauen konnte? Erst jetzt fiel ihr der Schatten auf seinem Gesicht auf. Ein unrasierter Anwalt? Ob er damit den Kratzer, der sich vom Ohr bis zum Kinn zog, verdecken wollte? Sie bekam plötzlich Kopfschmerzen. Pochend. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand massierte sie ihre Schläfe, die sich wie ein Blasebalg in ihr Gehirn ausdehnte und wieder zusammenzog. Wenn sie den richtigen Punkt traf, gingen die Schmerzen wieder weg. »Ich kann es einfach nicht glauben. Paul hat Tini wirklich geschlagen?«
Seitz nickte. »Für die Polizei reicht das als Motiv. Außerdem sind ihre Fingerabdrücke auf der Aluschale mit den Essensresten, in denen wohl das Gift gewesen ist.« Er legte die Speisekarte weg. »Und sie war zum Todeszeitpunkt wahrscheinlich in der Wohnung.«
Sara fixierte ihren Kaffee. Sie wollte Seitz nicht ansehen. Warum hatte Tini ihr nichts erzählt? Sie waren doch immer füreinander da gewesen. Sie spürte seinen Blick. »Ihre Schwester war öfters in einem Internetforum. Sie hat dort über ihre Probleme mit Paul geschrieben. Haben Sie Stift und Papier?«
»Ja.« Sie holte ihr Notizbuch und einen Kugelschreiber aus ihrer Handtasche.
»Notieren Sie bitte: www.frauenwehr.de. Ihre Schwester hat unter dem Pseudonym Esperanza geschrieben.«
Tini hatte im Internet über ihre Eheprobleme geschrieben? Im Internet?
»Das Problem ist, dass auf den ersten Blick viele Indizien gegen sie sprechen.«
»Es macht keinen Sinn.« Sie räusperte sich. »Ich meine, sie hätte nur gehen müssen! Das predigt sie ihren Schützlingen doch hundert Mal am Tag!« Wütend verstaute sie ihr Notizbuch in der Tasche.
»Ich weiß. Und dennoch deuten die Indizien auf sie. Wir müssen Beweise beibringen, dass sie es nicht gewesen sein kann.«
»Aber wer könnte es denn gewesen sein?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Seitz.
Kapitel 11
Leise öffnete Lydia die Tür zum Krankenzimmer. Sie versuchte zu lächeln, doch es fiel ihr schwer. Als der behandelnde Arzt sie eben zur Seite genommen hatte, um mit ihr über Marie zu sprechen, war ihr wieder einmal bewusst geworden, wie wichtig und gleichzeitig vergeblich ihre Arbeit oft war. Wie konnte Marie nach fast drei Jahren noch immer so einen Müll erzählen? Sie sei nach einen Alptraum in Panik aus dem Fenster gesprungen. Glaubte sie im Ernst, dass irgendjemand ihr das abnahm? Hier in der Notaufnahme, wo jeder Arzt ihren Leidensweg kannte? Lydia nickte den anderen Patientinnen in dem Vierbettzimmer freundlich zu und zog einen Stuhl an Maries Bett, dem letzten im Raum.
»Hallo Marie, wie geht es dir?«
»Oh Mann, endlich! Die wollen mich hier umbringen, weißt du, wann ich meinen letzten Chick hatte?« Marie richtete sich mühsam im Bett auf. Ihr linker Arm war geschient, ihr rechtes Auge hatte einen breiten, lilafarbenen Rand, über der Augenbraue klebte eine Mullbinde, ihre Oberlippe war mit zwei Stichen genäht worden.
»Du siehst echt scheiße aus.« Lydia berührt die Schiene. »Tut’s weh?«
»Frag mich, wenn die Schmerzmittel nachlassen. Viel schlimmer ist, dass ich nicht allein aus dem verdammten Bett darf.« Sie rümpfte die Nase und zog ihre lädierte Lippe leicht nach oben. »Ich könnte ja zusammenklappen ... Blödsinn. Komm, ich will in den Garten.«
»Du willst eine rauchen.« Lydia schlug die Bettdecke zurück und half ihr, sich aufzusetzen.
»Und? Warum nicht? Ich hab noch nie gehört, dass man wegen einem gebrochenen Arm nicht rauchen darf.« Ihre dünnen Beine waren übersät mit blauen Flecken und Schürfwunden. »Holst du mir meinen Mantel?«
Marie inhalierte den Rauch, behielt ihn eine Zeit lang in der Lunge und stieß ihn dann mit einem tiefen Seufzer aus. Lydia beobachtete sie von der Seite, registrierte die hektischen Bewegungen, die Nervosität, die sie vergeblich zu überspielen versuchte.
»Das tut gut. Oh Mann, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie biestig die hier sind.«
»Was ist passiert, Marie?« Lydia legte ihre Hand auf Maries Oberarm. »Und erzähl mir nicht den Schrott mit dem Alptraum. Verstanden?«
Marie schloss kurz die Augen. »Ich ... ich weiß es nicht. Wirklich. Ich weiß es nicht.«
»Marie!« Lydia fixierte ihr Gesicht. »Du springst aus dem Fenster und weißt nicht warum? Für wie blöd hältst du mich?«
»Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich hab schon geschlafen und plötzlich ...« Sie brach ab. Ihre Unterlippe zitterte. Schnell führte sie die Zigarette an den Mund und nahm einen Zug.
»Und plötzlich?«
»Er stand einfach da. An meinem Bett. Hat mich an den Haaren nach oben gezogen. Mich angeschrien. Und meinen Kopf gegen die Wand geschlagen. Und ...« Ihre Augen wurden feucht, sie zwinkerte mehrmals, doch sie konnte die Tränen nicht mehr zurückdrängen.
Lydia zog ein Taschentuch aus ihrem Rucksack.
»Und dann?« Sanft tupfte sie über die Tränen, die Maries Wangen herunterliefen.
»Er hat immer nur geschrien. Du Hure, ich bring dich um. Immer wieder. Du Hure, ich bring dich um. Und meinen Kopf gegen die Wand. Ich hab doch geschlafen. Ich wusste gar nicht, was los war.« Sie nahm Lydia das Taschentuch aus der Hand. Resolut wischte sie sich über die Augen und schnäuzte sich. »Immer du Hure, ich bring dich um, ich hatte solche Angst, so hab ich ihn noch nie gesehen.«
»Weißt du, was ihn so aufgeregt hat?«
Marie nickte. »Ich glaub schon.« Die Tränen liefen ihr über das Gesicht.
Lydia wartete, dass sie weitersprach. Sie wusste, es war sinnlos, Marie jetzt zu drängen, sie musste es von allein erzählen.
»Wegen meinem Ex. Wegen dem Geld. Für den Laden. Er wusste nicht, dass ...« Sie schwieg und rauchte stumm ihre Zigarette zu Ende, warf sie vor sich auf den Boden und zerquetschte sie mit der dünnen Sohle ihres Stiefels. »Er wusste nicht, dass das Geld dafür von meinem Ex war. Die Bank hat mir doch nichts gegeben!«
Sie starrte in den Schnee, noch immer trat sie auf der Kippe herum. »Er sagt, ich besorg’s meinem Ex ...« Sie stampfte mit dem Fuß auf.
Lydia berührte sie am Arm, ganz leicht nur, um sie nicht zu unterbrechen, aber fest genug, um sie spüren zu lassen, dass sie nicht alleine war.
»Das ist mein Geld! Das ist mein Anteil am Haus!« Sie drehte ihren Kopf zu Lydia. »Meins! Verstehst du. Dafür muss ich es niemandem besorgen ...«
»Hat er dich aus dem Fenster gestoßen?«
Marie schüttelte den Kopf. »Ich hatte so eine Angst. Ich hab mich losgerissen und bin ins Wohnzimmer, und da hab ich mit der Ginflasche nach ihm geworfen, und die ist zerbrochen, und er ist mit der Flasche auf mich los, und ich bin in die Küche und hab die Tür zugesperrt, und dann ...«
Sie rieb sich mit dem Ärmel über das Gesicht. »Und dann hat er die Tür eingetreten, und ich bin aus dem Fenster gesprungen.«
Lydia legte den Arm um Marie, die den Kopf an Lydias Schulter lehnte. Gemeinsam schwiegen sie in der Stille des Krankenhausgartens. Die Bilder von Marie, wie sie mit dem Kopf gegen die Wand krachte, in Todesangst durch die Wohnung flüchtete und schließlich aus dem Fenster in die dunkle Nacht sprang, arbeiteten in Lydia. Sie spürte, wie der altbekannte Hass in ihr aufloderte und sie am liebsten aufgesprungen wäre, um den brutalen Schläger eigenhändig zur Rechenschaft zu ziehen, um ihm jede Verletzung, die er Marie angetan hatte, doppelt und dreifach zurückzuzahlen. Schließlich brach sie das Schweigen.
»Und jetzt? Wie geht’s jetzt weiter? Warum erzählst du den Ärzten diesen Mist von dem Alptraum?«
Maries Gesichtsausdruck verfinsterte sich. »Ach, die Wichtigtuer. Du weißt doch, was dann abgeht. Die spielen sich als Helden auf und verständigen die Polizei, und dann soll ich ihn anzeigen und ... Die haben doch keine Ahnung!«
»Stopp! Diese Wichtigtuer wollen dir helfen, klar? Die verdienen etwas mehr Respekt.«
Marie fischte eine Zigarette aus der Schachtel auf ihrem Schoß und zündete sie an. Viel zu schnell inhalierte sie das Nikotin. Lydia spürte Maries Zerrissenheit, die Unsicherheit, die sie mal wieder hinter ihren markigen Sprüchen zu verstecken versuchte. Doch sie ließ sich nicht täuschen. Da war noch mehr, etwas, das Marie noch tiefer getroffen haben musste als die Schläge oder ihr Sturz aus dem zweiten Stock. Geduldig wartete sie darauf, dass Marie ihre zweite Zigarette ausdrückte.
»Und? Zeigst du ihn an?«
Marie schüttelte den Kopf.
»Warum? Ist es wieder deine Schuld? Weil du ihn provoziert hast?« Lydia bemerkte den sarkastischen Tonfall in ihrer Stimme und machte eine kurze Pause. Als sie fortfuhr, achtete sie darauf, so neutral wie möglich zu sprechen. »Wie soll es weitergehen? Marie? Wie? Du weißt, dass du wieder hier landen wirst. Solange du ihn nicht zur Rechenschaft ziehst, wird er glauben, dass er mit dir alles machen kann. Alles.«
Marie mied ihren Blick.
»Irgendwann ist es nicht mehr die Notaufnahme. Dann ist es zu spät. Du musst ihm Einhalt gebieten. Jetzt. Du musst ihn anzeigen.«
»Ich kann nicht.« Maries Worte waren kaum zu verstehen.
»Marie! Natürlich kannst du! Verdammt! Du kannst ihn sofort wegweisen lassen. Du weißt genau, dass er sich dir dann nicht mehr nähern darf.«
»Nein, ich kann nicht. Er... er bringt uns alle um. Die Kinder, meinen Ex, mich, uns alle. Er hat’s geschworen.«
Kapitel 12
Während Sara darauf wartete, dass der Computer hochfuhr, ließ sie den Blick durch ihr Arbeitszimmer wandern und betrachtete Jonas’ Bilder, die zwischen Fenster und Bücherwand hingen, zusammen mit Fotos in verschiedenen Größen. Fotos von Jonas, Ronnie, ihrer kleinen Familie, zu Hause, im Urlaub. Fotos von ihrer besten Freundin, ihrer Mutter, von Tini. Tini und sie beim Klettern, die legendäre Romreise zu ihrem zwanzigsten Geburtstag, Tini und sie als Teenager beim Schwimmen, als Kinder beim Skifahren. Sie stand auf und stellte sich vor das Foto. Das fröhliche Grinsen ihrer Schwester zeigte eine Zahnlücke, die Hose, durchnässt von den vielen Stürzen, hatte einen Riss am Knie, und die Mütze hing ihr schief über ein Ohr. Ihr eigenes, ernstes Gesicht war der Kleineren zugeneigt, den Arm fest um ihre Schulter, drückte sie Tini so eng an sich, dass ihre beiden Körper ein umgekehrtes V bildeten.
Sie tippte die URL aus ihrem Notizbuch ab und sammelte die Kugelschreiber auf ihrem Schreibtisch ein, während der Browser arbeitete. Sie liebte diesen Tisch, er war aus Glas und wie immer über und über mit Papieren bedeckt, auf dem Teetassen und Wassergläser ihre Ränder hinterlassen hatten. Endlich. Ein paar Klicks später hatte sie die aktuellen Postings der Forumsmitglieder auf dem Bildschirm.
Heute 20:05 von Babette
hi maren, was soll das? du lügst dir nur in die eigene tasche, wenn du glaubst, dass du ihn mit einem anti-aggressions-kurs ändern kannst, der schlägert seit jahren und das soll ihn in ein lamm verwandeln? totaler scheiß, sorry, aber hey? wach auf! babette
Sara überflog die Einträge der letzten vierundzwanzig Stunden und spürte, wie sich mit jedem Wort mehr Widerstand in ihr aufbaute. Niemals würde Tini in so einem Forum ihre Eheprobleme erörtern. Niemals! Sie lehnte sich auf ihrem Drehstuhl zurück und versuchte, sich an die letzten Gespräche mit Tini zu erinnern. Hatte sie wirklich nie anklingen lassen, dass in ihrer Ehe etwas nicht stimmte?
Meist hatte sie selbst Tini ihr Herz ausgeschüttet. Über Ronnie. Vielleicht sollte sie öfter mal solche Foren besuchen, wenn sie sich ärgerte, um die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken.
»Brauchst du noch lang?« Ronnie trat neben sie und stellte ein Glas Wein auf den Schreibtisch. »Der Krimi fängt gleich an.«
»Danke. Ich komme nach.« Sie nippte. »Shiraz?«
»Chilenischer Sauvignon.« Er zog einen zusammengefalteten Zettel aus der Hosentasche und reichte ihn ihr. »Die Internetadresse habe ich heute von Eleonor bekommen, du weißt, die neue Anästhesistin.«
Sara öffnete das Papier und blickte Ronnie fragend an.
»Das ist ein Handyortungsservice. Eleonor nutzt diesen Service für ihren Sohn. Ich finde, wir sollten das für Jonas auch einrichten. Du musst dich nur anmelden und seine Handynummer bei dem Provider für die Ortung freischalten lassen.«
Sara legte den Kopf zur Seite und musterte Ronnie. »Wozu?«
»Das Besondere an diesem Anbieter ist, dass du die Ortung über Internet und Handy laufen lassen kannst. Du bekommst ein Login für die Ortung und kannst entweder übers Internet genau die Bewegung des Handys mitverfolgen oder dir die Straßennamen per SMS schicken lassen.«
Sie zog ihre Augenbrauen zusammen. Wozu sollte sie Jonas’ Handy orten lassen? Er hatte sein Handy so gut wie nie dabei, warum auch? Er war acht Jahre alt und nie alleine unterwegs.
»Schau nicht so skeptisch. Da muss nur eine Redaktionssitzung länger dauern als geplant. Du kennst doch deine Branche.« Er tippte auf den Zettel. »Geh einfach auf die Seite und lies es dir durch. Oder besser, melde uns gleich an, so viel sollte uns die Sicherheit unseres Sohnes wert sein.«
Das Glas in der Hand gab sie mit einem Finger den Suchbegriff Esperanza ein. Sechsundvierzig Treffer.
Sie begann zu lesen.
12. Dezember 23:45 von Esperanza
Hallo,
jetzt ist es so weit. Ich komme gerade aus dem Krankenhaus, sieben Stiche, weil MEIN Mann meinen Kopf gegen einen Türrahmen geschlagen hat.
Wenn er je die Hand gegen mich erhebt, gehe ich. Meine Worte. Gestern noch.
Und, was habe ich getan?
Nichts.
Genau wie die meisten hier, obwohl ich genau weiß, was ich machen müsste.
Jetzt kann ich mich nicht mehr hinter meinen eigenen Ausflüchten verstecken. Ich brauche Hilfe, aber ich habe niemanden, mit dem ich darüber sprechen könnte.
Esperanza
13. Dezember 00:17 von Valeska
liebe esperanza,
du hast nicht »nichts« getan! du hast dich uns geöffnet. das war dein erster schritt in die richtige richtung! ich bin sehr stolz auf dich!
wir sind für dich da. wir können dir helfen. am besten erzählst du uns erst mal etwas mehr über dich.
hab mut!
Valeska