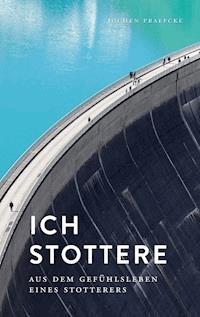
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wie fühlt es sich an zu stottern? Was bedeutet Stottern im Alltag eigentlich? Wie prägend ist es für die Persönlichkeit, ein Stotterer zu sein? Ein Buch über eine lebensbegleitende Konstante, über das Reden und Schweigen, über Leidensdruck und Leugnung, über die eigene Begriffsstutzigkeit und die anderer Leute, über stotternde und nichtstotternde Deppen im Film und im echten Leben, über Freundschaft und Familie, über Klarinetten und Gitarren, über hilfreiche und weniger hilfreiche Bewältigungsstrategien, über Selbstsicherheit, Erfolge und Rückschläge - kurzum: eine Achterbahnfahrt durch das Gefühlsleben eines lebenslänglichen Stotterers, höchst subjektiv und zutiefst unwissenschaftlich. www.ich-stottere.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Kapitel 1: Ein Lebensgefühl
Kapitel 2: Die lebensbegleitende Konstante
Kindergarten- und Grundschulzeit
Unter- und Mittelstufe
Vermeidungstaktiken und ihre Grenzen
Oberstufe und Landsknechte
Der fatale Druck, das Stottern zu verbergen
Abiturprüfungen
Ablenkungstechniken
Die unterschwellige Angst vor dem Stottersupergau
Zivildienst
Berufsausbildung
Das Telefon, Dein ärgster Feind
Studium
Das Stottern offen thematisieren
Lebensbereiche
Berufliche Laufbahn
Sprachkenntnisse: Deutsch und Englisch, beides nicht wirklich fließend
Gute und schlechte Phasen
Erweckungserlebnis beim Logopäden
Kapitel 3: Die Bewältigungsstrategie
Ich stottere - und jeder merkt es
Neue Perspektiven
Selbstvertrauen und Selbstsicherheit
Die Stuntman-Methode
Eine neue Definition von Erfolg
Der Kampf um Gehirnareale
Offen mit dem Stottern umgehen
Die Gefahr richtig einschätzen
Schummeln erlaubt – Akute Situation meistern
Vorträge halten
Vorlesen
Telefonieren
Sich vorstellen
Kapitel 4: Vom Umgang mit Stotterern
Akzeptanz, Toleranz und Ignoranz
Stottern als Behinderung
Offenheit, Interesse und Anerkennung
Humor und politische Korrektheit
Der Depp stottert
Unerwünscht
Was darf’s denn sein, bitte?
Kapitel 5: Ein neues Lebensgefühl
KAPITEL I
EIN LEBENSGEFÜHL
Ich stottere. Das ist der Gedanke, mit dem ich seit Jahrzehnten aufwache. Das erste was mir direkt nach dem Aufwachen morgens in den Kopf schießt. Als müsste ich tagtäglich dafür sorgen, dass ich diese Tatsache ja nicht vergesse - was natürlich blödsinnig ist, weil ich spätestens ein, zwei Stunden später garantiert sowieso das erste Mal stottern werde, also wie sollte ich es je vergessen? Mein Gehirn scheint nicht auf diese Bestätigung warten zu können, will sich nicht darauf verlassen, dass das Stottern tatsächlich auftritt, also erinnert es mich vorsorglich daran. Damit der Gedankengang auch garantiert und unmissverständlich ankommt wird das gleich am Morgen erledigt, als allererstes, mit höchster Priorität. Der Gedanke ist in der Tat sehr einfach formuliert. Es ist nicht die Frage nach dem Warum oder die Frage „Warum ich?“, sondern einfach nur die tagtägliche Bestätigung „ich stottere“ – ja, tatsächlich, immer noch, große Überraschung, es hat sich nicht über Nacht erledigt, es ist keine Spontanheilung eingetreten. Mein Körper und mein Geist scheinen sich irgendwie mit dem Stottern arrangiert zu haben, es ist offenbar zum unverzichtbaren Teil meiner Persönlichkeit geworden. Denn durch diese permanente Bestätigung des eigentlich hinreichend bekannten Umstandes sorgt mein Gehirn ja auch dafür, dass das Stottern überhaupt immer wieder auftritt. Meines Wissens liegt bei mir keine physische Anomalie vor, die das Stottern hervorrufen würde, also keine rettende Operation in Sicht. Im Umkehrschluss wäre es denkbar, dass ich nicht stottern würde, wenn ich schlicht vergessen würde, dass ich stottere. Ein klassischer Teufelskreis. „Denken Sie jetzt nicht an Ihr Stottern“ – haha, selten so gelacht. Das Erste was in den Sinn kommt ist das Konzept der Ablenkung, und tatsächlich basieren viele der Bewältigungstechniken auf genau diesem Konzept – was allerdings nur bedingt hilfreich ist, insbesondere auf Dauer gesehen. Dazu aber später mehr.
Was heißt denn Stottern im Alltag nun genau? „Unflüssig“ sprechen, beim Sprechen hängen bleiben und damit verbunden gewisse Ängste vor gewissen Sprechsituationen? Ja genau, grundsätzlich richtig, das ist das eigentliche Problem. Vorausgesetzt man will am öffentlichen Leben teilnehmen heißt Stottern im Alltag aber auch Dinge tun, die man nicht tun will und Dinge lassen, die man tun will. Sachen kaufen, die man nicht will in Mengen, die man nicht will – mal zu wenig, mal zu viel. Dinge essen, die einen eigentlich gar nicht so richtig anmachen, und dann mehr oder weniger Trinkgeld geben als beabsichtigt. Länger als nötig warten, anstehen, suchen. Sich mehr gefallen lassen als einem lieb ist. Im schlimmsten Fall einen Beruf ausüben, den man nicht will, hinter seinen Möglichkeiten zurückbleiben, Rückzug aus dem sozialen Leben – in anderen Worten: dem Stottern die totale Kontrolle über das eigene Leben überlassen. Unnötig zu erwähnen, dass es genau das unbedingt zu vermeiden gilt.
Ich will nicht den Eindruck erwecken, ich sei durch mein Stottern der ärmste Tropf auf Erden. Das bin ich mit absoluter Sicherheit nicht. Vielleicht werden Gehörlose mein Stottern als Luxusproblem auffassen. Ein Blinder oder ein Epileptiker könnte anführen, seine Teilnahme am sozialen Leben sei weit mehr eingeschränkt. Stottern endet nicht tödlich, ganz im Gegensatz zu vielen Krankheiten, die ich hier nicht aufzählen muss. Außerdem würde ich behaupten, dass ich – jedenfalls heutzutage – eher leicht stottere, also ein „Stottern von relativ sanfter Ausprägung“ habe, wenn auch deutlich und von jedermann wahrnehmbar. Kurioserweise trägt aber eben diese sanfte Ausprägung nicht unerheblich zu meinem Problem bei, wie sich später noch zeigen wird. Jedenfalls gibt es ganz abgesehen von Krankheiten viele absolut nicht erstrebenswerte Lebensumstände in allen Teilen der Welt, und man kann diese relativierenden Gedankengänge unendlich weiterspinnen. Manchmal hilft dies dabei, die Dinge wieder in die richtige Perspektive zu rücken, was wichtig und richtig ist. Letztlich ist jeder aber ein Stück weit in seiner eigenen Realität gefangen und muss sich dem in dieser Realität vorherrschenden Problem stellen. In meinem Fall also dem Stottern. Würde ich es etwa bevorzugen, Einschränkung x oder Krankheit y anstatt des Stotterns zu haben? Vollkommen unerheblich, alle diese Gedankenspiele werden mir das Stottern nicht nehmen, also will ich mich damit eigentlich nicht belasten.
Zurück zur Wurzel meines Übels, dem Stottern, genauer gesagt meiner ganz persönlichen Art des Stotterns. Mein Redefluss bleibt vornehmlich bei Vokalen hängen. Klingt einfach, aber diese Einsicht war tatsächlich eines meiner größeren Aha-Erlebnisse. Bis zum Alter von 28 Jahren war ich der festen Überzeugung, mein Redefluss wäre bei bestimmten Konsonanten gehemmt, z. B. beim J und beim R. Diese Überzeugung rührte unter anderem daher, weil ich zu diesem Zeitpunkt seit ca. 23 Jahren bei unzähligen Gelegenheiten daran gescheitert bin, meinen Namen flüssig mitzuteilen. Warum muss man eigentlich ausgerechnet Jochen Praefcke heißen, wenn man beim J und beim R hängen bleibt? Ach ja, diese Art von Gedanken wollte ich ja vermeiden. Jedenfalls hatte meine Frau mich damals überzeugt, einen Logopäden zu konsultieren, wofür ich ihr unendlich dankbar bin. Im Laufe der Behandlung erfuhr ich, dass ich überhaupt nicht beim J und R hänge, sondern vielmehr bei den Vokalen nach diesen (und anderen) Konsonanten. Ein guter Teil meines Weltbildes war auf den Kopf gestellt, ich hatte tatsächlich 23 Jahre lang Angst vor den falschen Buchstaben. Problem erkannt, Gefahr nicht gebannt, denn Jochen Praefcke bleibt als Namenswahl nach wie vor suboptimal. Und es stimmt, wenn ich Jochen sagen will, sage ich ja nicht nichts, bis endlich das Wort mit „J“ anfängt, sondern sage „J…ochen“ – hänge also beim O nach dem J, nicht beim J. Im Nachhinein betrachtet hätte ich im Laufe der 23 Jahre auch selbst mal darauf kommen können. Zu beachten ist noch, dass es gute und schlechte Konsonanten gibt. Nach eher harten, kurzen Konsonanten (so empfinde ich sie zumindest) wie z. B. dem T und dem P fließen die Vokale deutlich besser, wenn nicht sogar völlig frei. Tochen Paefcke will ich trotzdem nicht heißen, auch wenn ich es vollkommen flüssig sagen könnte. Ich hätte ja 2003 bei der Hochzeit den Geburtsnamen meiner Frau annehmen können, der wäre marginal besser aussprechbar gewesen, aber nicht perfekt. In Wahrheit habe ich das aber damals überhaupt nicht in Erwägung gezogen, da kam wohl der latente Macho durch. Vokale sind außerdem oft auch ganz ohne Konsonant davor ein Problem, also am Wortanfang. Aber warum ist es denn so wichtig, das eigene Stottern so genau zu analysieren, so genau zu wissen, wo man hängen bleibt? Weil gewisse Bewältigungstechniken eben erfordern, dass man das weiß – sonst läuft die Technik schlicht ins Leere. Wie gesagt stehe ich diesen Techniken, über die ich später noch ausführlicher berichten will, teils eher skeptisch gegenüber, auch wenn sie einzelne Problemsituationen entschärfen können und damit sicherlich kurzfristig hilfreich sein können und von mir auch gelegentlich noch angewendet werden.
Im Laufe meines Lebens habe ich eine Möglichkeit gefunden, mit dem Stottern umzugehen und es als Teil von mir zu akzeptieren, was mir deutlich nachhaltiger und tiefgehender als jede situationsorientierte Bewältigungstechnik hilft. Obwohl ich in keiner Weise spirituell bin, mir das esoterische eher fern liegt und ich ein althergebrachter Anhänger der Schulmedizin bin, glaube ich, dass diese Möglichkeit etwas „Ganzheitliches“ hat. Sie hat viel mit Selbstverständnis, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit zu tun. Solche Eigenschaften entstehen nicht spontan von einer Sekunde auf die andere, sondern sind das Ergebnis vieler Einflüsse, die einen über Jahre hinweg formen und prägen.
KAPITEL 2
DIE LEBENSBEGLEITENDE KONSTANTE
Kindergarten- und Grundschulzeit
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals nicht gestottert zu haben. Meinem Empfinden nach habe ich vom ersten Wort an gestottert. Meine Eltern wissen bzw. wussten nicht mehr so genau, wie und wann das Stottern angefangen hat. Ich habe wohl erst sehr spät, mit 3 Jahren, überhaupt mit dem Reden angefangen, aber inwiefern das mit dem Stottern zusammenhängt oder gar dafür ursächlich ist, ist nicht bekannt oder wurde zumindest nie geklärt. Meine Mutter ist sich keines bestimmen Ereignisses bewusst, welches das Stottern sozusagen traumatisch hätte auslösen können. Meine ältesten eigenen Erinnerungen sind aus dem Grundschulalter. Die Kindergartenzeit ist mir nur durch Fotos präsent, aber da kann man halt nicht unbedingt sehen, ob ich schon stotterte oder nicht – vermutlich ja. Während ich mich an allgemeine Dinge wie Namen und Aussehen der Lehrer und Schulkameraden, das Schulgebäude und den Pausenhof erinnere (und leider auch an verhasste Dinge wie Boden- und Geräteturnen), sind Erinnerungen an spezifische Episoden relativ häufig mit dem Stottern verbunden. Die spezifischen Erinnerungen aus diesem Lebensabschnitt, überhaupt bis zum Alter von ca. 30 Jahren, sind ganz überwiegend negativer Art. Hänseleien durch Mitschüler gehörten mehr oder weniger zur Tagesordnung, und vermutlich ist das auch heute bei Kindern in dem Alter noch immer so, dass Kinder, die in gewissem Ausmaß anders sind – Stottern, Lispeln, Pickel, Akne, rote Haare, No-Name-Jeans, die falschen Turnschuhe – ausgegrenzt und gehänselt werden. Es ist wohl kaum auszuschließen, dass ich selbst nicht auch andere Kinder wegen was auch immer gehänselt habe, wenn auch vermutlich nicht wegen irgendwelcher Sprachfehler. Man will ja auch dazugehören. Nicht schön, aber in gewissem Ausmaß auch leider üblich, und größtenteils auch schlicht alterstypisch und der naturgemäß mangelnden persönlichen Reife eines 6 bis 12-jährigen Kindes geschuldet. Ich kenne jedenfalls Erwachsene, denen es heute sehr unangenehm ist, damals auf dem Schulhof andere Kinder so behandelt zu haben. Bei manchen trägt der Reifungsprozess nämlich Früchte, bei anderen nicht. Letztere werden manchmal auch Lehrer, zum Beispiel an meiner Grundschule. An Frau W., meiner Deutschlehrerin (in der 3. Klasse, wenn ich nicht irre), ist besagter Reifungsprozess jedenfalls recht spurlos vorübergegangen. Man erkennt so etwas zuverlässig an Sätzen wie „Jochen, kannst Du eigentlich nicht normal reden?“ oder „Jochen, jetzt tu doch mal normal …“ – natürlich vor der ganzen Klasse, nachdem mir beim Vorlesen aus dem Deutschbuch kein einzig flüssiger Satz gelang. Die Mehrheit der Kinder fand das natürlich unterhaltsam, fühlten sie sich in Ihrem Schulhofverhalten doch gestärkt und bestätigt. Es geht übrigens auch anders: eine Religionslehrerin, deren Name mir entfallen ist, sagte im Unterricht nach einem blöden Kommentar eines Mitschülers zu mir, ich dürfe ihm nun mit Ihrer Erlaubnis eine reinhauen – fand ich besser und habe ich dann auch gemacht. Beide Beispiele zeigen, am jeweils entgegengesetzten Extrem der Skala, dass ein normaler Umgang mit dem Stotterer in der Klasse wohl schwierig war.
Um dies besser einordnen zu können muss man sich vor Augen führen, dass sich all das Mitte der 1980er-Jahre abgespielt hat. Keine Spur der heutigen Achtsamkeitshysterie, Durchtherapiertheit, übertriebenen politischen Korrektheit. Oder es gab das alles auch schon, bloß wurde es mangels Verbreitungsmedium nicht so aufgebauscht. Das wird auch an der Art und Weise, wie meine eigenen Eltern damit umgingen, deutlich. Es wurden zwei oder drei Versuche unternommen, sich dem Stottern in therapeutischer Weise anzunehmen, jedoch nicht mit der notwendigen Vehemenz. Alle logopädischen Behandlungen wurden letztlich sehr frühzeitig abgebrochen – meine Mutter sagt, ich hätte beim Logopäden schlicht nicht gestottert, also quasi wie verzaubert. Das kann ich mir nun beim besten Willen nicht vorstellen, so dass hier vermutlich eine gewisse Verklärung der Tatsachen stattfindet. Außerdem hätte mich eine der damals konsultierten Therapieeinrichtungen wegen allerhand anderer logopädischer Probleme behandeln wollen und hätte ausgerechnet das Stottern als unproblematisch abgetan.
Man hört ja immer wieder, dass man Stottern erfolgreich und dauerhaft therapieren kann, wenn man es bis zu einem bestimmten Alter angeht, also in der Kindheit oder Jugend. Mache ich meinen Eltern Vorwürfe, es damals nicht ernst genug genommen zu haben? Nein, das kann man pauschal so nicht sagen. Man ist mit seinen Kindern damals nicht wegen wirklich allem zum Arzt oder Therapeuten gerannt. Das ist heute grundlegend anders, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann – ich will gar nicht daran denken, wie viele Stunden ich die vergangenen 13 Jahre bei diversen Kinderärzten/ -therapeuten bzw. in deren Wartezimmer verbracht habe. Meine Kinder stottern übrigens nicht, worüber ich sehr erleichtert bin, weil die Angst davor jedes Mal unmittelbar der ersten Freude folgte, nachdem meine Frau mir die frohe Kunde der Schwangerschaft überbrachte. Zum Logopäden mussten trotzdem alle schon – wegen Lispeln, T- und K-Lauten und Schwächen in der Kaumuskulatur oder so ähnlich (gab es diesen Befund im Kindesalter eigentlich 1985 auch schon?). Habe ich eine Garantie, dass die logopädische Behandlung damals erfolgreich gewesen wäre? Ich denke nein. Keine Ahnung, ob sich in der Logopädie in den letzten Jahrzehnten Bahnbrechendes geändert hat, sprich ob man mir damals schon hätte so helfen können, wie man das Kindern heutzutage vielleicht kann. Was bleibt ist halt eine gewisse Unsicherheit, was wäre wenn, hätte man es bloß versucht. Denn: Wäre ich froh, wenn man mein Stottern damals erfolgreich therapiert hätte? Ein deutliches Ja! Aber helfen mir solche Gedankenspiele oder Vorwürfe heutzutage in irgendeiner Art weiter? Nein, ganz im Gegenteil.
Dass meine Eltern das Stottern nicht ernst genug genommen haben, trifft vor allem auf den therapeutischen Aspekt zu. Mein Vater hatte sehr wohl Frau W., besagte Deutschlehrerin, zur Rede gestellt, ohne nennenswerte Konsequenzen im Schulalltag allerdings. Ihre Reaktion war … tja, nennen wir es mal verblüffend: „Sagen Sie mal, sind Ihre Kinder eigentlich das Wichtigste für Sie?“ und „Ich bin ja die Güte in Person“. Auch Herr V., seines Zeichens Klarinettenlehrer an der Musikschule, wurde von meinen Eltern darauf hingewiesen, dass ich für mein Stottern nichts kann. Er hatte mich wiederholt angeherrscht, ob ich denn blöd wäre und warum ich nicht vernünftig reden könne. Ich muss damals ca. 12 Jahre alt gewesen sein. Nachdem ich zu Hause gesagt hatte, dass ich deshalb nicht mehr in den Klarinettenunterricht will, ging meine Mutter ein paar Mal mit zum Unterricht. Überraschenderweise war in diesen Unterrichtsstunden keine Rede von meiner Blödheit, sondern vielmehr von meinem beachtenswerten Talent für das Klarinettenspiel – was übrigens eine dreiste Lüge war (die Idee, ausgerechnet Klarinette spielen zu wollen, stellte sich als einer der größeren Irrtümer meines Lebens heraus). Meine Eltern sind aus heutiger Sicht wohl deutlich zu freundlich mit Frau W. und Herrn V. umgegangen damals. Kaum auszumalen, was heute los wäre in so einem Fall. Skandal, Suspendierung, Berufsverbot, Einsperren und Schlüssel wegwerfen, Shitstorm im Internet! Das will und braucht natürlich keiner. Ich bilde mir aber ein, dass viele Eltern heute wesentlich deutlichere Worte finden würden, und wenn man das in normalem Ausmaß und Tonfall geschieht, ist das auch gut so. Jedenfalls kann ich heute keinen Ton mehr auf der Klarinette spielen (nicht schlimm), flüssig reden kann ich aber auch immer noch nicht (schlimmer).
Unter- und Mittelstufe
Auf dem Gymnasium änderte sich die Situation insofern, als dass mich nie auch nur irgendein Lehrer nachteilig oder blöd wegen meines Stotterns behandelt hätte. Das ist insofern erstaunlich, als dass der Zeitraum ganze 9 Jahre umfasste und dass Gymnasiallehrer meines Wissens in aller Regel keine pädagogische Ausbildung genießen. Die eine oder andere Hänselei durch Mitschüler blieb sicher nicht aus, aber es war nichts hinreichend schlimmes dabei, als dass ich mich jetzt konkret an einen Vorfall erinnern kann. Unverändert schlimm und angstbehaftet waren die typischen Problemsituationen wie das Vorlesen in der Klasse, vom Lehrer aufgerufen werden, und wo weiter. Überhaupt alle Situationen, in denen das Gegenüber genau in diesem Moment erwartet, dass man etwas sagt. Mit dem Vorlesen anfangen, die Antwort auf die Frage geben. Eine ganz neue Herausforderung wartete ab den höheren Klassenstufen auf mich: Referate halten. Alle hören zu, und zusätzlich schauen auch noch alle zu. Stottern ist kein rein akustisches Phänomen, man würde einen Stotterer wohl auch im Stummfilm erkennen, an der angespannten Mimik und den entgleisten Gesichtszügen. Alle starrten und litten, so kommt es mir jedenfalls vor. Im besten Fall litten enge Freunde mit mir. Andere litten vielleicht auch durch meinen Vortrag. Ich selbst dachte auch, was für eine Zumutung, einem wie mir zuhören zu müssen, wie er sich abquält. Wenn einer nicht singen kann, soll er halt nicht öffentlich singen. Kann einer nicht Klavier spielen, soll er halt nicht spielen. Wenn er nicht reden kann, warum um alles in der Welt einen Vortrag halten? Was für ein Schwachsinn, ausgerechnet mich zu bitten, vorne hinzustehen und genau das zu tun, was ich gerade nicht kann. Die anderen Schüler wollen meist übrigens auch kein Referat halten, sind auch aufgeregt, vor anderen Leuten zu reden. Aber sie konnten es, rein handwerklich. Mir hingegen fehlte schlicht das passende Werkzeug.
Vermeidungstaktiken und ihre Grenzen
Um diese Zeit hat die bewusste und unterbewusste Entwicklung von Bewältigungstechniken begonnen – allesamt im Nachhinein und mit heutigem Weitblick als schlecht zu beurteilen, aber halt aus der schieren Not heraus geboren. Zuallererst kommt Vermeidung in den Sinn, also die Problemsituation – den Moment, in dem das Stottern auftritt – von vornherein zu vermeiden. Das ist nicht nur schwierig, sondern auch blödsinnig und teils recht arbeitsintensiv. Spätestens am Tag vor dem anstehenden Referat musste ich bereits anfangen, Bauchschmerzen, Kopfweh oder Grippe vorzutäuschen, zur Steigerung der Glaubwürdigkeit des Schmierentheaters – sowohl zu Hause als auch in der Schule – empfahl es sich, bereits zwei Tage vorher anzufangen, sprich auch den Tag vor dem Referat krankheitsbedingt dem Unterricht fernzubleiben. Außer zwei gemütlichen Tagen im Bett hatte ich natürlich rein gar nichts davon, denn das Referat löste sich wenig überraschend nicht in Luft auf sondern wurde halt ein paar Tage später fällig. Vermeidungstaktiken existierten in unterschiedlichster Form in allen Lebensbereichen, vollkommen unabhängig von Referaten oder anderen Unterrichtssituationen. Das Sprechen per se zu vermeiden bzw. auf ein Minimum zu reduzieren funktioniert schon in gewissem Ausmaß, aber man vereinsamt halt schnell. Bei Unterhaltungen immer nur zuhören, nie eine eigene Meinung kundtun, nicht widersprechen, egal wie abstrus die Behauptung ist. Will man lieber der Stotterer sein, oder der Sonderling, der nie was sagt? Über Jahre hinweg kristallisierte sich ein vernünftiger Mittelweg heraus: nicht gleich losproleten, erst dann was sagen, wenn es sich lohnt und wenn man auch was zu sagen hat. Wenn sich auch die nicht stotternden Menschen so verhalten würden, das halbe Internet wäre leer und die Polit-Talkshow wäre tot. Spaß beiseite, dieser Mittelweg sieht nur auf dem Papier so unglaublich weise und lebensklug aus. In der Praxis sah das natürlich so aus, dass ich sehr oft still war, wenn ich eigentlich was sagen wollte. Hinterher log ich mir dann zurecht, ich hätte reflektiert und dann entschieden, nichts zu sagen, weil es sich nicht gelohnt hat.
Eine weitere Vermeidungsstrategie bezieht sich auf die genaue Wortwahl. Man kann ja ein und denselben Sachverhalt auf unglaublich viele unterschiedliche Arten umschreiben. Die vermeintliche Kunst besteht hier darin, schneller zu denken als man spricht und in der Planung des Satzes die typischen Stolpersteine bereits zu erkennen und blitzschnell durch andere Wörter zu ersetzen.





























