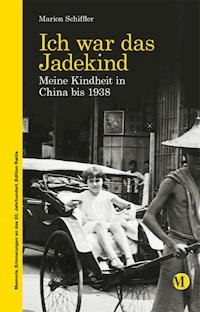
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Raetia
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Memoria Erinnerungen an das 20. Jahrhundert
- Sprache: Deutsch
"In einer kalten Nacht erblickte ich in Kanton, der Stadt der Fünf Ziegen auf der Insel Jisaadou im Perlfluss im Jahr 1924 das Licht der Welt", schreibt Marion Schiffler zu Beginn ihrer Erinnerungen. Die Biografie der Meranerin kann ungewöhnlicher nicht sein: Weil der Vater für den deutschen Großkonzern I.G. Farben (BASF) die Geschäfte in China betreut, verbringt sie die ersten 13 Jahre ihres Lebens in Kanton und in Hongkong. Ihre Kindheit ist gekennzeichnet von der Kolonialkultur - getrennt von der einfachen Bevölkerung, aber trotzdem geprägt von der chinesischen Kultur. Manchmal auch romanartig und märchenhaft schildert Schiffler ihre Erlebnisse inmitten dieser fremden beeindruckenden Welt. Die Zeit in China und Hongkong ist nur ein Teil dieser Erinnerungen: Nach der Rückkehr nach Europa verbringt Marion Schiffler einige Zeit in Meran, erlebt dort die Vorhut der Option und freundet sich mit jüdischen Flüchtlingen an, die in der Kurstadt auf Zwischenstation sind. Den Krieg erlebt Schiffler in Opatija auf der Halbinsel Istrien, die im Herbst 1943 von den Hitler-Truppen eingenommen wird. Ende 1944 kehrt sie nach Meran zurück.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch
„In einer kalten Nacht erblickte ich in Kanton, der Stadt der Fünf Ziegen auf der Insel Jisaadou im Perlfluss im Jahr 1924 das Licht der Welt“, schreibt Marion Schiffler zu Beginn ihrer Erinnerungen. Die Biografie der Meranerin kann ungewöhnlicher nicht sein:
Weil der Vater für den deutschen Großkonzern I.G. Farben (BASF) die Geschäfte in China betreut, verbringt sie die ersten 13 Jahre ihres Lebens in Kanton und in Hongkong. Ihre Kindheit ist gekennzeichnet von der Kolonialkultur – getrennt von der einfachen Bevölkerung, aber trotzdem geprägt von der chinesischen Kultur. Manchmal auch romanartig und märchenhaft schildert Schiffler ihre Erlebnisse inmitten dieser fremden beeindruckenden Welt. Die Zeit in China und Hongkong ist nur ein Teil dieser Erinnerungen: Nach der Rückkehr nach Europa verbringt Marion Schiffler einige Zeit in Meran, erlebt dort die Vorhut der Option und freundet sich mit jüdischen Flüchtlingen an, die in der Kurstadt auf Zwischenstation sind. Den Krieg erlebt Schiffler in Opatija auf der Halbinsel Istrien, die im Herbst 1943 von den Hitler-Truppen eingenommen wird. Ende 1944 kehrt sie nach Meran zurück.
Inhaltsverzeichnis
Thomas Hanifle: Märchenhaftes China
Fünf weiße Eier
Im Grundbass des Lebens
Kantonesische Oper
Geborene Konfuzianer
Meine Plejaden
Vater und Mutter in China
In Europa
Rule, Britannia
Schwester aus Zuneigung
Das Beste hoffen, das Schlimmste erwarten
Chinesische Tugenden
Glückliche Zeiten
Freund Gogo
Bei Familie Wong
Täglicher Kampf
In Kantons Gassen
Chinesische Leckerbissen
Shopping in Hongkong
Sommerfrische in Japan
In der sündigen Stadt
Teutonischer Furor
Vertraute Wallstraße
Zurück im Paradies
Im Haus von Yun Long
Sommer in Qingdao
In der Kaiserstadt
Delikate Mission
Das Mondfest
Reise auf dem Nordfluss
Das Neujahrsfest
Fluss der Zeit
Durch Südchina
„Du bist mein Jadekind“
Fremde Herrscher
Auf der Flucht
Wieder in Hongkong
„Herz-zu-Herz-Freund“
Abschied von China
Letzte Worte
Neuanfang in Europa
Lockrufe aus dem Reich
Nizza der Adria
Deutsche Terrorherrschaft
„Jede Erinnerung ist in Tränen gebadet“
Thoralf Klein: Ein Jadekind im nationalistischen China
Endnoten
Impressum
Märchenhaftes China
Bei ihrer Ankunft am Flughafen von Peking am 15. Juli 2010 trug Angela Merkel einen roten Blazer, die Farbe der Freude und des Glücks im Reich der Mitte. Am Folgetag verkündete sie im Rahmen ihres offiziellen Chinabesuchs gemeinsam mit Premier Wen Jiabao der internationalen Presse, die deutsch-chinesischen Beziehungen auf eine völlig neue Ebene stellen und zur Überwindung der internationalen Wirtschaftskrise stärker zusammenarbeiten zu wollen. Diesmal trug Merkel ein weißes Oberteil. Marion Schiffler sah den Auftritt im Fernsehen und ärgerte sich. Nicht ob der Lippenbekenntnisse, sondern der unzureichenden Kenntnis der chinesischen Kultur der Bundeskanzlerin. „Weiß ist die Farbe der Trauer“, sagt die ehemalige Englischlehrerin aus Meran. Die Episode zeigt ihr einmal mehr, dass sich der Westen nach wie vor zu wenig mit China und seiner alten Kultur befasst – und das, obwohl dieses Land dem 21. Jahrhundert seinen Stempel aufdrückt und drauf und dran ist, die weltweit größte Volkswirtschaft zu werden.
Für Marion Schiffler ist China ihr Leben. Weil der Vater für den deutschen Großkonzern I.G. Farben (BASF) die Geschäfte in China betreute, verbrachte die bald 88-Jährige die ersten 13 Jahre ihres Lebens in Hongkong und Kanton im Süden Chinas: Die Lebenskultur der damaligen britischen Kolonie Hongkong und jener Chinas prägen sie bis heute – und sind auch allgegenwärtig. Das Mobiliar ihrer Wohnung stammt zu einem großen Teil aus ihrem Haus in Kanton, das sie Anfang 1938 nach dem Ausbruch des chinesischjapanischen Konflikts abrupt verlassen mussten. Die Kästen aus dunklem Teakholz zieren typische chinesische Motive. Am Pekingofen, ein schwerer hoher Dreifuß aus Messing, der oben mit einer Platte abgedeckt ist, konnte man sich früher erwärmen. Heute ist er ein Erinnerungsstück aus einer fernen Welt und Zeit. Lediglich die Bücherregale stammen aus Europa. Heute drängen sich darin Klassiker der Weltliteratur in unterschiedlichen Sprachen. Die sehr belesene Frau hält es mit dem Sprichwort: „Je mehr Sprachen du sprichst, desto mehr bist du Mensch.“ Als Kleinkind sprach sie nur Englisch, heute spricht sie neben ihrer Muttersprache Deutsch fließend Italienisch, gut Französisch sowie ein wenig Kroatisch, das sie in Opatija auf der Halbinsel Istrien während des Zweiten Weltkriegs gelernt hat. Dorthin war die Familie nach der Rückkehr nach Europa und einem Zwischenstopp in Aachen und Meran gezogen, um der Naziherrschaft zu entkommen. Ab Ende 1944 kehrten sie wiederum nach Meran zurück. Außerdem beherrscht Marion Schiffler noch ein paar Brocken Kantonesisch, einen der vielen Dialekte in China, zudem etwas Hochchinesisch, das schon in den 1920er-Jahren zur Einheitssprache erhoben und unter Mao Zedong stark gefördert wurde. Trotz aller Verbrechen, für die der chinesische Despot verantwortlich ist, hält Schiffler der Herrschaft Mao Zedongs zugute, dem Land neues Selbstbewusstsein gegeben zu haben. Entschuldigen will sie die Unrechtstaten damit nicht.
Zwar hatte Marion Schiffler in Kanton wenig Kontakt zu der chinesischen Zivilbevölkerung. Die alte Kultur Chinas war in ihrer Kindheit dennoch omnipräsent. Mythen und Geschichten brachten ihr die Weisheiten und Philosophie des Landes nahe und die Dienerschaft typische Verhaltensweisen der Menschen. Die wenigen chinesischen Freunde und Bekannten von damals waren überdies prägend. Die Rückkehr nach Europa war ein Bruch in ihrem Leben, so empfindet es Marion Schiffler noch heute: China ist das einzige Land, in dem sie sich jemals richtig wohlgefühlt hat. Deshalb verspürte sie schon als Heranwachsende ein inneres Verlangen, sich mit ihrem Geburtsland auseinanderzusetzen. Ihre Quellen waren vielmals ihre Eltern, die ihre Kindheit mit Geschichten füllten.
Ihre ersten eigenen Erinnerungen setzen Ende der 1920er-Jahre ein. Danach reiht sich eine Erinnerung an die nächste. Ihre Geschichte klingt wie ein Traum. Auf einer Überfahrt nach Europa weckte sie eines Nachts ihr Vater und zeigte ihr von einem Bullauge aus die italienische Vulkaninsel Stromboli, an der das Schiff gerade vorbeifuhr. Es existiert ein Foto, das sie auf einem Elefanten reitend in Colombo zeigt, der Hauptstadt von Sri Lanka. Auf einem anderen Bild steht sie in hellem Beige gekleidet inmitten von Chinesen auf der Tribüne der Rennbahn von Kanton. Gerade wie man es sehen will, wirkt sie entweder auserwählt oder deplatziert. Beide Bilder sind Teil eines umfangreichen Fotonachlasses ihres Vaters, den sie wie einen Schatz hütet. Die Schnappschüsse geben einen Einblick in das Leben der Familie in einem nur vermeintlich fremden Land. Bilder aus der Zeit in Hongkong sind leider kaum mehr vorhanden. Mit seiner Kamera hat Rudolf Schiffler allerdings auch das Alltagsleben in China eingefangen: Es ist ein touristischer Blick auf Land und Leute, der aber häufig tiefer geht und Stimmungen, ob nun Leid und Armut oder Freude und Ausgelassenheit, einfängt. Die ersten Aufnahmen stammen aus dem Jahr 1913, als für den gebürtigen Aachener das Abenteuer China begann, die letzten aus dem Jahr 1938.
Von ihren Eltern hat Marion Schiffler auch die Liebe zur Musik geerbt, die für sie fast zu einer Ersatzheimat geworden ist. „Mein Vater war ein wunderbarer Tenor“, sagt sie stolz und erzählt eine Anekdote aus ihrer Zeit in Hongkong. Bei einem Kinobesuch stimmte er plötzlich den Tenorgesang Celeste Aida aus der Verdi-Oper Aida an. Frau und Tochter versanken in den Sesseln vor Scham, die anwesenden Besucher klatschten dagegen vor Begeisterung.
Ihre Leidenschaft zur Musik und zu den Fremdsprachen ließ Marion Schiffler lange nach dem Tod ihrer geliebten Eltern, die ihren Lebensabend in Meran verbrachten, in die Erinnerungen an ihre Kindheit einfließen, die sie vorerst in Deutsch und schließlich in Englisch zu Papier brachte, damit auch ausländische Freunde daran teilhaben konnten. All ihre Tugenden bringt sie darin zum Ausdruck: die Menschlichkeit, die ihr ihre Eltern vorgelebt hatten, und all ihr gesammeltes Wissen, das sie selbst erlebt, von ihren Eltern erfahren und sich durch Lektüre beigebracht hat. Es ist ein sehr lesbarer Text voller Eigenheiten, in dem sie auch Stile und Zugänge vermischt. Manchmal lesen sich die Aufzeichnungen wie ein Tatsachen- oder Reisebericht, manchmal wie ein Märchen oder ein Roman.
Fast jedem Kapitel ist ein Untertitel vorangestellt, der aus der Musikwelt stammt und eine Stimmung oder ein Gefühl transportieren soll, das der Autorin wichtig ist. Marion Schiffler hat ihre Erinnerungen zuallererst für sich selbst geschrieben. Deshalb waren einige Eingriffe notwendig, um sie einer größeren Leserschaft zugänglich zu machen. In diesem Sinne erläutern auch Endnoten den Text. Das Nachwort des Historikers und Sinologen Thoralf Klein ordnet die Erinnerungen historisch ein.
Marion Schiffler musste mehr als 40 Jahre warten, um ihr Geburtsland wiederzusehen. Mit einer Reisegruppe befand sie sich in Hongkong, als sich plötzlich die Grenzen zu China öffneten, die bis dahin geschlossen waren. Zweieinhalb Tage verbrachte sie in Kanton und suchte nach Spuren ihrer Vergangenheit, ihr Haus war längst abgerissen worden. Außerdem besuchte sie eine Jadefabrik: Jade ist in China nicht bloß ein Schmuckstein, der künstlerisch weiterverarbeitet werden kann, sondern hat eine tiefe jahrtausendealte symbolische Bedeutung. Kurz bevor die Reisegruppe die Fabrik verließ, schenkte ihr ein junger chinesischer Arbeiter lächelnd ein Stück Jade. Er wusste, dass sie keine Fremde war.
Thomas HanifleSeptember 2012
Fünf weiße Eier
Preludio
In einer kalten Nacht erblickte ich in Kanton (Guangzhou), der Stadt der Fünf Ziegen auf der Insel Jisaadou (Ershadao) im Perlfluss im Jahr 1924 das Licht der Welt. Geheimnisvoll und schicksalhaft zeigte sich der Große Bär am Firmament. Es war zu Beginn der „Schwarzen Schildkröte“, dunkles Symbol des Winters in den chinesischen Sternenkonstellationen, im schwierigen Sternzeichen des Steinbocks, im Monat Poseidon und im Jahre der Holz-Ratte gemäß dem chinesischen Zyklus.1
Mein Vater, der sechs Jahre auf die Ankunft eines Kindes gewartet hatte, befand sich in der „neunten himmlischen Sphäre“ vor Freude und eilte von einer Familie zur anderen in der kleinen ausländischen Enklave, um allen die glückliche Nachricht mitzuteilen. Die Verhaltensweise meines Vaters rief zwar Verwunderung bei seinen chinesischen Freunden hervor, war ich doch nur ein unbedeutendes Mädchen, mit anderen Worten „verlustbringende Ware“, doch bekundeten sie höflich wie immer ihre Anteilnahme an diesem Ereignis. Unsere zwölf Diener schmückten unser Haus aus diesem Grund auch nur in Weiß, der Trauerfarbe, um Mutter und Kind zu empfangen. Für einen Sohn hätte es mindestens hundert rotgefärbte Eier gegeben, die das Leben und die Ewigkeit symbolisierten, während für mich nur ein Körbchen mit fünf weißen Eiern bereitstand. Alles sollte darauf hinweisen, dass der Himmel die Geburt eines völlig nutzlosen Geschöpfes gewährt hatte.
Das vermochte das Glück meiner Eltern über meine Geburt jedoch keineswegs zu trüben. Die chinesischen Freunde, Meister in der Kunst des guten Betragens und beim Verbergen ihrer Empfindungen, verstanden es, ihre wahren Gedanken zu verbergen – und wenn sie sich auch über die Glücksäußerungen meiner Eltern wunderten, so schrieben sie diese Freude der wohlbekannten Exzentrik zu, die selbst den am meisten geschätzten „fremden Teufel“ von Zeit zu Zeit und bei unvorhergesehenen Anlässen überkam.
Sechs Monate später wurde ich von einem durchreisenden protestantischen Missionar getauft. Mein Vater entstammte einer streng katholischen Familie, meine Mutter war gläubige Protestantin. Obwohl ihre Eheschließung nach katholischem Ritus vollzogen worden war, betrachtete mein Vater die Religion seiner Ehefrau als vollkommen ebenbürtig. Und da es die Mutter ist, die ihr Kind großzieht, sollte ich auch ihren Glauben haben. In China fragte sowieso niemand danach, weil man nach den Lehren von Konfuzius2 lebte, der sagte: „Innerhalb der vier Ozeane sind alle Menschen gleich.“3 Das galt auch für meine Eltern. Von einem tiefen Verständnis und Mitgefühl für ihre Mitmenschen beseelt, wussten meine Eltern, dass Toleranz aus geistiger Großzügigkeit resultiert und dass im Gegensatz dazu Ignoranz die Wurzel aller Intoleranz ist. Mein Vater küsste damals meine Füßchen und sagte: „Mögen sie immer nur den rechten Weg gehen“. Für die Chinesen gelten Füße als die Wurzeln des Lebensbaumes.
Im Grundbass des Lebens
Basso Ostinato
Wer im Morgengrauen den Perlfluss aufwärts fährt, wird mit außerordentlichen Eindrücken konfrontiert. Das weitläufige Delta, das mit einem verwirrenden Netz von Flussläufen, Wasserstraßen, Rinnsalen, Verbindungskanälen und offenen Bewässerungsleitungen angelegt ist, führt den Reisenden hin zur großen südlichen Hauptstadt eines Riesenreiches. An den Ufern erblickt man in der Ferne von Gräben und Kanälen durchzogene endlose Reisfelder vor der dunstigen Silhouette hintereinander gestaffelter Hügelzüge. Das riesige Tiefland umfängt den Ankömmling und führt ihn in eine ihm fremde Welt. Der breite, graugelbe Fluss, bleich wie eine sterbende Perle, wird unmerklich enger. An den Ufern, entlang den schlammigen warmen Buchten und sandigen Bänken, entfalten sich noch heute die mit unendlichem Fleiß und unermüdlicher Geduld bebauten Felder, Gemüse- und Obstgärten, Bananenplantagen und Maulbeerhaine. Winzige schmale Barken, das sind mastlose Boote, schaukeln wie vibrierende Striche im ersten Licht des Morgens und werfen die Schatten der stehenden Bootsleute über das Wasser. Es sind die Impressionen „lagunarer“ Landschaften, wie sie die Maler der Song-Zeit (960–1279) unsterblich und einmalig auf Seide verewigt haben – kaum erkennbar und nur angedeutet, in der die Stille und der Frieden des frühen Morgens spürbar sind.
Die Ufer werden flacher und fast verschwommen, die Schattierungen unklar. Leichter Morgennebel ist erkennbar. Ein seltsamer Geruch von Algen, die stechende Beize von feuchtem Holz durchzieht die Morgenlüfte. In der Ferne erahnt man den ersten Herdrauch der Dörfer. Die frühen Laute erwachen, zuerst leise, dann akuter, sonorer und insistenter, bis endlich wie ein Sturzbach das Crescendo der Stadt Kanton sich bemerkbar macht, die erwacht und das Nervensystem des Abendländers strapaziert.
Eine Armada von Flussfahrzeugen – Dampfer, Motorboote, Schlepper, Lastkähne, Dschunken und Sampans – und das Pfeifen der Sirenen, das Tuten und Aufheulen von Signalen strapazieren die Sinneswahrnehmungen. Die Dschunken segeln mit riesigen tabakfarbenen Flügeln vorüber, prähistorischen Sauriern gleich. Dazwischen schaukeln winzige Sampans4, von grazilen Wesen gerudert und mit meist nackten Kleinkindern an Bord. Erst sind es nur sporadische Erscheinungen, dann ein paar Dutzend und zuletzt hunderte, die den Fluss Xijiang5 befahren im täglichen Alltagskampf des tödlichen unerbittlichen Lebens. Inmitten von faulendem Abfall und dem penetranten Geruch von Holzkohlefeuerchen offenbart sich ein Strudel von Menschen, Fahrzeugen und Schmutz, die einen eigentümlichen Reiz ausüben.
Die Sirenen der Fähren und Schiffe erklingen in heiseren lamentösen Tönen, Geschrei erschallt aus den unzähligen schaukelnden Behausungen der boat people: Menschen, die ihr Leben lang keinen Fuß auf festen Boden setzen. Pfiffe der Motorbarkassen sind zu hören, der Heulton der Schlepper inmitten von tausenden menschlichen Stimmen und Lauten vermischen sich mit ohrenbetäubendem Feuerwerksgeknatter irgendeiner traditionellen chinesischen Feierlichkeit.
In kürzester Zeit hat sich das unbeschreibliche Szenarium entwickelt, das die Bühne der Existenz und den Rhythmus des Lebens und der Zeit versinnbildlicht. Über diesem Gewimmel menschlichen Elends singt wie ein basso continuo, im Grundbass, das chinesische Leben: zäh, hartnäckig und unverwüstlich.
Noch ehe der Reisende in der Metropole am Perlfluss angekommen ist, meint er, sich auf einem anderen Planeten zu befinden.
Kantonesische Oper
Basso ostinato continuo
Kanton, auch Guangzhou genannt, ist eine chaotische Stadt, erfüllt von emsiger Geschäftigkeit und einer unendlich flexiblen kommerziellen Ethik. 214 v. Chr. wurde hier von den Truppen des ersten Kaisers Qin Shi Huangdi6, der China vereinte, die Garnisonstadt Panyu gegründet. Sitz eines Vizekönigs zu kaiserlichen Zeiten, wurde diese Stadt zum südlichen Ausgangspunkt eines riesigen Reiches. Sie ist eine rein chinesische Stadt, dort lebte das Volk der Hanchinesen. Der frühe Kontakt zu den Grenzvölkern sowie seine vorteilhafte geografische Lage im Flussdelta hat den Bewohnern der Südmetropole eine eigene Mentalität verliehen. Im Gegensatz zum Norden des Landes war man hier immer schon aufgeschlossener und revolutionärer. Der herbe, konservative Norden registrierte denn auch mit Missbilligung und Misstrauen diese freiheitlichen Tendenzen. Die Südchinesen berufen sich deshalb noch heute auf ein altes Sprichwort: „Der Himmel ist hoch und der Kaiser (in Beijing) weit entfernt.“
Kanton ist eine eigentümliche Stadt am Wendekreis des Krebses, am nördlichsten Breitenkreis, die von äußerst mobilen, aktiven und agilen Menschen bewohnt und von einem eigenen Arbeitsund Geschäftssinn geprägt war. Wie fast jede andere chinesische Stadt bestand Kanton aus einem Mäandergeflecht enger Gässchen und Sträßchen, in denen die verschiedenen Gilden und Zünfte, streng nach Fach und Beruf eingeteilt, arbeiteten und walteten. Alle aber waren durch einen ungeschriebenen Kodex wie in einem bedachtsam austarierten Zusammenspiel miteinander verbunden. Es bestand ein dichtes Netz von Verbindungen und Kontakten, von Schutz- und Berufsvereinen und Protektoren in diesem Labyrinth, diesem emsig arbeitenden Bienenhaus, diesem Dädalusgehäuse, wo jede Nachricht sofort und drahtlos übertragen wurde und kein Geheimnis verborgen blieb und wo gleichzeitig äußerste Verschwiegenheit vor Uneingeweihten herrschte. Alle waren ständig beschäftigt und glitten geschmeidig wie Eidechsen durchs Leben. Doch gönnten sie sich auch Mußestunden mit ihren Lieblingssingvögeln, die sie in schönen Käfigen ebenso wie die geschätzten Singgrillen in geschnitzten Dosen aus Sandelholz spazieren führten.
Die Menschen erfreuten sich aber auch an ihren Kindern und Enkeln, klatschten und plauschten mit Freunden und Nachbarn, genossen die pyrotechnischen Freudenfeuer, die bei Hochzeiten, Geburtstagen und auch Begräbnissen die nähere Umgebung mit ohrenbetäubendem Getöse erfüllten. Sie schienen diesem ungeheuren Krach gegenüber immun zu sein, sie wussten: Nur böse Geister meiden den Lärm.
Ein Concerto grosso des Lebens und des Daseinskampfes spielte hier auf, eine kantonesische Oper von Stimmen, Rufen, Tönen, Singsang – all dies von einer unsichtbaren Regie geleitet, die ausgewogen, intensiv, wachsam und mit einer Prise Anarchie versehen – den Ablauf des Lebens regelte. Untermalt von klangvollem Lachen, vermischt mit klingenden Kaskaden langgezogener Silben ertönte lautstark der malerische Südchinadialekt, das Kantonesische. Kanton ist eine Stadt voller Wasserläufe und Kanäle, amphibienhaft von Inseln und Wohnstätten am Wasser durchzogen. Wer mit der Tür zum Wasser wohnt, hat andere Gefühle als jener, der auf die Straße blickt. Das Tor zum Wasser verbindet ihn mit dem Meer, mit der liquiden Oberfläche des Ozeans, der alle Kontinente letztendlich verbindet.
In dieser seltsamen Stadt am Perlfluss, von der so mancher innovative Impuls ausging und wo positive wie kreative Ideen ihren Ursprung fanden, gab es auch immer einen Kern von Intellektuellen, die den Willen zur Erneuerung und zur Reform besaßen. In der bekannten nahen Whampoa-Militärakademie7 wurden zu jener Zeit junge Männer ausgebildet, deren Namen später im Zuge der Gründung der Volksrepublik und der anschließenden Kulturrevolution auch international bekannt wurden. Meine Eltern lernten sie bei Pferderennen oder ähnlichen gesellschaftlichen Ereignissen kennen, ahnten jedoch nichts von ihrer großen Zukunft. Damals machte vor allem der russische Revolutionär Michail Borodin8 von sich reden, der zum ersten Mal kommunistische Ideen nach China einführte. Der Keim war gelegt, doch niemand glaubte ernstlich daran. Der geschichtliche Prozess jedoch hatte bereits begonnen.
In den Jahren vom Ende des Kaiserreiches bis 1949 wurde das einst so mächtige Reich der Mitte von schweren inneren Krisen bis in seine Grundfeste erschüttert. Revolutionen, Aufstände, Bürgerkriege zwischen rivalisierenden Warlords, politische und militärische Machtkämpfe stürzten China in ein unvorstellbares Chaos und Unglück. Das Riesenreich kam mit den Sezessionsbewegungen und Machtkämpfen von Provinzdespoten und ausländischen Interventionen mit vielen Millionen Toten nie zur Ruhe. 1925 rief Borodin zum ersten Generalstreik in der Geschichte Chinas auf.9 Daraus resultierte der totale Boykott aller ausländischen Firmen und Arbeitgeber. Unsere Diener mussten uns nolens volens verlassen, alle Firmen wurden desertiert. Die kleine deutsche Kolonie bestand aus nur 20 Personen und hatte sich nach dem Krieg in der östlichen Vorstadt Dongshan (Ostberg) niedergelassen, da ihnen die Siegermächte den Aufenthalt auf der internationalen Niederlassung Shamian im Perlfluss verwehrt hatten – nur ihre Büros durften sie dort unterhalten. Angeführt von meinem Vater, der mich auf den Armen hielt, durchquerte diese kleine Gruppe nun die Stadt, um ein britisches Kanonenboot zu erreichen, das sie in Sicherheit bringen würde. Unterwegs wurden wir mit einer aufgehetzten und somit feindselig gestimmten Menschenmenge konfrontiert. Doch mein Vater kannte die Chinesen zu gut, um nicht zu wissen, dass kein Chinese einem Vater mit seinem Kind etwas antun würde. So schritt er gelassen und ruhig voran, und die aufgebrachten Massen wichen entlang des Weges zurück, sodass die kleine Gruppe unbehelligt Shamian erreichen konnte.
Turbulente und tragische Monate standen uns bevor. Sechs Monate währte der Generalstreik, den meine Mutter mit mir in der Sicherheit der britischen Kronkolonie Hongkong verbringen musste. Mein Vater durfte kurz darauf bereits nach Kanton zurückkehren, da die deutschen Firmen vom Boykott ausgenommen waren. Obwohl meine Mutter im renommierten Repulse Bay Hotel mit mir wohnte, gab es keine Diener und, schlimmer noch, kein Wasser. Die Insel Hongkong hat keine Süßwasserquellen, und der Zufluss vom chinesischen Festland war unterbunden worden. Das kostbare Nass musste mit Tankern von Schanghai herbeigeschafft werden und war streng rationiert. Man wusch sich mit Mineralwasser und spülte die Toiletten mit Seewasser. Bei der tropischen Hitze und den sich unweigerlich einstellenden Seuchen wurde die Existenz der Menschen auf eine gefährliche und harte Probe gestellt. Der gesamte Handel kam zum Stillstand, da die Schiffe nicht versorgt werden konnten. Auch die Hafenarbeiter streikten. Die Briten holten Annamiten10 herbei. Im Luxushotel Repulse Bay liefen riesige gierige Ratten herum, und meine Mutter wachte über mich, wie sie es ein Leben lang tun würde. Damals stellte sich auch mein erstes großes Leiden ein – ich erlitt meinen ersten schweren Asthmaanfall. Die grauenvollen Anfälle von Atemnot und würgende Erstickungssymptome gehörten von da an zu meinem täglichen „bitteren Reis“.
Als die schwere Zeit endlich zu Ende ging, konnte meine Mutter wieder mit mir in meine Geburtsstadt zurückkehren. Wir bezogen ein Haus in Kanton, das an jenen Bezirk grenzte, in dem sowjetische Russen lebten, die damals noch versuchten, in China Fuß zu fassen. Eine der Russinnen, sie trug eine Uniform, sprach manchmal heimlich durch die trennende Mauer hindurch mit meiner Mutter. Jeder Kontakt mit Ausländern war den Russen nämlich verboten, doch erzählte diese Frau meiner Mutter, dass auch sie ein kleines Mädchen in Russland zurückgelassen hatte, nach dem sie sich so sehr sehnte.
Auch Weißrussen hatten sich nach der Oktoberrevolution in China niedergelassen, wo sie ein tristes Dasein führten. Mit der Zeit eröffneten sie kleine Restaurants und auch Bäckereien, sodass wir zur immensen Freude meiner Mutter frisches Brot erhielten. Chinesen kennen kein Brot und keine Butter, es gibt keine Rinder im Lande und meine Mutter litt darunter, dass sie auf ihre gewohnten Frühstücksbissen hatte bisher verzichten müssen. Kosaken eröffneten später auch eine Reitschule außerhalb von Kanton. Aber der Kontakt zu den russischen Emigranten blieb immer distanziert.
Die Sowjets jedenfalls zogen bald ab. China gelang es wie immer in seiner vieltausendjährigen Geschichte, die fremden Elemente wieder aus seinem Land zu entfernen. Niemand konnte ahnen, dass diese kurze Episode einst zu dem führen würde, was Jahrzehnte später als Rotchina oder Volksrepublik China in die Annalen eingehen würde. Aber zwischen diesen beiden Daten lagen unerbittliche Jahre des Kampfes.
Geborene Konfuzianer
Intermezzo
China mit seinem traditionell hochentwickelten Selbstwertgefühl, seinem gesunden Pragmatismus, der schon immer ein Teil der Lebens- und Überlebensstrategie der Chinesen war, würde sich immer nur selbst und von alleine zu helfen wissen. In einer so einzigartigen Zivilisation wie der chinesischen waren urtümliche Kräfte am Werk, die sich mit den modernen westlichen Mentalitäten und Instrumentarien nicht bewerten lassen. Die konfuzianische Lehre, das chinesische Wertesystem par excellence, eint alle Chinesen. Jeder Chinese ist und bleibt zeit seines Lebens ein geborener Konfuzianer. Das äußert sich primär in seiner Familienverbundenheit, dem natürlichen Selbstbewusstsein, der Anpassungsfähigkeit, dem Bildungsdrang und einer langfristigen Lebensphilosophie.
Gleichzeitig bildete die Großfamilie ein eng geknüpftes soziales Netz des Gebens und Nehmens. Die starke Betonung der Beziehungsordnung, die bestehende gesellschaftliche Rangfolge ist sozusagen ein Naturgesetz und zeigt sich am deutlichsten in der hierarchischen Struktur der Familie und der streng kodifizierten Gesellschaftsstruktur. Die chinesische Hierarchie ist jedoch nicht pyramidal konzipiert wie im Westen, sondern kreisförmig. Im Mittelpunkt befindet sich der Herr, welcher Kontakte und Beziehungen um sich herum pflegt. Nicht selten steht an Stelle des Herrn auch eine äußerst energische und gestrenge Herrin.
Ein chinesisches Kind zählt, wenn es geboren wird, bereits ein Jahr, genauer gesagt ein sui. Das nächste sui erreicht es nicht am eigentlichen Geburtstag, sondern am chinesischen Neujahrstag. „Zehn Monate hat sie dich in ihrem Schoß getragen, drei Jahre lang wird dich ihre Brust nähren“, heißt ein Sprichwort. Deshalb soll ein Kind tiefen Respekt vor den Eltern zeigen. Eine schwangere Frau wird auf der Straße von Unbekannten zu ihrem Zustand beglückwünscht und geehrt. Sie trägt neues Leben in sich, und es gibt keine falsche Scham angesichts dieses Wunders und der Fruchtbarkeit, die ein Weiterleben garantieren.
Meine Plejaden
Scherzo
Das Leben eines Europäers in China war vorwiegend das Ergebnis seiner Entourage von Dienern, die ihn in jedem Moment seines Tagesablaufs umgaben und diskret überwachten, um aufmerksam seine Wünsche und Anliegen zu erfüllen. Darin sind die Chinesen wahre Meister. Denn im Gesicht eines Europäers – eines „Langnasen“ – liest der Chinese wie in einem offenen Buch, während sein eigenes Mienenspiel nur schwer entzifferbar ist. Nie zeigt er seine innersten Regungen, und wer versuchen wollte, sich gegen ihre sanfte Macht und Manipulation zu stellen, würde seine Existenz nur auf völlig nutzlose Weise komplizieren. Wer jedoch lernte, die Regeln des ungeschriebenen chinesischen Kodex zu akzeptieren, lebte ruhig und sorglos und von häuslichen und anderen Problemen unbehelligt. Außerdem erwarb er sich die Hochachtung der Diener und Mitarbeiter und erhöhte damit sein Prestige. Weise war es daher, diese organisierte Unmündigkeit zu akzeptieren, die einer uralten Kultur entsprang, um nicht die gefürchtete chinesische „passive Resistenz“ herauszufordern, in der die Chinesen wahre Strategen sind und die den Europäer enervieren und die sich nur kontraproduktiv auswirkte. Mein Vater begriff das sehr bald und wurde deshalb hoch geachtet und geliebt.
Teil dieser schweigenden Übereinkunft bildete das System des „squeeze“, bei dem die Diener einen kleinen Teil des Haushaltsgeldes für sich behielten. Diesen bescheidenen Nebenverdienst auf Kosten des Hauses – östlich von Suez allgemeiner Brauch – tolerierte man am besten mit bitterem Schweigen. Beschwerden waren ohnehin unnütz. In unserem Hause gab es später nur noch sieben Diener, anfänglich waren es dreizehn. Jeder von ihnen hatte eine bestimmte Domäne und Aufgabe, je nach Rangordnung und Befugnis. Geschmeidig und gewandt leiteten die Diener den Haushalt, angeführt von Number one boy. Mit Phantasie und Lebensfreude meisterten sie den Alltag und improvisierten da, wo es nötig war. Meine Mutter, die Diener nannten sie Mississi, hatte im Haus nicht viel mehr zu tun, als zu repräsentieren, und zu ihrem Leidwesen durfte sie auch nicht die Küche betreten, wo der Koch als oberste und alleinige Instanz waltete. Er vermochte zwar nur wenige europäische Gerichte zuzubereiten, doch verbat er sich jegliche Einmischung. Gemäß chinesischer Auffassung erlaubte Mississis sozialer Status keinerlei praktische Arbeiten. Mississi ist im Übrigen Pidgin-Englisch, ein Gemisch aus Portugiesisch, Chinesisch und Englisch, dessen sich die Diener bedienten. Meine Mutter war gescheit genug, um nach anfänglichem Widerstand die ungeschriebenen Regeln rasch zu erfassen, die ihr von ihrer Umgebung wortlos, aber hartnäckig diktiert wurden. Ihre häuslichen Belange beschränkten sich auf wenige Ressorts, unter anderem auf die Besprechung der Menüs, den Vorbereitungen von Einladungen, tea-parties, garden parties und dinners sowie die Kontrolle der Ausgaben. Jede Woche legte ihr Number one boy die phantasievoll elaborierten Belege vor, wobei sie seine Berechnungen akzeptieren musste. Wäre meine Mutter selbst einkaufen gegangen, hätte sie für immer ihr Gesicht verloren, eine unverzeihliche Schande, und die verlangten Preise wären wesentlich höher ausgefallen. So fügte sie sich dem wahren Herrn des Hauses. Der war es aber auch, der für die anderen Diener haftete, für ihre Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Effizienz. Chinesen sind absolute Meister in der lautlosen Taktik, die lao maozi, also die alten Behaarten, wie Europäer tituliert werden, nach ihrem Willen zu manipulieren.
Für mich persönlich waren unsere sieben Diener meine Plejaden, meine besonderen Sterne. Durch meine ganze Kindheit hindurch vernahm ich ihre leise flötenden Stimmen, die mit ihren langgezogenen Zwielauten des geschmeidigen Süddialekts sich so stark vom Putonghua, dem Mandarin genannten Hochchinesisch, unterschieden. Auf ihren leisen Stoffschuhen bewegten sie sich wie eine Truppe der kantonesischen Oper. Der Respekt, den mir meine Eltern im Gegensatz zu anderen ausländischen Familien unseren Dienern gegenüber auferlegten, verlieh mir ein wunderbares Verhältnis: Bei ihnen fühlte ich mich geborgen und sicher und kannte keine Angst. Sie bildeten einen überaus vertrauten und integrierenden Bestandteil des sicheren und privilegierten Gewebes meiner Kindheit.
Ich erinnere mich nicht mehr, wann Nü An, das so viel wie friedvolle Frau bedeutet, zu uns kam und meine persönliche Amah, meine Kinderfrau wurde. Aber eines Tages trat sie in mein Leben, gekleidet in ein untadeliges weißes Obergewand und schwarze Hosen aus glänzender Guangdong-Gaze. Zwei sanfte Augen blickten mich aus einem runden Mondkuchengesicht an. Geduldig und ergeben, wie eine wahre Amah es sein sollte, wachte sie fortan über mich mit der Treue eines Hundes, eines Pferdes und wie ein Fisch, denn Fische schlafen nie. Aber auch mit der Hartnäckigkeit ihres Volkes, das mich und andere zu unserem Wohle stets dazu brachte, das zu tun, was sie für richtig hielten und uns nur zum Vorteil und Wohle gereichte.
Vater und Mutter in China
Ombra mai fu
Mein Vater war das elfte und jüngste Kind seiner Eltern, in Aachen geboren und aufgewachsen. Als er mit 18 Jahren den Militärdienst absolvieren sollte, bat er seinen Vater, einen Mann wie ein biblischer Patriarch, um Erlaubnis, ins Ausland zu gehen, da ihm alles Militärische verhasst war. Er ging nach Mailand, wo er zwei Jahre lang arbeitete und gut Italienisch sowie Meneghin, den Mailänder Dialekt, erlernte. Dann kehrte er mit einem ärztlichen Attest in seine Heimat zurück, in dem ihm von einem italienischen Arzt bescheinigt wurde, schwache Lungen zu haben. So entging er dem Wehrdienst. Nach einer dreijährigen Lehrzeit beim Chemieunternehmen BASF wurde er mit 23 Jahren im Jahre 1913 nach China geschickt, und zwar nach Schanghai. Da meine Mutter Vollwaise war und ihr Vormund ihr bis zu ihrer Volljährigkeit eine Heirat nicht gestatten wollte – auch um zu sehen, wie sich mein Vater im fernen China bewähren würde – wartete sie das Jahr 1914 ab: ein fatales Jahr, wie sich erweisen sollte. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, wurden alle deutschen Männer in China zur deutschen Kolonie Kiautschou11 gesandt, wo sie die Hafenstadt im Osten Chinas gegen die Japaner verteidigen sollten – einzig mein Vater, da wehruntauglich, blieb in Schanghai zurück, um die Geschäftsinteressen sowie die Ehefrauen und Kinder der eingerückten Gatten und Väter zu betreuen.
Vier Jahre hörten mein Vater und meine Mutter nichts voneinander. In dieser Zeit hatte mein Vater trotz der offiziellen Feindseligkeiten eine Liaison mit einer französischen Witwe und flirtete zugleich mit einer hübschen Engländerin. Er war ein sehr schöner Mann, der Frauen hoch ehrte, ein geborener Feminist schon damals, als dieser Ausdruck noch nicht aufgekommen war.
Nach dem verlorenen Krieg wurde er wie alle anderen Deutschen auch repatriiert und fuhr sofort zu meiner Mutter. Sie schlossen den Bund der Ehe im Sinne des „animus manendi“, wie die Juristen es ausdrücken, und lebten fortan treu und monogam wie ein Storchenpaar. Während der Trauung wurde auf Wunsch meines Vaters das Largo von Händel aus dem „Xerxes“ gespielt, eine seiner Lieblingsarien, und „Ombra mai fu“ stand über ihrem Eheglück.





























