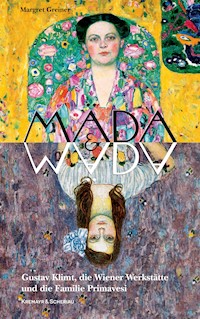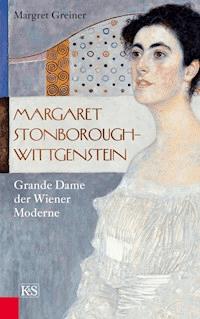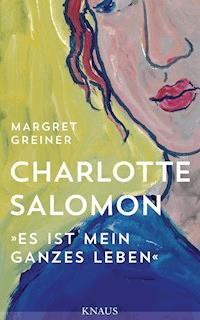Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Friederike Maria Beer (1891–1980): Wie ein Wirbelwind trifft sie auf die Wiener Künstlerszene der 1920er Jahre. Die Tochter der Besitzerin der berühmten Kaiserbar nimmt Schauspielunterricht, wird zum lebenden Modell für die Kleider der "Wiener Werkstätte". "Fritzi" verliebt sich in den Industriellensohn und Maler Hans Böhler, mit dem sie eine lebenslange innige Freundschaft und Arbeitsbeziehung verbindet. Ihm steht sie als Siebzehnjährige Modell für sein Bild "Stehender weiblicher Akt". In den Jahren 1914 und 1916 malen Egon Schiele und Gustav Klimt Porträts von ihr, ein geplantes Bild Kokoschkas fällt den Kriegsereignissen zum Opfer. Ihr Herz jedoch erobert der italienische Kapitän Emanuele Monti – ihm folgt sie auf die Insel Procida im Golf von Neapel. Doch schnell ist das Eiland zu eng für die junge Frau, die Ehe scheitert. Die Begegnung mit dem amerikanischen Studenten Hugh Stix verändert ihr Leben: Mitte der 1930er Jahre wandert Federica nach New York aus. Dort leitet sie bis 1962 die von Stix gegründete "Artists' Gallery", die u.a. Willem de Kooning, Louise Nevelson, Ad Reinhardt entdeckt und fördert. Und nicht nur das – als Galeristin hilft Beer-Monti österreichischen Künstlern wie Max Oppenheimer, auf der Flucht vor den Nazis in die USA zu emigrieren. Margret Greiner folgt mit Verve den Lebenslinien einer emanzipierten, selbstbewussten Frau auf ihrem Weg vom lebensfrohen Künstler-Groupie zur international angesehenen Galeristin und Förderin avantgardistischer Kunst – eingebettet in die großen Ereignisse des 20. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Margret Greiner
„ICH WILL UNSTERBLICH WERDEN!“
Friederike Beer-Monti und ihre Maler
www.kremayr-scheriau.at
eISBN 978-3-218-01198-3
Copyright © 2019 by Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & Co. KG, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Schutzumschlaggestaltung: Christine Fischer
Unter Verwendung eines Fotos von picturedesk.com/IMAGNO
Lektorat: Paul Maercker
Satz und typografische Gestaltung: Sophie Gudenus
Malerei ist Ankommen an einem anderen Ort.
FRANZ MARC
Für Wilhelm Rasinger
INHALT
PROLOG
A BANKERT
AMOR VINCIT OMNIA
GESCHÄFT IST GESCHÄFT
HIMMEL, HÖLLE, FEGEFEUER
DIE KUNST-EXPERTIN
UND ALLES FLEISCH, ES IST WIE GRAS,
KAISERBAR
KOPF AUF DEM TABLETT
STEHENDER WEIBLICHER AKT
VERBANNUNG
AB NACH BRÜSSEL
JETZT BIN ICH FREI!
INTERLUDIUM
DIE WELT ZU FÜSSEN
DIE WELT IN DEN FÜSSEN
HEIMWEH UND ANDERE KRANKHEITEN
SYMPHONIE AUS DER NEUEN WELT
IN DER SCHWEBE
DIE KUNST IST LANG, DAS LEBEN KURZ
UNSTERBLICHKEIT
KALTE DUSCHE
AM ATTERSEE
KATASTROPHEN
DASS ALLES GLEITET UND VORÜBERRINNT
DAS STEMPELFRÄULEIN
FANTASIE
IN DIE TIEFE
DES MEERES UND DER LIEBE WELLEN
MIT ROSEN BEDACHT
AUF PROCIDA
ZUM KATER HIDDIGEIGEI
WIEDER IN WIEN
CLOVER CLUB COCKTAIL
AUFBRUCH
IHRE SEELE NIMMT IMMER PEDALE
DER BARON
„ANSCHLUSS“ UND AUSSCHLUSS
MOPP
NEW YORK, NEW YORK
AUFGEHEIZTE ZEITEN
WHO DID IT?
ENDE EINER ÄRA
„ENDSTATION“
ZEITTAFEL
LITERATURVERZEICHNIS
HERZLICHER DANK
PROLOG
Es langt!“ Sie schrie es mehr, als dass sie es sagte. Mit großer Geste riss sie die Leinwand von der Staffelei, sie musste mit beiden Händen zupacken, stürzte zum Ausgang und lief, soweit das sperrige Stück es erlaubte, im Sturmschritt auf die einige Häuser weiter wartende Autodroschke zu. Sie hatte den Wagen mit Bedacht gewählt, er war groß genug, um das Gemälde darin zu verstauen. Denn das Bild maß 130 mal 168 Zentimeter: Lebensgröße.
Sie schaute sich nicht um, atmete heftig, als sei die Luft in Hietzing dünn geworden, erwartete, dass der Maler hinter ihr herlief oder -rief, sein Gemälde zurückverlangte. Aber alles blieb still in der Feldmühlgasse, nur die vielen Katzen waren aufgeregt nach allen Richtungen in den Garten gestoben, die furiose Frau war ihnen nicht geheuer.
Der Fahrer kam mit dem Rangieren der überdimensionierten Leinwand nicht zurecht, verkantete das Bild immer neu, schob es durch die Beifahrertür auf die hinteren Sitze. Schließlich hatte er es so verstaut, dass kein Platz für sie übrig blieb, sie musste sich auf ihrem Sitz halb unter die Leinwand ducken, ihr gemalter Kopf lag auf ihrem realen. Sie fühlte sich wie eine Kriminelle, die soeben die Kronjuwelen aus dem Tower geraubt hat.
Der Fahrer kannte die Adresse ihrer Wohnung in der Laimgrubengasse 4. Gott sei Dank redete er nicht, fragte sie nicht aus, sagte nichts zu dem Bild, nichts zu ihrer merkwürdigen Kleidung, hatte sie ihre Kostümierung doch anbehalten, ihre Alltagskleidung einfach nur von der Chaiselongue gerafft und über die Schulter geworfen. Mit der Gelassenheit eines Mannes, der schon viele Verrückte gesehen und gefahren hat, schloss der Chauffeur die Wagentür. Hüllte sich in Schweigen, kein Wort über Gott und die Welt, den Krieg an der Front und die Misere in der Heimat. Und schon gar nicht über Kunst oder Künstler.
Obwohl dieser Maler in Wien nicht ausschließlich in Kreisen von Kunstkennern bekannt war. Hatte durch Ausstellungen, aber auch durch handfeste Skandale hinreichend auf sich aufmerksam gemacht. Aber die Zeit, in der jeden Monat ein Foto von ihm in den Tageszeitungen erschien, war vorbei. Mitten im Krieg gab es brennendere Themen und wichtigere Personalien.
Sie hatte über fünf lange Monate erduldet, dem Maler Modell zu stehen, dreimal die Woche drei Stunden. Hatte den Garten in der Feldmühlgasse in herbstlichen Farben leuchten, in Schnee und eisiger Kälte erstarrt, im Frühjahr im ersten Bluste auferstehen sehen. Während draußen in der Welt der Krieg wütete, war in diesem abgelegenen Winkel die Zeit zum Stillstand gekommen, die Welt in ein hermetisches Reich verwandelt, in dem Öl und Terpentin regierten. Und ein stummer Mönch vom Orden der schweigenden Barfüßer hinter einer Staffelei verschwand.
Der Maler, der so gerne mit Händen und mit Worten gerauft hatte, war merkwürdig ruhig geworden. Wie ein Monolith stand er in seinem Atelier, ohne ein Wort zu sagen, gab nur manchmal Laute von sich, die einem Grunzen ähnelten. Ab und an legte er den Pinsel aus der Hand, schnappte sich eine Katze, die durchs Atelier schlich, hauperlte sie mit feinen Strichen gegen das Fell. Oder er ging in den Vorraum, wo junge Modelle warteten. Und strich vermutlich die gegen das Fell.
Wenn sie sich, dankbar für die Ablenkung, aus der Starre des unbewegten Stehens für einen Augenblick lösen und die eingefrorenen Glieder auftauen wollte, motschkerte er: „Bleib, wie du bist! Wie soll ich jemals an ein Ende kommen, wenn du so herumhüpfst.“
Wie sollte er jemals an ein Ende kommen – genau das hatte sie sich Woche um Woche gefragt. Er bestand gnadenlos auf Pünktlichkeit und absolutem Gehorsam gegenüber seinen Anweisungen. Wenn sie erschöpft nach Haus wankte, rechnete sie die Stunden aus, die sie ihm als Modell zu Willen war, rund zweihundert Stunden der Qual, der Fron, der Tortur hatte sie durchgestanden.
Von Klimt gemalt zu werden war die Krönung ihres jungen Lebens, die sie erträumt und erkämpft hatte. Aber jetzt war es genug. Schluss. Aus! Finita la commedia! Das Bild war schon signiert. Es war fertig. Das hatte sie beschlossen und den Coup seit Wochen vorbereitet: ihm einfach das Bild zu entreißen und damit zu verschwinden. Natürlich würde er protestieren, geharnischte Briefe schreiben, vielleicht mit einem Anwalt drohen – alles war möglich.
Aber erst einmal war es ihr gelungen, mit dem Bild zu entkommen. Der bei der Autofahrt gekrümmte Hals würde tagelang schmerzen, sich aber von selbst wieder aufrichten, wenn sie auf ihr Porträt schaute, auf das Meisterwerk des größten Malers ihrer Zeit. Dass es ein Meisterwerk sein würde, stand außer Frage.
Der Maler indes schrieb keine wütenden Briefe: Er schrieb überhaupt keine Briefe, er schrieb eine Rechnung. Nicht ihr, sondern ihrem Liebhaber, der das Bild in Auftrag gegeben hatte. Die Forderung war gesalzen – für das Honorar von zwanzigtausend Kronen konnte man eine hübsche Wohnung im 7. Bezirk kaufen.
Sie würde ihn im Atelier besuchen, sich bei ihm bedanken, sich mit ihm aussöhnen. Nicht sofort, in ein paar Wochen vielleicht.
Der Maler war ein Monstrum, aber immer noch ein göttliches.
A BANKERT
A Bankert“, sagten die Verwandten, die in den Kinderwagen blickten. „A fesches Bankert.“
Das klang mehr feststellend als hämisch, es kam ja oft genug vor. So ganz schlimm war es nicht: hatte dieses Kind doch einen Vater, auch wenn dieser nicht mit der Mutter verheiratet war. Wie viele Kinder kamen in Wien vaterlos zur Welt, ohne Chance, jemals an einen solchen zu gelangen.
Das Bankert wurde am 27. Januar 1891 in Wien geboren und auf den Namen Friederike Maria Geissler ins Register eingetragen. Keine Taufe. Die Mutter, Isabella Geissler, ein katholisches Dienstmädchen, war aus Salzburg nach Wien gekommen. Der Vater, Emil Beer, stammte aus einer jüdischen Familie, die aus Ungarn eingewandert war, Geschäftsmann im elterlichen Textil-handel. Ein „unebenes“ Paar, sagten die Leute. Ein Paar, bei dem nichts stimmte, außer einem: der Liebe. Die war innig und wetterfest und trotzte allen Stürmen, die das Leben reichlich bereithielt.
Als Friederike ein junges Mädchen von zwölf, dreizehn Jahren war, wollte sie von ihrer Mutter Isabella immer die Liebesgeschichte der Eltern hören. Auch wenn sie sonst eher gegen ihr bürgerliches Zuhause rebellierte, wurde sie ganz still, nachgerade andächtig, wenn sie erfuhr, wie diese beiden Menschen, denen sie ihre Existenz verdankte, sich gefunden hatten.
Isabella, ihre Mutter, war im wahrsten Sinne des Wortes in Wien eine Zugewanderte. Hatte sich doch das elfjährige Mädchen im Jahr 1877 von Salzburg aufgemacht, mit nichts als etwas Unterwäsche und ein paar kleinen Geldstücken im Gepäck, um nach Wien zu laufen. Dreihundert Kilometer zu Fuß. Ihr Onkel, der hochwürdige Salzburger Erzbischof, hatte dem Mädchen eine Liste mit Unterkünften bei Nonnen mit auf den Weg gegeben und ihr wie ein wertvolles Geschenk die Adresse eines entfernten Cousins in Wien überreicht, dem er das Mädchen anempfohlen hatte. Zwar hatte der hochrangige Beamte, Regierungsrat Dr. Karl Sinnhuber, eher kühl auf das Ansinnen reagiert, sich um das Mädchen zu kümmern. Er habe bereits eine Haushälterin und zwei Dienstmädchen, sein Junggesellenhaushalt sei damit ausreichend ausgestattet, aber er werde sich umhören, wo das junge Ding gebraucht werden könnte.
Der Onkel Bischof hatte die Nichte Isabella offensichtlich ins Herz geschlossen, war sie doch ein aufgewecktes Mädchen, das ihn mit ihren klugen Fragen überraschte. Auch wenn er sie oft zurechtweisen musste, grenzten manche Bemerkungen doch an Häresie: „Also, wenn ein Vater seinen Sohn liebt, lässt er ihn doch nicht freiwillig kreuzigen, oder?“
Der Vater war kaiserlicher Forstbeamter. Das hörte sich gut an, aber das Gehalt war niedrig. Der Hof in der Nähe von Salzburg, auf dem er mit seiner Frau und den vierzehn Kindern lebte, warf nichts ab außer dem selbstgezogenen Gemüse. Es reichte hinten und vorne nicht, die große Familie zu ernähren.
Isabella hatte die sechsjährige Volksschule beendet, sie hätte jetzt als Magd auf einen Hof oder in einen Haushalt gehen müssen. Auf einen Bauernhof wollte sie nicht, begüterte Familien, die sich Dienstpersonal leisten konnten, gab es im Salzburger Land nur wenige.
„Ich gehe nach Wien!“, hatte Isabella schon mit acht Jahren verkündet, auch wenn sie sich keine Vorstellung von der Stadt machen konnte. Die Eltern ließen sie ziehen. „Wenn es jemand schafft, dann Isabella“, sagten sie, als das Kind sein Ränzel schnürte und Abschied nahm.
Sie brauchte einen vollen Monat. Tagsüber wanderte sie, nachts schlief sie in Heuschobern oder am Straßenrand. Sie wollte nicht in Nonnenklöstern übernachten. Vielleicht behielten die ehrwürdigen Schwestern sie gegen ihren Willen hinter ihren Mauern und steckten sie in eine Tracht mit Flügelhaube.
Nach dreißig Tagen kam sie in Wien an, braungebrannt, müde und ohne einen Kreuzer. Sie riss die Augen auf und konnte sich nicht sattsehen an den prachtvollen Straßen, Plätzen und Palästen. Auch in Salzburg gab es imposante Kirchen und Häuser. Aber kein Vergleich zu Wien. Dreimal umrundete sie die Hofburg, lief aufgeregt hin und her, verlor sich in den weitläufigen Flügeln und Trakten, fand durchs Schweizertor wieder hinaus. „Hier regiert unser Kaiser Franz Joseph“, sprach sie eine Dame in langem Kleid und mit einem federgeschmückten Hut an. Glaubte wohl, ein Kind vom Lande belehren zu müssen. Als hätte Isabella in der Schule nicht aufgepasst!
Dann machte sie sich auf, die Ungargasse zu suchen, die Adresse, die der Onkel ihr mitgegeben hatte. Fragte schüchtern nach dem Weg; am liebsten wandte sie sich an junge Mädchen, die wie Dienstmädchen ausschauten, aber die hatten alle keine Zeit und fertigten sie kurz ab: „Nimm die Bim!“ Die Pferdetramway war offensichtlich der Stolz aller Wiener. Wahrscheinlich brauchte man eine Fahrkarte. Sie hatte aber kein Geld. Und wie hätte sie sich zurechtfinden sollen, welche Tram die richtige war, wo sie aussteigen sollte? So fragte sie unbeirrt weiter nach dem Fußweg.
Es war schon Abend, als sie in der Ungargasse eintraf. Das Haus, in dem der unbekannte Onkel Regierungsrat wohnte, wirkte vertrauenerweckend, ein fünfstöckiger Bau mit gelbem Anstrich und reich verzierter Fassade. Als sie auf dem Klingelschild den Namen Dr. Sinnhuber entdeckte, war ihr vor Erleichterung zum Weinen zumute. Ihre Wanderung hatte ein Ende. Heute war die erste Nacht nach einem Monat, in der sie in einem richtigen Bett schlafen würde. Oder wenigstens auf einer Decke auf dem Fußboden. Nicht mehr im Freien.
Zuhause gab es keine Klingeln. Auf dem Land standen die Haustüren Tag und Nacht offen. Oder es gab Klopfer aus Holz oder Metall, die an einem Brett neben der Tür hingen. Damit die schwerhörigen alten Leute mitbekamen, wenn jemand ins Haus kommen wollte.
Sie drückte die Klingel. Nichts rührte sich. Ob sie etwas falsch machte? Ob der Messingknopf gar nicht gedrückt, sondern herausgezogen werden musste? Sie versuchte es vergebens. Drückte gegen die schwere Holztür. Die blieb verschlossen wie die Paradiespforte für den Sünder. Am liebsten hätte sie sich auf das Trottoir vor die Tür gesetzt und einfach gewartet. Vielleicht war der Onkel Sinnhuber zum Nachtessen ausgegangen und kam bald zurück. Aber die Haushälterin könnte doch aufmachen!
Irgendwann öffnete sich die Tür, ein älteres Paar trat heraus, feingemacht, als wolle es ins Theater gehen. Die Frau roch stark nach Parfüm. Sie schaute das Mädchen durchdringend an, das so merkwürdig verloren vor dem Haus herumstand. „Was machst denn du hier?“, fragte sie. „Wir sind spät dran“, wollte der Mann sie fortziehen. Aber Isabella sagte schnell: „Ich will zu meinem Onkel, dem Herrn Doktor Sinnhuber. Ich bin aus Salzburg gekommen. Darf ich am Gang auf ihn warten?“
Da blieb auch der Mann stehen und schaute das Kind an. Das Sprechen überließ er seiner Frau. Der hatte es aber die Sprache verschlagen. „Aber Kinderl, weißt du denn nicht?“, brachte sie schließlich heraus. „Der Doktor Sinnhuber ist vor einer Woche gestorben. An einem Schlaganfall. Wir haben ihn heute Morgen beerdigt.“ Isabella schaute die Frau ungläubig an, dann drehte sie sich abrupt um und fing an zu laufen. Lief und lief, als ginge es um ihr Leben. Hörte nicht, wie die Frau hinter ihr herrief: „Aber wo willst du denn hin?“
Die erste Nacht in Wien verbrachte sie unter einer Bank in einem kleinen Park, die nächste versteckte sie sich hinter Grabsteinen auf einem Friedhof, das erschien ihr sicherer. In der dritten kam ein Gendarm und scheuchte sie davon. „Ich brauche eine Stellung“, sagte sie. „Aber du bist noch ein Kind, geh’ nach Hause!“ – „Ich habe kein Zuhause, ich will arbeiten!“ – „Geh nach Hause“, sagte der Gendarm eindringlicher, „ich weiß, wo du hier endest.“ Isabella hatte keine Ahnung, was er meinte.
Sie lief davon, wusste nicht, wo sie war, die Straßen waren leer und dunkel. Wenn einsame Zecher durch die Straßen torkelten, versteckte sie sich im Schatten eines Hauseingangs. Irgendwann blieb sie müde im Torbogen eines Hauses liegen und wachte erst auf, als es schon hell war und eine alte Frau sie ansprach: „Geht es dir nicht gut, Kinderl?“ Isabella strich ihr Kleid glatt und drehte sich um.
Schon Tage zuvor hatte sie am Opernring ein großes Gebäude mit dem Schild „Polizei“ gesehen. Sie fasste sich ein Herz und ging schnurstracks hinein. Kam in eine Amtsstube, in der zwei Beamte an gegenüberliegenden Schreibtischen arbeiteten. Einer drehte sich sehr langsam zu ihr um: „Hast du deine Mama verloren?“, fragte er.
„Ich brauche Hilfe, ich suche eine Arbeit.“
„Dazu bist du viel zu jung.“
„O nein“, widersprach Isabella heftig. „Ich bin auf einem Bauernhof großgeworden, ich kann zupacken.“
„Das mag schon sein, aber es ist gegen das Gesetz. Kinderarbeit ist abgeschafft.“ Über die vielen Ausnahmen sagte er lieber nichts.
Isabella aber ging nicht, als der Polizist sie hinauswinkte. „Komm einmal mit!“, sagte schließlich der ältere Kollege und ging mit ihr an der Karlskirche vorbei in die Alleegasse. Wenn der mich in ein Waisenhaus stecken will, lauf ich weg. Schneller als dieser dicke alte Mann bin ich auf jeden Fall, dachte Isabella. Aber der Polizist hielt an einem Haus, an dem ein Messingschild auf eine Vermittlungsstelle für Hausangestellte hinwies. „Versuch dein Glück!“, mit diesen Worten verschwand er.
In einer Schlange standen mehr als ein Dutzend junger Mädchen und Frauen. Mit Sicherheit war sie die Allerjüngste. Hinter dem Schranken thronte ein Beamter mit ausdruckslosem Gesicht. Als sie an der Reihe war, sagte er mit einer Stimme, die gefährlich leise klang: „Wir vermitteln keine Kinder!“ und signalisierte, sie möge verschwinden. Wischte sie mit einer Handbewegung weg, als wäre sie ein lästiges Insekt. „Ich bin fünfzehn“, log Isabella tapfer. Der Mann sah sie durchdringend an und schüttelte den Kopf. Isabella blieb stehen, als wolle sie in diesem Raum festwachsen. Der Beamte schien zornig zu werden, drehte den Kopf und rief durch die geöffnete Nebentür einen Namen. Sofort erschien eine kräftig gebaute Frau mit resolutem Blick und straff aus dem Gesicht gekämmten Haaren. Die nimmt mich jetzt an beiden Armen und schleift mich mit Gewalt hinaus, erwartete Isabella. Die Frau nahm sie aber nur an einem Arm, beinahe behutsam, führte sie in ein anderes Büro, schloss die Tür, hörte sich unbewegt Isabellas Geschichte an. Stellte nur eine Frage: „Durch welche Orte bist du auf deiner Wanderschaft von Salzburg nach Wien gekommen?“ – „Neumarkt, Vöcklabruck, Kremsmünster, Bad Hall, Steyr, Amstetten, Melk, St. Pölten …“ Die Frau gebot ihr Einhalt, holte ein Blatt Papier aus einer Schublade und fing an zu schreiben. Das dauerte eine Weile. Isabella saß auf dem Sessel wie auf einem Arme-Sünder-Stockerl, ganz vorn auf der äußersten Kante, als hätte sie kein Recht, die ganze Sitzfläche einzunehmen. Die Frau faltete das Schreiben, steckte es in einen Umschlag, adressierte und drückte mit einem solchen Aplomb einen Stempel auf die Rückseite, dass Isabella erschrocken aufsprang. „Geh zu dieser Adresse, vielleicht hast a Masn.“ Schon war die Frau durch die Tür verschwunden. Isabella hatte nicht einmal „Danke“ sagen können. Wenn es denn etwas zu danken gab.
Das gab es, denn mit der offiziell beglaubigten Empfehlung kam Isabella Geissler als Küchenmädchen in einen vornehmen jüdischen Haushalt. Sie schälte Kartoffeln und schnitt Zwiebeln, entkernte Zwetschken und dörrte Äpfel, reinigte den Herd mit Scheuerpapier und Sand, walkte Wäsche und schrubbte die Böden. Die feinen Herrschaften sah sie fast nie. Das Regiment der Köchin war streng. Aber Isabella hatte ein Dach über dem Kopf, eine schmale Schlafkoje im Zimmer der Mägde und genug zu essen. Ihren Eltern schrieb sie die neue Adresse, welch ein Glück, sie habe eine Stellung gefunden.
Ihr Onkel, seine Exzellenz Franz Albert Eder, schrieb zurück, lobte ihren Eifer und ermahnte sie, fromm und tugendhaft zu bleiben. In jeden Brief legte er eine ganze Krone. Sie drehte die silberne Münze in der Hand: Auf der Vorderseite war der Kaiser Franz Joseph mit Lorbeerkranz abgebildet. Der Onkel erwartete wohl, dass die Nichte für die Aussteuer sparte.
Doch sie ging mit anderen Dienstmädchen in den Prater und gab das Geld für Schleckereien und Karussell aus.
Sie war geschickt im Haushalt und stieg vom Küchenmädchen auf, kam ins Bügelzimmer, wo sie für Bettwäsche und Handtücher verantwortlich war. Alles musste blütenweiß und auf Kante gebügelt sein. Für die Leibwäsche der Gnädigen Frau und des Gnädigen Herrn war eine ältere Magd zuständig, diese Wäsche war sakrosankt, daran hätte man ein junges Mädchen nicht herangelassen.
Aber man konnte auch als Dienstmädel Karriere machen. Isabella hatte die ersten Stufen dieser Leiter erklommen.
AMOR VINCIT OMNIA
Ihren Vater fragte Friederike nicht, wie er die Mama kennengelernt hatte. Männer erzählten ja ohnehin keine Liebesgeschichten, und schon gar nicht die eigenen. Ihr Vater Emil war freundlich zu jedermann, geschäftstüchtig, großzügig, aber diskret und verschlossen, wenn es um seine persönlichen Angelegenheiten ging. Er hätte wohl belustigt die Brauen gehoben, wenn seine Tochter ihn nach seinem jugendlichen Liebesleben ausgefragt hätte, und sie mit einer ironischen Bemerkung abgefertigt.
Aber ihre Mutter sprach bereitwillig über die Romanze, die in ihren Anfängen alles andere als rosig gewesen war.
Im Prater liefen die Burschen immer den Mädeln nach, das war eine Hetz. Manchmal spendierten sie ihnen eine Limonade, dann setzten sie sich zu ihnen an den Tisch und sangen Wienerlieder. Isabella sang gern, lernte schnell die ihr unbekannten Melodien und Texte. Inzwischen war sie zwanzig Jahre alt, in einem Alter, in dem ihr junge Männer den Hof machten. Sie wimmelte sie ab. Es gefiel ihr keiner.
An einem Sonntag kam ein junger Herr auf der kastaniengesäumten Hauptallee auf sie zu, kümmerte sich nicht darum, dass sie Arm in Arm mit ihren Freundinnen zur Rotunde strebte und fragte: „Würden Sie mit mir ein Stückerl flanieren?“ Eigentlich ging sie nie allein mit einem Burschen aus, im Pulk der Mädchen fühlte sie sich sicher. Aber wie durch Zauberhand angerührt, löste sie ihre Arme aus denen der Freundinnen und ging neben dem jungen Herrn her. Er war etwas Besseres, das sah sie sofort, trug einen Anzug mit Weste und Schleife, blankgeputzte Lederschuhe, einen kreisrunden Strohhut. Sie gingen schweigend nebeneinander, umrundeten die Rotunde, die 1873 zur Weltausstellung errichtet worden war. „Die Kuppel ist größer als die des Pantheons in Rom“, sagte der junge Herr. Isabella wusste mit dem Wort „Pantheon“ nichts anzufangen.
Die Drehorgelspieler auf dem Platz kämpften um Gehör und Schmattes, Kinderköpfe verschwanden hinter weißen Wolken von Zuckerwatte, auf der Bretterbühne verblüfften Feuerfresser und Jongleure mit ihren Kunststücken. Ihr Begleiter führte sie zielstrebig in das nahegelegene Restaurant „Eisvogel“, ging mit ihr in die obere Etage, bat den Ober um einen Platz auf dem Balkon, von dem man eine fabelhafte Aussicht auf das Gewurstel und Geschiebe und Gewurl vor der Rotunde hatte. Isabella fühlte sich zunehmend unwohl, falsch angezogen in ihrem dünnen Sommerkleidchen, ohne Hut, ohne gestickte Handschuhe. Aber der junge Mann – wie alt mochte er wohl sein? Zwanzig Jahre? Fünfundzwanzig gar? – wirkte nicht bedrohlich, gut erzogen, zurückhaltend. Er nannte seinen Namen: Emil Beer. Seine Familie sei aus Pressburg zugewandert, sein Vater habe ein Unternehmen aufgebaut, handle mit Tuch und Baumwolle, er, Emil, arbeite im elterlichen Betrieb. Oje, dachte Isabella, ein fesches Mannsbild, ein Kaufmann, vermutlich ein jüdischer, so dunkle Haare und Augen, wie der hat – und ein kleines Dienstmädchen aus dem Salzburgischen, katholisch bis in die Knochen, da passte doch gar nichts.
Sie erzählte nicht viel von sich. Sie arbeite bei einer Herrschaft. Sie singe gern. Sie laufe gern durch Wien, eigentlich laufe sie immer, wenn man sie nicht an einem Sessel festbinde.
„So wie jetzt!“, sagte er und lachte. Er bestellte Schnitzel, sie war so aufgeregt, mit Messer und Gabel nichts falsch zu machen, dass sie im Nachhinein nicht sagen konnte, ob es ihr geschmeckt hatte. Am Nachbartisch kämpfte ein Großvater mit zwei Buben, die unaufhörlich ein neues „Kracherl“ wollten, Soda mit Himbeersaft.
Am nächsten Sonntag wartete er vor dem „Eisvogel“ auf sie. Sie war erleichtert, insgeheim hatte sie gefürchtet, er habe es sich anders überlegt mit der Verabredung. Als der Sommer dem Ende zuging, küsste er sie. Und als die ersten Blätter im Prater von den Bäumen fielen, sprach er von Liebe.
Im Winter holte sie die Wirklichkeit ein. Emil hatte seinen Eltern vorgetragen, dass er ein Fräulein Isabella Geissler zu heiraten gedenke, ohne Vermögen, katholischen Glaubens. Sie hatte nach Hause geschrieben, sie wolle einen Herrn Emil Beer heiraten, Kaufmann, nicht unvermögend, jüdischen Glaubens. Aufschrei zwischen Salzach und Donau: Keinesfalls, unmöglich, eine Mesalliance! Fürsterzbischof Franz Albert schickte eine Depesche: Das gottwidrige Verhältnis müsse sofort beendet werden. Bis auf Weiteres stelle er seine finanzielle Unterstützung ein. Zur Bekräftigung schickte er im Wochenrhythmus salzburgische Nonnen nach Wien, die dem jungen Ding den Kopf waschen und es an den Haaren aus dem Tümpel weltlicher Lust ziehen sollten. Die mussten entdecken, dass Isabella schon halb verloren war, diente sie doch bei jüdischen Industriellen. Über alle Aufregungen starb der Bischof im Jahr 1890.
Familie Beer reagierte nicht weniger rigide. Von Enterbung wurde geredet. Schließlich hatte die Familie Beer sechs Söhne. Emils Bruder Richard könne die Firma übernehmen, auch wenn er kein Kaufmann sei. Der älteste Sohn Arthur war auch ein Geschäftsmann, hatte sich allerdings schon mit einer Handelsfirma selbstständig gemacht.
Der Druck wuchs – und im gleichen Maße wuchs die Liebe. An ihrem 24. Geburtstag gestand Isabella ihrem Emil, dass sie schwanger sei. Er nahm sie in die Arme: „Dann geht es eben ohne Trauschein. Aber es geht!“
Sie konnte kein Latein, aber wenn Emil sie mit „Amor vincit omnia“ begrüßte, verstand sie ihn genau. Er hatte eine kleine Wohnung gemietet, in der sie in Sünde, aber recht behaglich lebte. Emil wohnte nach wie vor bei den Eltern in der Marc-Aurel-Straße 10 im 1. Bezirk. Der Schein musste gewahrt bleiben. Aber jeden Abend besuchte er die Frau, die nicht seine Ehefrau sein durfte, und die kleine Tochter. Sie hatten ihr den Namen Friederike Maria gegeben. Emil nannte sie zärtlich „Fritzi“. Fritzi war kugelrund und pumperlgesund. Als sie anfing zu krabbeln, verlor sich der Babyspeck: die dunklen Augen schauten vergnügt in die Welt. Sie sieht jüdisch aus, gestand sich Isabella ein, ganz der Vater.
Die Familien übten sich anhaltend in Konfrontation. Sie durfte mit dem Kind nicht ins Beersche Haus, er hätte nicht ihre Familie in Salzburg besuchen können. „Das macht nichts“, sagte Emil. Aber natürlich machte es sehr viel. Sie wurden bestraft für ihr unziemliches Zusammenleben. Nur die kleine Fritzi hatte keine Ahnung von den familiären Verwerfungen und kiekste fröhlich vor sich hin. Zwei Jahre später war Isabella wieder schwanger. Emil streichelte ihren Bauch: „Ich freue mich. Hoffentlich wird es wieder eine Tochter!“ Natürlich meinte er genau das Gegenteil: Schon wieder ein Bankert? Immer noch ohne Trauschein? Wenn es wenigstens ein Junge wird! Aber natürlich war er ein viel zu liebevoller Mann, um das laut zu sagen. Isabella verstand ihn auch so.
Wie viele Söhne war auch Emil Beer seiner Mutter in besonderer Weise verbunden. Charlotte Beer hatte ihre sechs Söhne verwöhnt, wie sich das für eine jüdische Mamme gehört. Emil war immer ihr Augenstern gewesen. Sie erwartete, dass er sein Leben änderte. Als sie an Lymphdrüsenkrebs erkrankte, wurden die Forderungen dringlicher. „Wie soll ich in Ruhe sterben können, wenn ich dich noch immer in diesen unwürdigen Verhältnissen weiß. In wilder Ehe mit einer Schickse zusammenleben, ein Mischlingskind in die Welt gesetzt. Das nächste Kind kommt in den gleichen Schlamassel. Das alles soll ich auf meine letzten Tage ertragen?“
Emil tätschelte seiner Mutter die Hände. Aber was sollte er tun? Er kannte Isabellas kompromisslose Haltung. Jeder könne doch in seinem Glauben glücklich werden. Eine Konversion um einer bürgerlichen Eheschließung willen könne nur Unglück bringen. Sie ruhe auf falschem Fundament. Dann doch lieber ehrlos in freier Liebe als ehrenvoll in verlogener Ehe leben.
Emil war Geschäftsmann, da hatte er gelernt, einzulenken und nach Ausgleich zu suchen, empfand Kompromissbereitschaft nicht als Charakterschwäche. Aber in diesem Dilemma zwischen Mutter und Geliebter gab es keine Lösung.
Nur Trost. Und der hieß Fritzi. Wenn die eineinhalbjährige Tochter auf seinem Schoß herumturnte, ihm die Haare zerzauste, in die Ohrläppchen kniff, ihn mit nussbraunen (seinen!) Augen ansah und über das ganze Gesicht lachte, wenn Fritzi seine Hand nahm und auf wackeligen Beinchen den aufrechten Gang probte, dann war ihm das ganze Gerede über ehrlose Verhältnisse gleichgültig. Das „Bankert“ war ein wunderbares Kind – und damit basta.
„Spürst du schon, wie es drückt und stößt?“ Isabella nahm Emils Hand und legte sie sich auf den runden Bauch. Er spürte nichts, aber er liebte die Intimität abendlicher Nähe.
„Es wird ein Judenkind.“
„Was soll das heißen?“
„Ich konvertiere zum Judentum. Dann können wir heiraten. Und dieses Kind kommt ehelich und jüdisch zur Welt. Deine Mutter kann in Frieden sterben.“
„Bella!“
„Ich dachte, das ist dir wichtig.“
„Aber …“
Schon Monate zuvor war Isabella zum Rabbiner des Bethauses in der Josefstadt gegangen, hatte ihr Anliegen vorgetragen, zum Judentum zu konvertieren. Der Rabbiner, ganz in Schwarz gekleidet, weißer Rauschebart, starke Brille, war hinter seinem Schreibtisch hervorgekommen, hatte sie durchdringend angeschaut und dann unvermittelt losgedonnert: „So! So! Sie wollen konvertieren! Wahrscheinlich aus Liebe zu einem Mann. Das geht nicht. Als Jüdin wird man geboren, von einer jüdischen Mutter. Wir sind ein Volk, nicht eine beliebige Konfession, die man annehmen und wieder ablegen kann wie ein Kleid, aus dem man herauswächst. Das Judentum ist keine Religion der Liebe. Es ist eine Religion des Gesetzes. Schlagen Sie sich den Mann aus dem Kopf!“
„Aber“, wollte Isabella sagen, da war sie schon aus der Tür gedrängt.
Doch sie kam wieder. Verneigte sich vor ihm und redete ihn mit „Rabbi uMori“ an, was dem Meister und Lehrer nicht unangenehm zu sein schien. Er hielt ihr einen Vortrag über koschere Lebensführung, wie sie sich für eine jüdische Frau zieme. Am Ende aber sagte er wieder: „Lassen Sie es sein!“ Sie ließ es nicht, und irgendwann hatte der Rabbiner die Ernsthaftigkeit ihres Willens hinlänglich geprüft, wurde milde, zeigte ab und an gar eine Anmutung von Zufriedenheit mit der gelehrigen Schülerin und unterrichtete sie.
Emil hatte sie nichts erzählt. Sie fürchtete, dass aus ihrem Übertritt nichts würde. Niederlagen gestand sie sich nicht gerne ein. Anderen schon gar nicht. Aber an diesem Abend konnte sie – nicht ohne einen Anflug von Triumph − ihrem Mann berichten, was sie erreicht hatte.
„Bella!“
„Du hast noch nicht einmal gemerkt, dass ich schon längst nur noch koscher koche. Keine Würstel mehr und keine Schinkenfleckerl.“
„Ich weiß nicht, ob ich diese Konversion will. Du solltest keine Opfer bringen müssen.“
„Der Rabbi verlangt, dich kennenzulernen, bevor ich in die Gemeinde aufgenommen werde. Du musst dein Einverständnis geben.“
„Oje“, Emil verzog das Gesicht, „hoffentlich artet das nicht in eine Überprüfung meiner Gesetzestreue aus, da falle ich hoffnungslos durch.“
„Verzögerungen können wir uns nicht mehr leisten, wenn unser Sohn ehelich auf die Welt kommen soll. Die Hochzeit zu arrangieren überlasse ich dir, ich werde mich um ein Brautkleid kümmern, in das ich mit meinem Bauch noch hineinpasse.“
Emil Beer war verblüfft. Aber auch erleichtert. Seine großartige Frau. Sie bewies eine Bereitschaft, sich den Verhältnissen anzupassen, die er nicht vermutet hätte. Ende April fand die Hochzeit nach jüdischem Ritus im Josefstädter Bethaus, Florianigasse 41 statt. Die Braut trug schwarz.
Vier Wochen nach der Hochzeit starb Emil Beers Mutter im Alter von 54 Jahren. Samuel Beer gibt, vom tiefsten Schmerze gebeugt, im eigenen, sowie im Namen seiner Kinder Arthur, Emil, Max, Louis, Richard, Karl, seiner Schwiegertochter Bella, seiner Enkelin Fritzi als auch der übrigen Verwandten Nachricht von dem ihn tieferschütternden Hinscheiden seiner innigstgeliebten, unvergesslichen Gattin, der Frau Charlotte Beer, steht in der Todesanzeige vom 25. Mai 1893. „Sie ging dahin in Frieden“, betonte der Rabbiner. Der Ehemann sagte das Kaddisch und erzählte den zahlreichen Gästen, die zur Schiwe ins Haus kamen, wie seine Frau „mit allem versöhnt“ die Augen geschlossen habe.
Wenige Wochen später wurde der sehnlich erwartete Sohn Emil und Isabella Beers geboren, entpuppte sich als eine Tochter. Die wurde genauso herzlich begrüßt und nach der verstorbenen Großmutter „Charlotte“ genannt.
Die Welt der Familie Beer war in Ordnung gekommen.
GESCHÄFT IST GESCHÄFT
Heile Welt. Vater Samuel versöhnte sich mit seinem Sohn und nahm Isabella als seine Schwiegertochter an. Die beiden Enkelinnen Fritzi und Lotte wurden ihm zum Trost seiner Witwertage. Jeden zweiten Sonntag gingen die Mädchen, fein ausstaffiert mit Tüllröckchen und Lackschuhen, an der Hand des Großvaters in die Konzert-Matinee in den Musikverein – und langweilten sich. Aber da es anschließend immer noch Kuchen und Eiscreme in einer Konditorei gab, ließen Isabella und Charlotte die klassische Musik widerspruchslos über sich ergehen.
Emil arbeitete nicht länger in der väterlichen Firma, er hatte seinem Bruder Richard Platz gemacht. Er wollte ein eigenes Geschäft eröffnen, selbstständig sein. Mit der tatkräftigen Isabella an seiner Seite versprach jedes Unternehmen Erfolg zu haben.
„Nur keine Textilien mehr“, sagte Emil. Er wollte mit Anderem handeln, von Stoffen hatte er erst einmal genug. Isabella brachte ihn auf Gedanken. Die Wiener brauchten am Abend ihr Glasl Wein, mit wachsendem Wohlstand wuchsen die Ansprüche an die Qualität des Tropfens. In großbürgerlichen Haushalten war es mit einem Grünen Veltliner, Welschriesling, Blaufränkischen oder Blauen Portugieser nicht getan, die Herren und zunehmend auch die Damen verlangten nach Burgunder und Bordeaux. Emil hatte eine Weinzunge, kannte sich in heimischen und französischen Lagen und Rebsorten aus, verstand zu handeln.
Er sprang auf Isabellas Idee an und gründete einen Weinhandel. Was lag näher, als neben dem Wein gleich noch ein paar traditionelle Feinschmeckereien zu verkaufen, feinen Alm-, Heumilch- und Bregenzerwälder Käse, Geselchtes, Schwarzgeräuchertes und Beinschinken, Elsbeerenbrand und Fraxner Kirsch. Familie Beer fand in der Krugergasse 3, in zentraler Lage in der Nähe des Kärntner Rings, eine passende Lokalität und eröffnete das Delikatessengeschäft „Zum Weingartl“. Bald aber wollten die Kunden ihren Wein und Käse nicht länger im Stehen probieren, Emil beantragte eine Konzession und eröffnete am gleichen Ort eine Gastwirtschaft.
Isabella wurde die Seele des Restaurants. Trotz ihrer zwei kleinen Töchter, zu denen im Zweijahresrhythmus noch der Sohn Rudolf und die Tochter Isabella kamen, war sie abends unermüdlich in der Gaststube tätig, schenkte Wein ein, beriet die Gäste, servierte das Essen, nahm lächelnd anerkennende Worte für die Getränke und die Mehlspeisen entgegen und reichte sie an Emil und die böhmische Köchin weiter. Schon bald blühte im „Weingartl“ der ökonomische Erfolg, das Restaurant wurde zu einer festen Adresse in der Wiener Gastronomie. Nach jeder monatlichen Abrechnung nahm Emil seine Frau in die Arme. „Wünsch dir was! Wir können es uns leisten!“ Isabella lachte: „Nur keine vierzehn Kinder wie bei uns zu Hause!“
Die jüngste Tochter Isabella, nur Bella genannt, kam nicht mehr als Jüdin auf die Welt. Emil und Isabella Beer waren offiziell aus der Jüdischen Kultusgemeinde Wien ausgetreten. Sie fühlten sich dort nicht mehr zu Hause, falls sie es je getan hatten. Gingen sie an Jom Kippur oder Chanukka tatsächlich einmal in eine Synagoge, war diese voll mit jüdischen Einwanderern, die in großer Zahl aus dem Osten nach Wien gekommen waren, fromme Schtetl-Juden, in schwarzen Kaftan gehüllt, wagenradgroße schwarze Hüte auf dem Kopf, die Männer mit Schläfenlocken, die Frauen mit Kapotthüten oder Kopftüchern, um die sündige Haarpracht zu verbergen. Sie lebten in fast ghettoartiger Verdichtung in der Leopoldstadt und am Alsergrund. Hinter dem Vorhang auf der Empore der Synagoge, der die Frauen vor den Blicken der Männer verhüllte, fand sich Isabella eingekreist von armselig gekleideten weiblichen Wesen, ausgezehrt von vielen Schwangerschaften, müde die rituellen Gebete vor sich hinmurmelnd. Sie empfand Mitleid mit ihnen – kamen sie doch aus einer fremden Welt, in der Judesein etwas anderes bedeutete als in ihren Kreisen in Wien. Ergebenheit in Gottes Willen, Erfüllung der Gebote, Gehorsam gegenüber dem Gatten. Ganz im Gegensatz zu der intellektuellen und wirtschaftlichen Souveränität jüdischer Familien, die in ihren Villen in Döbling, Hietzing oder der Inneren Stadt wohnten und sich in die christliche Oberschicht assimiliert hatten.
„Schad’ um all das Hebräisch-Strebern“, bedauerte Isabella.
„Kein Studium ist je umsonst“, hielt Emil dagegen. „Und schon gar nicht, wenn es aus Liebe ergriffen wurde.“
„Aber wir sind ja nicht gottlos. In irgendeiner Religion sollten die Kinder aufwachsen.“
„Also konvertieren wir.“
„Zurück ins Katholische? Damit sich der verblichene Onkel Erzbischof im Himmel die Hände reibt?“
„Der hat bestimmt Besseres zu tun. Wie wäre es mit dem protestantischen Glauben? Die Protestanten verlangen von Juden nicht die Abschwörungsformel wie die Katholiken: ‚Ich verabscheue die jüdische Perfidie, weise den hebräischen Aberglauben zurück!‘ Das kann ich einfach nicht aussprechen! Außerdem passt das Lutherische doch zu meiner Frau, die lieber das Wort studiert, als sich bedingungslos Geboten anzuvertrauen.“
Tatsächlich konvertierten Isabella und Emil Beer zum Protestantismus, die Tochter Isabella wurde evangelisch getauft.
Seine Exzellenz Franz Albert hätte wohl eher von Aversion denn von Konversion gesprochen. Oder gar von Perversion.
HIMMEL, HÖLLE, FEGEFEUER
Wenn Emil Beer nicht auf Reisen im Chablis, in Burgund oder im Bordelais war, um auf Weingütern einen neuen Jahrgang zu testen und zu ordern, wenn er nicht im Weinkeller Flaschen in Holzwolle hüllte und zum Verschicken in Kisten verpackte, oder im Geschäft stand und Kunden beim Weinkauf beriet, kümmerte er sich um die Kinder, brachte sie abends zu Bett und las ihnen Märchen vor. Die Mutter war ja im Restaurant unabkömmlich. Sie war das „Weingartl“. Natürlich gab es mit der Zeit auch Personal. Neben der böhmischen Köchin, gegen alle Stereotype weder dick noch alt, sondern eine schmale, einsilbige Frau von dreißig Jahren, die ihren verwitweten Vater und fünf jüngere Geschwister über Wasser hielt, gab es ein Kindermädchen und zwei Dienstmädchen. Eins war fürs Haus zuständig, eins für die Sauberkeit und den Abwasch im Geschäft und im Restaurant.
Einmal erwischte die Mutter die neunjährige Fritzi, als diese das Hausmädchen herumkommandierte: „Putz mir die Schuhe, räum mein Zimmer auf und koch mir einen Pfefferminztee!“ Da packte Isabella ihre Tochter sehr unsanft am Schlafittchen, zog sie in ihr Zimmer und fuhr sie zornig an: „So etwas will ich nie wieder hören. Was du selbst tun kannst, das tust du und lässt es nicht Hermine tun. Du gibst ihr keine Befehle. Du behandelst sie mit Respekt und nicht von oben herab wie eine kleine dumme Prinzessin. Hast du mich verstanden?“ Nein, wirklich verstanden hatte Fritzi den Ausbruch ihrer Mutter nicht, aber sie hütete sich, noch einmal Hermine zu „befehligen“. War auch gar nicht mehr nötig, weil Hermine ausnehmend freundlich wurde und der hübschen Prinzessin jeden Wunsch von den Augen ablas.
Ansonsten verbrachte Fritzi eine Kindheit an der langen Leine. Das Kindermädchen musste sich um die jüngeren Geschwister kümmern, das gab den Schwestern Fritzi und Lotte eine Freiheit, die sie weidlich nutzten. Natürlich gingen sie zur Schule, ihre Eltern legten Wert darauf, dass sie ordentlich lernten, die Beurteilungen durch die Lehrer wurden ernst genommen. Vor allem ihre Mutter Isabella stand immer hinter ihnen, fragte nach Hausaufgaben, stellte ihnen aus heiterem Himmel Rechenaufgaben, ließ sie Gedichte aufsagen, Lieder singen. Nur nach dem lieben Gott fragte sie nie.
Hatten sie ihre Aufgaben erfüllt, durften die Schwestern machen, was sie wollten, das Haus verlassen, in der Stadt herumstromern, in den Volksgarten gehen und Murmeln spielen oder in den Brunnen planschen und Passanten nass spritzen. Manchmal beschwerten sich Leute über die wilden Kinder. Von Buben sei man ja einiges gewohnt, aber von Mädchen?
Auch Emil meldete Bedenken an. Ob Bella denn keine Angst habe: die Mädchen so ganz allein auf sich gestellt, aller elterlichen Kontrolle entzogen, ob nicht vielleicht ein zweites Kindermädchen …? Isabella lachte ihren Mann aus: „Wenn ich Angst hätte, wär’ ich vor zwanzig Jahren von Salzburg aus nicht einmal bis Fuschl gekommen. Die beiden lernen etwas fürs Leben.“
Emil war sich da nicht so sicher. Aber er ließ seine Frau gewähren. In der Tat kamen die Mädchen ja jeden Abend zum Abendessen nach Hause, meist ausgehungert und fröhlich. Er hörte auf zu fragen, was sie gemacht hätten. „Najo, nix Besonderes“, war die gleichbleibende Antwort.
„Der Papa is heut’ die Stiegn aufikräult“, verkündete Fritzi ihrer Mutter. Die hatte die Bestellung der Köchin für das Abendessen im Restaurant im Kopf. Ob die Erdäpfel ausreichten, die Karotten und die Kalbsschnitzel? „Ah so?“, sagte Isabella mechanisch. Aber Fritzi insistierte: „Der Papa ist die Stiege heraufgekrochen, auf allen vieren.“ Jetzt löste sich die Mutter von ihrem Bestellzettel. „Was sagst du? Der Papa gekrochen? Kann nicht sein. Er ist nie betrunken, nie, und am hellen Mittag schon gar nicht.“
„Ich hab’s aber gesehen. Auf allen vieren. Hat sich am Geländer Stufe für Stufe hochgezogen.“
Emil, zur Rede gestellt, wiegelte ab: „Das war nur eine kleine Schwäche. Es geht mir schon wieder besser.“
Aber Isabella war beunruhigt. Er sollte wieder einmal seinen Bruder Max konsultieren, der war Arzt. Schon vor einiger Zeit hatte Max bei Emil eine Herzinsuffizienz diagnostiziert und ihm Pillen verschrieben. Aber die unregelmäßig auftauchenden Beschwerden besserten sich nicht. Manchmal griff sich Emil an die Brust, rang minutenlang nach Atem. Dann wieder brach er bei der geringsten Bewegung in Schweiß aus. Isabella hatte einen Studenten angeheuert, der die schweren Weinkisten aus dem Keller hieven sollte. Doch statt die Flaschen zu transportieren, trank der junge Mann sie aus.
„Du solltest eine Kur machen!“
„Ach, geh! Ich unter all den alten Leuten mit ihren Zipperlein. Langweile mich zu Tode.“
„Gegen Langeweile gibt es Bücher.“
Fritzi heulte, als der Papa seinen Koffer packte, um nach Bad Gastein zu fahren. Isabella weinte nicht. Aber sie strich ihrem Mann über die Brust, da, wo das Herz saß. Sah ihn an, wie sie ihn vor 15 Jahren im Prater angeschaut hatte, als er sie zum vierten Mal in den „Eisvogel“ eingeladen hatte. „Behüt’ dich Gott, Emil!“ Damit schob sie ihn in den Fiaker, der ihn zum Bahnhof brachte.
Nach sechs Wochen kam er zurück, sah gut aus, seine Augen strahlten. „Ich werde den Madln Dantes ‚Göttliche Komödie‘ vorlesen, das ist ein Buch fürs Leben. Spät genug, dass ich es erst jetzt kennengelernt habe, aber wofür eine Kur nicht alles gut ist.“
Er meinte es ernst, las mit Begeisterung der dreizehnjährigen Fritzi und der elfjährigen Lotte Dantes Himmel, Hölle und Fegefeuer vor. Charlotte schlief regelmäßig ein. Aber Fritzi entzündete sich an der Musik der Sprache. Auch wenn sie nicht alles verstand, verstand sie doch einiges. So die schöne Geschichte der Francesca da Rimini und ihres Liebhabers Paolo Malatesta. „An jenem Abend lasen wir nicht weiter“, setzte ihre Fantasie frei. Was machten die beiden, als sie keine Ritterromane mehr lasen?
Ihren Vater fragte sie besser nicht. Aber sie würde es schon herausfinden.
Über Emil Beers Herzleiden wurde nicht mehr gesprochen. Jedes Jahr machte er eine Kur in Bad Gastein und kam mit einem neuen Buch zurück. Es war doch alles nicht besorgniserregend. Schließlich war er ja noch ein junger Mann, gerade Anfang 40. Kein Alter für Schwächeanfälle.
DIE KUNST-EXPERTIN
Das wächst sich aus“, sagten die Verwandten. Es wuchs sich aus, aber anders, als sie meinten. Fritzi ließ sich nicht gern bevormunden. Wenn sie eine autoritäre Hand spürte, löckte sie wider den Stachel, tat das Gegenteil dessen, was von ihr erwartet wurde. Nur bei Großvater Samuel spielte sie das brave Kind. Der konnte ja nichts dafür, dass er schon so alt war (manchmal hing ihm ein Tropfen unter der Nase, und er merkte es nicht!), und ziemlich sentimental, wenn es um seine Enkelkinder ging. Dabei war er noch bis zu seinem 70. Lebensjahr im Jahr 1900 aktiv im Geschäft, erst dann zog er sich zurück.