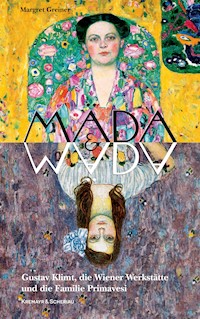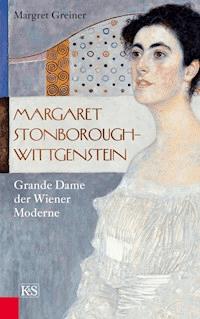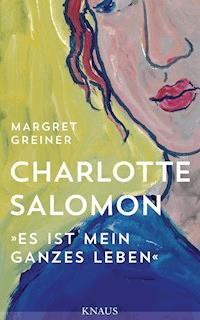
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albrecht Knaus Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die erste Biografie, die Charlotte Salomons intensive Bilder zum erzählerischen Ausgangspunkt nimmt
In dieser Biografie werden erstmals die intensiven Bilder und damit die Selbstdarstellung der Malerin in den Mittelpunkt gestellt. Während sich zuletzt Literaten, Musiker und Dramaturgen von Salomon inspirieren ließen – ihr Leben war Stoff etwa von David Foenkinos' Roman, unter der Regie von Luc Bondy wurde eine Oper uraufgeführt - hat Margret Greiner die historischen Tatsachen hinter dem gemalten Tagebuch recherchiert. Daraus entwickelt sie mit großer Nähe zu Salomons Werk eine atmosphärische Erzählung vom kurzen tragischen Leben der Künstlerin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Anlässlich des 100. Geburtstags Charlotte Salomons rückt diese neue Biografie erstmals die intensiven Bilder und damit die Selbstdarstellung der Malerin in den Mittelpunkt. Margret Greiner recherchierte die historischen Tatsachen hinter dem gemalten Tagebuch und entwickelt daraus mit großer Nähe zu Salomons Werk eine atmosphärische Erzählung vom kurzen tragischen Leben der Künstlerin.
1917 geboren, wächst Charlotte Salomon in einem großbürgerlichen jüdischen Elternhaus in Berlin auf. Durch die Selbstmorde der Frauen in ihrer Familie – Mutter, Tante, Großmutter − und die Bedrohung durch den Nazi-Terror ist der Tod allgegenwärtig. Als Jüdin diskriminiert und aus der Kunsthochschule gedrängt, flieht Charlotte mit 21 Jahren ins Exil nach Südfrankreich. Um sich ihres Lebenswillens zu vergewissern und nicht zu verzweifeln, beginnt sie wieder zu malen, schließt sich in der Pension Belle Aurore ein und arbeitet wie besessen. In 18 Monaten entstehen 1325 Bilder, aus denen sie knapp 800 auswählt und bündelt: Es ist ihr ganzes Leben.
Die Autorin
Margret Greiner studierte Germanistik und Geschichte in Freiburg i. Br. und München. Viele Jahre arbeitete sie als Lehrerin und Journalistin. Sie hat sich immer wieder mit außergewöhnlichen Frauenleben beschäftigt, zuletzt erschienen die erzählten Biografien »Auf Freiheit zugeschnitten. Emilie Flöge: Modeschöpferin und Gefährtin Gustav Klimts« und »Charlotte Berend-Corinth und Lovis Corinth: Ich will mir selbst gehören«. Margret Greiner lebt in München.
Weitere Informationen zu unserem Programm unter www.knaus-verlag.de
Margret Greiner
Charlotte Salomon
»Es ist mein ganzes Leben«
KNAUS
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Alle kursiv gesetzten Texte sind wörtliche Zitate.
Die Bilder aus Charlotte Salomons Werk Leben? oder Theater? sind vom Joods Historisch Museum in Amsterdam ins Internet gestellt worden:
http://www.charlotte-salomon.nl/collection/specials/charlotte-salomon/leben-oder-theater und unter der jeweiligen Nummer aufzurufen.
Die von Charlotte Salomon hinzugefügten Musiktitel stehen jeweils unter den Bildern und können parallel angehört werden.
Alle Bilder mit freundlicher Genehmigung der Collection Jewish Historical Museum © Charlotte Salomon Foundation
Charlotte Salomon®
www.jck.nl
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags für externe Links ist stets ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2017
beim Albrecht Knaus Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch Aenne Glienke/
Agentur für Autoren und Verlage, www.AenneGlienkeAgentur.de.
Redaktion: Cornelia Adomeit
Umschlaggestaltung: Favoritbuero, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-18718-7V001
www.knaus-verlag.de
Für Bernhard
Das war, wenn ich beim Tuschen saß. Die Farben, die ich dann mischte, färbten mich. Noch ehe ich sie an die Zeichnung legte, vermummten sie mich selber. Wenn sie feucht auf der Palette ineinanderschwammen, nahm ich sie so behutsam auf den Pinsel, als seien sie zerfließendes Gewölk.
Walter Benjamin, Berliner Kindheit um Neunzehnhundert
Leben? oder Theater? Kein Werk kann mich besser daran erinnern, für was es sich im Leben zu kämpfen lohnt … Sie [die Bilder] sind einfach mein Gegengift gegen Gleichgültigkeit.
Jonathan Safran Foer
Prolog
Sie hätten ein Flugzeug nehmen können, von Amsterdam nach Paris fliegen, dann umsteigen nach Nizza. Es war nicht der enorme Preis, der sie abhielt, obgleich sie aufs Geld schauen mussten. Aber es stand für sie außer Frage, dass sie mit dem Zug fahren würden, wenn sie sich auf die Suche nach Spuren der letzten Jahre von Charlottes Leben begeben wollten.
Auch wenn die Fahrt von Amsterdam an die Côte d’Azur einer anderen Route folgte als von Berlin nach Villefranche und die Voraussetzungen zwei Jahre nach Kriegsende völlig andere waren als im Januar 1939, als sie Charlotte zu den Großeltern geschickt hatten, so waren sich Albert und Paula Salomon einig, dass die langsame und zögernde Annäherung mit der Eisenbahn die einzige Option war, sich diese Reise zuzumuten. Sie konnten Nebenstrecken wählen, Zwischenhalte einlegen und sogar den Entschluss fassen umzukehren, wenn sie sich nicht gewappnet fühlten, der Vergangenheit ausgesetzt zu werden – und der Trauer, die durch die lokale Nähe zum Leben und Tod ihrer Tochter noch tiefer dringen würde.
Immer wieder wogen sie das Für und Wider dieser Reise ab, und schließlich war es die resolute Paula, die eines Abends sagte:
»Albert, wir fahren. Das sind wir Charlotte schuldig, auch wenn es uns schwerfällt. Sonst finden wir nie Ruhe. Und vielleicht entdecken wir in Villefranche nicht nur Spuren des Leids, sondern auch solche von Charlottes Glück, das könnte uns trösten.«
»Und die Spuren ihres Unglücks, können wir die ertragen?«, hatte Albert gefragt und war in tiefes Schweigen verfallen.
Jetzt saßen sie im Zug, jeder in seine Gedanken und Empfindungen versponnen. Sie fuhren über Brüssel nach Frankreich, der Zug hielt lange in Reims, sie schauten aus dem Fenster, ob die Kathedrale zu entdecken war. Sie fuhren durch das Département Marne et Champagne, und Albert Salomon dachte daran, wie diese Erde getränkt war vom Blut Hunderttausender deutscher und französischer Soldaten, die in den Schlachten des Ersten Weltkriegs ihr Leben gelassen hatten. Als er damals als hochdekorierter Offizier von Frankreich nach Berlin zurückgekehrt war, hatte er es für undenkbar gehalten, dass sich auf Europas Boden jemals wieder Menschen in einen Krieg hineinziehen lassen würden. Aber es hatte nur 25 Jahre gedauert, nur eine Generation, bis erneut deutsche Truppen in Frankreich einfielen. Jetzt überdeckten Sonnenblumenkulturen die Schlachtfelder.
Manche Bahnhöfe sahen zwei Jahre nach Kriegsende immer noch aus wie Ruinen, nur die Gleise waren repariert. Dörfer erweckten aus der Ferne den Eindruck ländlicher Idylle, aber der Blick in die Städte eröffnete melancholische Bilder nicht behobener Schäden: halb zerstörte Häuser, deren Ruinen wie grotesk verbogene Zinken einer Heugabel in den Himmel ragten, Schutthalden, wo einst Parks angelegt waren, aufgerissene Bürgersteige. Ramponierte Busse fuhren langsam durch die Straßen, als suchten sie Wege, aber kein Ziel. Abgemagerte Hunde wühlten im Abfall nach Fressbarem. Nur die Kinder schienen unberührt von den Nachwehen des Krieges: Sie hüpften über aufgebrochenes Straßenpflaster und spielten Fangen, auf ihren Rücken trugen sie Tornister mit altmodischem Fellbesatz, mit denen vielleicht schon ihre Eltern zur Schule gegangen waren.
»In Berlin müssen die Schäden noch viel schlimmer sein«, sagte Paula.
Albert reagierte unvermutet heftig: »Berlin gibt es für mich nicht mehr. Ich werde nie wieder nach Deutschland zurückkehren, nie.«
Sie schwiegen. In der Champagne sahen sie erste Weinberge. Anders als an Rhein und Mosel wuchs der Wein hier nicht an Hügeln, sondern auf flachen Feldern, die Rebstöcke waren niedrig, die Trauben mussten mehr liegend als gebückt geerntet werden.
In Dijon verließen sie den Zug, um zu übernachten. Es war schwer, ein Hotel zu finden, aber schließlich hatten sie Erfolg, weil Albert fließend Französisch sprach. Der Patron gab sich äußerst reserviert und ließ die beiden Deutschen seine Abneigung spüren. Auch wenn sie zu alt waren, um aktiv am Krieg teilgenommen zu haben, waren sie wie alle Deutschen Nazis gewesen, daran gab es für ihn keinen Zweifel. Doch als Paula sich anschickte, den Wirt aufzuklären, hinderte Albert sie daran.
»Er hat ja recht. Denk daran, was die Deutschen angerichtet haben.«
»Aber …«
»Halt dich um Gottes willen zurück. Wir wollen uns nicht als Opfer aufspielen. Und vielleicht hat er etwas gegen Juden. Lass uns zum Bahnhof gehen.«
Burgund, das mit seinen sanften, mit Wein bestandenen Hügeln und den im Sonnenlicht leuchtenden Dächerlandschaften an ihrem Zugfenster vorüberglitt, war so anmutig, dass es etwas Unwirkliches ausstrahlte, wie auf Glas gemalte Bilder, die von einer Laterna magica an die Wand projiziert wurden. Und als hinter Lyon die Vegetation immer mediterraner wurde, Oleander die Bahndämme säumte wie in Deutschland Ginsterbüsche und Bougainvilleen sich in einer Üppigkeit verschwendeten, als hätte es niemals auf dieser Erde Mangel und Kargheit gegeben, da sagte Albert, als sie sich Marseille näherten, wo sie umsteigen mussten in den Zug nach Nizza: »Unter diesem Himmel und in diesem Licht hat Charlotte gelebt« – und ein Abglanz dieses Lichtes erschien auf seinem verschlossenen Gesicht und öffnete die strenge Falte zwischen seinen Brauen.
Sie wussten seit zwei Jahren, dass Charlotte tot war, ermordet in Auschwitz. Das Jewish Search Centre in London hatte ihnen eine Nachricht zugesandt.
»Wieso Charlotte Nagler?«, hatte Albert zunächst gefragt und für einen Augenblick gehofft, es könne ein Versehen sein, nicht seine Tochter sei den Nazis zum Opfer gefallen.
Aber die Hoffnung war der Wahn einiger Sekunden, der mit dem Zusatz »née Salomon« erlosch. Charlotte musste im Exil geheiratet haben.
Albert und Paula hatten den letzten brieflichen Kontakt zu ihr unmittelbar nach dem Tod der Großmutter im Jahr 1940 gehabt, von Charlottes letzten Jahren wussten sie nichts, auch nichts vom Tod Ludwig Grunwalds, des Großvaters. In ihren ersten Briefen aus Villefranche hatte Charlotte immer wieder Madame Ottilie Moore erwähnt: »meine einzige Freundin«, »die Frau, die mich versteht, die mich als Künstlerin ansieht«.
So hatte Albert in wohlgesetztem Französisch einen Brief an Mrs. Moore in der »Ermitage« in Villefranche-sur-Mer geschrieben und sie um ein Treffen gebeten. Mrs. Moore hatte nicht geantwortet, vielleicht lebte sie gar nicht mehr in Villefranche, vielleicht lebte sie überhaupt nicht mehr. In Charlottes Briefen tauchte auch mehrfach ein Dr. Moridis auf, der der Großmutter in ihrer Krankheit sehr geholfen habe. Die Municipalité von Villefranche, bei der Albert schriftlich die Adresse des Dr. Moridis erbeten hatte, schickte nur ein Formschreiben, dass persönliche Daten von Bürgern der Stadt nicht weitergegeben werden dürften.
So fuhren sie ins Dunkle, ins Ungefähre, hofften, etwas von Charlottes Leben in Villefranche zu erfahren, mussten aber darauf gefasst sein, nach kurzer Zeit wieder den langen Heimweg anzutreten, ohne jegliche Erkenntnis.
Sie sprachen nicht von ihren Befürchtungen. In Nizza logierten sie in einem Hotel nahe dem Bahnhof, nahmen ein ruhiges Zimmer mit Blick in den Innenhof. Charlotte und ihr Mann hatten vier Tage in diesem Hotel gewohnt, kaserniert durch SS-Hauptsturmführer Alois Brunner, der die Gefangenen in diesem Hof hatte foltern und demütigen lassen, während aus den angrenzenden Häusern Franzosen aus den Fenstern zugeschaut und sich am makabren Schauspiel ergötzt hatten. Aber das wussten Albert und Paula nicht.
Ein Bummelzug brachte sie am nächsten Tag nach Villefranche-sur-Mer. Der Bahnhof war winzig und wirkte schäbig. Von den Bodenkacheln im Bahnhofsgebäude, helle Fliesen mit Blumendekor, waren viele gesprungen und so angeschmutzt, dass sie allen Charme verloren hatten. Es gab keine Taxis. So mussten sie sich zu Fuß auf den Weg in den Ort machen: zwei sehr formell gekleidete Menschen, die sich sehr fremd fühlten. Albert schleppte zwei schwere Ledertaschen – als Kavalier alter Schule hätte er Paula niemals erlaubt, sich mit dem Gepäck abzumühen. Paula trug einen Hut.
Es war nicht schwer, den Weg zur Ermitage zu erfragen, aber als sie dort ankamen, war das schmiedeeiserne Tor verschlossen. Dahinter war ein großes Gebäude zu erahnen. Durch zerzauste Lorbeerhecken an den Seiten des Tores blickten sie in einen üppig verwilderten Park. Paula und Albert versuchten, um das Areal herumzugehen, die Hecken verloren sich, die Wege endeten vor Steinwällen oder undurchdringlicher Macchie.
Es war ein heißer Tag, Albert setzte die Hitze zu. Unaufhörlich wischte er sich mit dem Taschentuch über den kahlen Schädel, als wollte er mit dem Schweiß auch die sich ausbreitende Enttäuschung wegwischen. Im Rathaus war man zuvorkommend gewesen, Ottilie Moore sei aus Amerika zurückgekommen, sie lebe jetzt in der Altstadt, jeder in Villefranche könne ihnen die Straße zeigen, jeder kenne Madame.
»Ist dir aufgefallen, wie der Beamte ›Madame‹ gesagt hat?«, fragte Paula. »Also, ich habe da jede Menge ironischer Apostrophe mitgehört.«
»Ich nicht«, wiegelte Albert ab. Es bereitete ihm Unbehagen, ohne Voranmeldung einfach an einer Wohnungstür zu klingeln. Hätten sie doch wenigstens eine Telefonnummer herausfinden können. Als niemand öffnete und niemand in der engen Straße zu finden war, den man um Auskunft hätte bitten können, war er fast erleichtert. Ein feines Viertel war das nicht, in das es Ottilie Moore verschlagen hatte. Vor jedem Haus lag Müll, der in der Sonne faulte und stank. Paula schlug vor, in ein Café zu gehen und später einen neuen Versuch zu wagen.
Da sahen sie am Ende der Straße eine Frau in ihre Richtung wanken. Wie von der Sonne um ihren aufrechten Gang gebracht, schlingerte sie hin und her, stützte sich an einer Hauswand ab, drehte zur gegenüberliegenden Seite, blieb dort eine Weile stehen und hielt sich an einer Tür fest, um dann wieder ungewisse Fahrt aufzunehmen. Beim Näherkommen verstärkte sich der Eindruck einer seltsamen Erscheinung; die Frau war groß und korpulent, sie trug, der Hitze zum Trotz, einen warmen Mantel und einen eher für den Winter geeigneten Kapotthut. Entweder ist sie krank, Morbus Menière zum Beispiel mit starkem Schwindel, diagnostizierte der Arzt in Albert, oder sie ist betrunken. Bald wurde ihm klar, das Torkeln kam nicht aus dem Innenohr, es kam aus der Flasche.
Sie hatten sich Charlottes beste Freundin anders vorgestellt, sehr anders. Aber es musste eine enge Bindung zu Charlotte gegeben haben, wie sie erkannten, als sie im Wohnzimmer Ottilie Moores saßen. Die Wände hingen voll mit Bildern, die so unzweifelhaft ihre Tochter gemalt hatte, dass Albert und Paula den Atem anhielten. Wie gern hätten sie die Bilder in Ruhe betrachtet, die Selbstporträts – mindestens zehnmal schaute die gemalte Charlotte sie an, fast immer mit einem fragenden Blick –, die Landschaftsaquarelle, Bilder der Promenade des Anglais in Nizza, Porträts von Kindern.
Aber Ottilie redete und redete. Am Anfang hatte sie stur auf Französisch geantwortet, wenn Paula sie auf Deutsch etwas fragte. Dann wechselte sie ins Deutsche, betonte dabei ihren amerikanischen Akzent. Paula nahm die Konversation in die Hand, fragte nach Charlottes Leben in der Ermitage.
»Sie hat immer nur gemalt«, sagte Ottilie Moore, »sie wollte nichts anderes. Ich habe ihr alle diese Bilder abgekauft. Davon hat sie gut leben können und sich alles leisten, was sie brauchte.«
»Und was hat sie sich geleistet?«, fragte Paula schnell.
Ottilie lachte überspannt, ein kleines Rinnsal Speichel lief ihr aus dem Mund, sie schien es nicht zu bemerken.
»Rien, absolument rien, gar nichts, nur Zeichenblöcke und Farben. Sie war eine Lilie auf dem Feld, bedürfnislos, schweigsam. Wie heißt noch einmal das deutsche Wort, wenn man von allem genug hat, weil man nichts braucht?«
»Genügsam«, half Albert aus.
»Genau«, fuhr Ottilie in ihrem Redeschwall fort, »sie machte sich nichts aus Essen, aus Trinken schon gar nicht und interessierte sich nicht für schöne Kleider. Für nichts, was junge Mädchen lieben. Sie liebte nur ihre Malerei – und das Meer.« Ottilie wies auf ein Fenster, als läge dahinter das Meer. Aber durch die verschlierten Scheiben fiel nur trübes Nachmittagslicht. »Charlotte war eine begabte Künstlerin, eines Tages bringe ich sie in den USA groß raus: Alle diese Bilder werden Höchstpreise erzielen.«
Albert saß in dem Sessel, den Ottilie Moore ihm angeboten hatte, wie ein Erschlagener. Unfähig, sich zu rühren, sich gegen die Anmaßung dieser Frau aufzulehnen, die sich als Charlottes Freundin bezeichnete, aber nur ihre Vermarktung im Sinn hatte, starrte er auf den Boden und schwieg.
Da ergriff Paula erneut das Wort: »Sie können sich vorstellen, was uns diese Bilder bedeuten. Vielleicht könnten wir sie aufteilen und Sie uns die Hälfte geben? Sie werden vermutlich auch nicht alle gekauft, sondern einige von Charlotte geschenkt bekommen haben. Oder sie hat sie Ihnen vorerst in Verwahrung gegeben, weil sie uns nicht erreichen konnte.«
»Das schminken Sie sich mal ab«, fuhr Ottilie sie an. Ihre Stimme war schneidend. »Die Bilder sind mein Eigentum, kein einziges davon gebe ich her. Ich kann mit ihnen machen, was ich will.« Wie von einer plötzlichen Wut gepackt, nahm sie einige Bilder von den Wänden, löste sie aus den Rahmen und zerriss sie vor den Augen ihrer Besucher. »Das ist Didi, meine Tochter«, sagte sie und zeigte auf die Fetzen, »ich habe die Bilder nie besonders gemocht, sie sind ihr gar nicht ähnlich.«
Albert wand sich. Dieser Auftritt war so unglaublich taktlos und peinlich, dass er es nicht ertragen konnte. Er wünschte sich weit weg, weg von dieser Verrückten, die glaubte, über Charlottes Nachlass und Nachleben verfügen zu können. Lieber verzichtete er auf die Bilder, die er sich so sehr als Andenken an seine Tochter wünschte, als noch eine Minute länger die Luft mit dieser Frau zu teilen.
Aber Paula gab nicht auf. »Wir kennen den Direktor des Städtischen Museums in Amsterdam, ich glaube, er wäre bereit, Ihnen einen stattlichen Betrag für Charlottes Bilder zu zahlen.«
»Ich denke nicht an Amsterdam, ich denke an New York«, erwiderte Ottilie Moore. Offenkundig genoss sie die Macht, das Ehepaar Salomon zu Bittstellern zu degradieren. »Ein einziges Bild würde ich Ihnen verkaufen, aber welches, bestimme ich.« Sie zog sich an der Stuhllehne hoch und ließ die Augen über die Wände wandern. »Wie wäre es mit diesem Selbstporträt? Sie hat es 1940 gemalt, nach ihrer Rückkehr aus Gurs.« (4639, Abb. 1*)
Es zeigte Charlotte im Viertelprofil, das Gesicht ganz in Gelb, die Augen geheimnisvoll dem Betrachter zugewandt.
Albert nickte Paula zu: Nimm es, nimm es, egal, was sie dafür verlangt.
Ottilie Moore verlangte viel. So viel, dass sie wohl selbst der Anflug eines schlechten Gewissens streifte.
»Im Keller stehen noch drei Kartons, die mir Charlotte durch Dr. Moridis hat schicken lassen, bevor sie … na, Sie wissen schon. In ein Paket habe ich reingeschaut. Mit den Bildern kann ich nichts anfangen, sie sind unverkäuflich. Die können Sie in Gottes Namen haben.«
Albert und Paula Salomon nahmen die verschlossenen Kartons mit der Aufschrift »Propriété de Mme Moore« in Empfang und verließen fluchtartig die Wohnung. Da wussten sie noch nicht, dass sie über 1300 Gouachen Charlottes in Händen hielten, darunter die 769 Blätter, die ihre Tochter zum Leben? oder Theater? gebündelt hatte, dem einzigartigen Projekt, ihr ganzes Leben in Bilder zu fassen.
* Die mit Sternchen versehenen Abbildungen sind im Bildteil abgedruckt. Die Bildnummern verweisen auf http://www.charlotte-salomon.nl/collection/specials/charlotte-salomon/leben-oder-theater.
Abb. 1: Selbstporträt Charlotte, Gouache, 1940
Abb. 2: Franziska Grunwald steht am Fenster, aus dem sie sich stürzen wird. (4299)
Abb. 3: Charlotte träumt den Tod der Mutter. (4175)
Abb. 4: Glück der Kindheit: Ferien in Bayern (4173)
Abb. 5: Das neue Kindermädchen vermittelt Charlotte Freude am Zeichnen. (4196)
Abb. 6: Venedig (4199)
Abb. 7: Paulinkas Erfolg als Sängerin (4217)
Abb. 8: Das Geburtstagsgeschenk für Paulinka (4240)
Abb. 9: Der Tag, an dem Hitler Kanzler wurde. (4304)
Abb. 10: Charlotte will die Schule verlassen. (4318)
Abb. 11: Das große Vorbild ist van Gogh. (4351)
Abb. 12: Aufnahmeprüfung an der Kunsthochschule (4353)
Abb. 13: Amadeus Daberlohn, Gesangspädagoge (4386)
Abb. 14: Daberlohn bewertet Charlottes Malerei als »über dem Durchschnitt«. (4600)
Abb. 15: »Der Tod und das Mädchen«
Abb. 16: Des Wannsees und der Liebe Wellen (5002)
Abb. 17: Charlotte illustriert Rilkes »Malte«. (4711)
Abb. 18: Nach der Verhaftung des Vaters (5020)
Abb. 19: Vor der Fahrt ins Exil (4808)
Abb. 20: Am Mittelmeer blühen »Träume auf blauem Grund«. (4835)
Abb. 21: Verzweiflung nach dem Selbstmord der Großmutter (4907)
Abb. 22: Der unwürdige Liebhaber (4626)
Abb. 23: Gemalt mit dem Wasser des Meeres: Leben? oder Theater? (4925)
Abb. 24: Porträt Alexander Nagler (5116)
Leben? oder Theater?
Als Charlotte im Juni 1940, einen Tag nach ihrer Rückkehr aus dem Internierungslager in Gurs, in die Praxis von Dr. Moridis kam, verfiel sie unvermittelt in einen Weinkrampf. Dabei wollte sie ihn nur um Schlaftabletten bitten, um Pillen, die die Nachtmahre von ihrem Bett fernhielten, die sich auf ihre Brust setzten und ihr die Luft zum Atmen abdrückten.
»Tabletten helfen überhaupt nicht«, sagte Dr. Moridis und legte seinen Arm um ihre Schultern. »Charlotte, Sie können nur sich selbst helfen. Den Alb vertreiben Sie nicht, indem Sie auf ihn schießen. Sie müssen ihn an die Hand nehmen, damit er mit Ihnen hinabsteigt in das Reich der Vergangenheit und Ihnen hilft, Ihre Kränkungen und Schmerzen an die Oberfläche zu befördern, wie verborgenes Erz, das in tiefen Bodenschichten eingelagert ist.«
Er nahm Charlotte am Arm, führte sie um seinen Schreibtisch herum und ging mit ihr ans Fenster. Eine Weile blickten sie gemeinsam in den Garten, Blumen und Büsche wuchsen wild durcheinander, nur die Beete mit üppig blühenden Rosen verrieten die Hand des Gärtners.
»Rosen brauchen einen guten Boden, reich an Humus, und lehmig muss er sein. Sie sind Tiefwurzler, manche Wurzeln treiben sich über zwei Meter in das Erdreich hinein«, sagte Dr. Moridis. Für einen Augenblick öffnete er das Fenster, als wollte er den Duft der Rosen in das Praxiszimmer locken. »Verzeihen Sie, Charlotte, ich bin wirklich ein Feld, Wald- und Wiesendoktor. Immer suche ich in der Natur nach Entsprechungen für das Leben.«
Charlotte probierte ein Lächeln. Es fiel verzagt aus.
»Was ich sagen will: Wie die Rosen müssen auch Sie in die Tiefe gehen. Nur wenn Sie alle Verstörungen noch einmal durchleben, die aktuellen aus dem Lager, aber auch die verdrängten Ihrer Kindheit, können Sie sich von ihnen befreien. Das erfordert viel Mut. Aber Mut haben Sie doch!«
»Ich kann nicht über meine Kindheit sprechen.«
»Aber Sie können sie malen!«, riet Dr. Moridis.
Was war das: ihre Kindheit, ihr bisheriges Leben? Die Fakten, wie man sie in einen kurzen Lebenslauf presst? Geboren 1917 in Berlin als Tochter des Arztes Dr. Albert Salomon und seiner Frau Franziska, geborene Grunwald; früher Tod der Mutter, erzogen von wechselnden Kindermädchen; 1933 wegen antisemitischer Anfeindung von der Schule gegangen, 1937 die Kunsthochschule wegen antisemitischer Anfeindung verlassen, seit 1939 im Exil bei den Großeltern in Villefranche? Oder gab es andere Ereignisse, die schwerer zu fassen waren und doch ein Leben ausmachten? Fantasien, Gefühle, Wünsche, Träume, Albträume? Was war Wirklichkeit, was Vorstellung?
Ihrer Großmutter hatte sie geraten, ihr Leben niederzuschreiben, um die Depression zu überwinden. Es hatte nicht geholfen. Es war leicht, anderen Menschen Ratschläge zu erteilen. Doch wollte sie selbst mit dieser Krise fertigwerden und sich nicht wie die Großmutter aus dem dritten Stock auf die Straße stürzen, um als blutig-amorphe Masse auf dem Pflaster zu enden, musste sie einen Weg finden, sich aus dem Schattenreich zu befreien. Es hatte sich nicht erst im Lager in Gurs mit Schreckgespenstern gefüllt: mit Ratten und Typhus, mit Einsamkeit und Gefangensein. Davon war sie fürs Erste befreit, auch wenn das Trauma sie länger bedrängen würde als die elektrischen Grenzzäune.
Zum bedrohlichsten Geist aber hatte sich ihr Großvater entwickelt. Das Leben mit ihm war unerträglich geworden: seine Art, sich ihrer zu bemächtigen, zu fordern, ihr Leben ganz in seinen Dienst zu stellen, auch seinen späten sexuellen Wünschen zu gehorchen. Und jeden Tag verhöhnte er sie als eine Frau, die zum Selbstmord bestimmt war, weil Mutter, Tante und Großmutter ihr Leben so beschlossen hatten und sie die Serie besiegeln müsse: »Wann willst du dich endlich umbringen?«
Und sie sah sich vor die Frage gestellt, sich das Leben zu nehmen oder etwas ganz Verrückt-Besonderes zu unternehmen. (4922)
Etwas Verrückt-Besonderes. Etwas Wagemutiges, Unerhörtes. Vielleicht hatte Dr. Moridis recht mit seinem Rat. Sie musste ihr Leben nieder-malen. Nicht ein paar Erinnerungen illustrieren, nein, Hunderte, vielleicht tausend Bilder ihrer Vergangenheit entwerfen. Was sich zunächst wie ein flirrendes Gespinst in ihrem Kopf eingenistet hatte, gewann an Festigkeit, nahm Kontur an, wurde zum Plan: Sie würde zeichnend und malend ihr Leben neu erschaffen, es inszenieren als ein Theater, in dem Bild, Musik und Text zu einem Ganzen verschmolzen. Als ein Singespiel, in dem sie alle Funktionen übernähme: Dramatikerin, Regisseurin, Bühnenbildnerin, Kostümbildnerin, Musikerin, Technikerin, Schauspielerin und auch die Rollen aller Dramatis Personae: Ich war meine Mutter, meine Großmutter, ja, alle Personen, die vorkamen in meinem Stück, war ich selbst.
Als Kind hatte sie mit Kasperlepuppen gespielt und erinnerte sich des großartigen Gefühls, die Figuren nach ihrem Willen zu lenken, sie Abenteuer bestehen und Heldentaten vollbringen zu lassen, sie verlieren, gewinnen, triumphieren oder geschlagen am Boden liegen zu sehen. Alles war Spiel im Theater, und alles war wahr. Sein und Schein durchdrangen einander, Wirklichkeit wurde zur Vorstellung und umgekehrt.»Wir stehen immerauf dem Theater, wenn wir auch zuletzt im Ernst erstochen werden«, hatte sie bei Büchner gelesen.
So begann sie, die Menschen, die zu ihrem Leben gehörten, in Spielfiguren zu verwandeln, ihnen neue Namen zu geben und sie aus der irritierenden Nähe in eine Distanz zu verschieben, die es ihr ermöglichte, alles und alle wie mit einem Scheinwerfer oder einer Kamera aus einer gewissen Ferne zu beleuchten, zu beobachten.
Zunächst war das Umtaufen ein mutwilliges Spiel, nicht mehr als der Spaß an Abgrenzung und Ironie. Das Namengeben erinnerte Charlotte an den biblischen Adam, der von seinem Schöpfer den Auftrag erhalten hatte, »all die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel«mit Namen zu versehen. Wie Adam vor dem Sündenfall wies Charlotte jedem Geschöpf ihres Universums seinen ihm gebührenden Platz zu. Aus den Großeltern mit ihren biederen deutschen Namen Ludwig und Marianne Grunwald wurden Herr Dr. Knarre und Frau Knarre. Da hörte man den knarzig-preußischen Tonfall des Herrn Sanitätsrats, wenn er seinem Dienstpersonal Befehle erteilte, ebenso heraus wie Mariannes Lamentieren über ihren nicht standesgemäßen Schwiegersohn.
Ihre Stiefmutter Paula Lindberg, die gefeierte Opernsängerin, holte Charlotte vom Podest, indem sie ihr den lächerlich klingenden Namen Paulinka Bimbam gab. Der erinnerte an das Ding-Dong-Glockengeläute in Kinderliedern wie »Frère Jacques«. Aber mehr noch schwang für Charlotte in dem Namen die Musik Gustav Mahlers mit, in dessen dritter Symphonie der fünfte Satz mit dem Bimm-Bamm, Bimm-Bamm des Knabenchors einsetzt. So konnte sie Paula, die sich ihres jüdischen Namens Levi entledigt hatte, mit der Verbindung zu Gustav Mahler doch wieder eine Anmutung des Jüdischen verleihen.
Auch für andere Götter des Berliner Musiklebens fand sie klingende Namen. Den vielseitigen Menschen Kurt Singer, Arzt und Dirigent, verwandelte sie in Dr. Singsang und den berühmten Dirigenten Siegfried Ochs in Professor Klingklang. Die Liebe ihres jungen Lebens konnte sie boshaft zurechtstutzen. Alfred Wolfsohn, mittelloser Gesangspädagoge, der sich im Rausch Nietzsches und dessen Übermenschentums als göttliches Geschöpf stilisierte, wurde zu Amadeus Daberlohn, einem Menschen, der sich der Musik verschrieben hatte, es aber nur zu »darbem Lohn« brachte. Von Paulinka wusste sie, dass daber im Hebräischen als Anrede an eine männliche Person »Sprich!« bedeutet – eine ironische Aufforderung an einen Menschen, dessen unaufhörlicher Redefluss nicht einzudämmen war.
Nur bei ihrem Vater und ihr selbst versagte das Spiel. Ihr Vater war die Verkörperung eines Menschen, der das Gute in die Welt bringen wollte und auch im Scheitern Würde bewahrte. Seine Person entzog sich der frivolen Verwandlung in eine komische Figur. Lange grübelte Charlotte über seinen Bühnennamen nach, dann schrieb sie: Dr. Kann – ein Arzt, Charlotte Kann– seine Tochter. »Können« bedeutete doch die Fähigkeit, eine Wirklichkeit zu erschaffen und ein Versprechen zu geben auf reales Sein.
Die Bühne ihres Lebens war aufgeschlagen, mit den Namen hatte sie ihre Figuren auf die Bretter gestellt, die Farben für die Kulissen standen bereit. Das Grammofon war eingeschaltet, damit Musik ihre Geschichte inspirieren und die Szene beschallen konnte: Charlotte Salomon versuchte ihrem Leben durch die Kunst Form zu geben, brach mit herkömmlichen Ausdrucksmitteln und experimentierte mit neuen ästhetischen Möglichkeiten. Sie vermengte Elemente von Stationen-Drama, Stummfilm, Comicstrip, Daumenkino, Moritat und Cartoon, mischte wie ein Toningenieur im Studio Musik und Sprache unter und über die Malerei und kreierte so ein höchst originelles künstlerisches Produkt, wie es Vergleichbares bis dahin nicht gab – und bis heute nicht gibt. Sie riskierte viel, öffnete ihr Innerstes, trug ihre Haut zu Markte – um ihre Haut zu retten, sich als Person zu bewahren. Im Sommer 1940 begann sie ihr Werk, eine Operetta furiosa: Leben? oder Theater?
Dem ersten Entwurf folgten die Mühen der Praxis: Wie sollte sie vorgehen bei diesem Projekt? Womit beginnen? Im Schauspiel konnte man mitten in eine Szene hineinspringen, von da aus das Geschehen vor- und zurückrollen und es dem Zuschauer überlassen, im Kopf einen Zusammenhang herzustellen. Aber sie wollte eine chronologische Ordnung, auch wenn ihr bisheriges Leben alles andere als geradlinig verlaufen war, Brüche und Verwerfungen kannte, Umwege und Verirrungen. Sie würde sich zuerst mit den Frauen in ihrer Familie beschäftigen, in deren Schicksale sie sich eingebunden fühlte; das ihrer Tante Charlotte, der Schwester ihrer Mutter, die sich als junges Mädchen ertränkt hatte; das ihrer Mutter Franziska, die ihr das Leben geschenkt, sich ihr eigenes aber genommen hatte; und schließlich das ihrer Großmutter Marianne, deren Leben sie, Charlotte, hatte retten wollen, die aber vor ihren Augen aus dem Fenster gesprungen war.
Der Großvater redete von dem Zeichen, das er auf ihrer Stirn sah. Sie wollte das Zeichen auslöschen, aber sie musste es anschauen und sich mit dem Fluch, der auf den Frauen in ihrer Familie zu lasten schien, auseinandersetzen. Das könnte das Vorspiel ihres Werks sein. Im zweiten Akt, dem Hauptteil, müssten die entscheidenden Personen auftreten, die ihre jungen Jahre in Berlin geprägt hatten, ihre Stiefmutter Paula Lindberg und der Geliebte Alfred Wolfsohn. Das Nachspiel würde in Südfrankreich stattfinden und damit schließen, dass sie ihrer Malerei ein Ende setzte – aber eben nicht ihrem Leben.
Fenster zum Leben
Eine Frau steht am Fenster. Sie steht vor einem Hintergrund aus tiefem Königsblau. Dagegen hebt sich die Figur ab, gekleidet in ein sanft rehbraunes Kleid. Die Gesichtszüge der Frau sind von fragiler Schönheit: die Augen übergroß und dunkel umschattet, das Haar hochgebunden, das Gesicht lang und schmal, am Kinn in einen spitzen Winkel zulaufend, der Mund leicht geöffnet, der Hals gestreckt wie bei den Frauen Modiglianis. Die überlangen Hände liegen auf dem weißgrauen Fensterbrett, als suchten sie einen Weg nach draußen.
Charlotte Salomon malt ihre verstorbene Mutter Franziska mit den Augen einer liebenden Tochter; Sanftmut, Schönheit und Melancholie geben der Porträtierten eine gewinnende Ausstrahlung. Entrücktheit in Blau. Den Text hat die Malerin auf Tonpapier geschrieben und über die Gouache gelegt, sodass das Motiv und die intensive Farbigkeit durchscheinen: Lange stand sie so am Fenster– sehnsuchtsvoll und träumerisch. (4289, Abb. 2*)
Das nächste Bild nimmt das Motiv auf, wechselt aber die Perspektive. Die Frau am Fenster steht mit dem Rücken zum Betrachter, schaut in eine blaue Nacht, die konturlos erscheint, in groben Pinselstrichen mehr gebürstet als gemalt. Am Oval des Hinterkopfs deuten braun-rote Tupfer einen Knoten an. Das Kleid ist hochgeschlossen, mit langen Ärmeln und von einem Blau, von dem man dachte, dass Yves Klein es erfunden hätte. Die Arme hängen lose am Körper herab. Die Hände halten sich nicht mehr am Fensterbrett fest, sie berühren es nur noch, weisen dabei nicht – wie die übrige Figur – nach außen, sondern mit den Fingern nach innen: Sie strebt fort ins Ungewisse und sucht gleichzeitig im schützenden Raum zu verharren. Aller individuellen Züge beraubt, ist sie nur noch ein Schatten, eine Hülle aus zu höchster Intensität verdichtetem Blau. Noch mehr Sehnsucht, noch weniger Halt im Leben: Lange stand sie so– Ja, sie stand an diesem Fenster, denn–(4290)
Das dritte Bild dieser Sequenz öffnet die Fensterflügel weit. Das Zimmer ist leer, der Fußboden nimmt ein Drittel der Komposition ein, die Bohlen streben vertikal auf die Fensteröffnung zu. Die Wand, die das Fenster einrahmt, ist in kaltem Grün gehalten, die Flügel heller abgesetzt. Der Blick geht ins Leere, in einen einförmig hellblau verwischten Himmel, vor dem am unteren Rand der Brüstung ein schmales, mit rötlich braunen Ziegeln bedecktes Dach erscheint, darunter ein Streifen Häuserwand. Das Zimmer muss in einem hohen Stockwerk liegen, wenn man von ihm auf Dächer blicken kann.Ein stilles Leben breitet sich vor dem Betrachter aus, still und geisterhaft: Das unbehagliche Grün stört die Vorstellung eines romantischen Tableaus. Der Text vollendet die Geschichte der Frau, die sehnsuchtsvoll am Fenster stand: Jetzt steht sie nicht mehr dort.– Ach, an einem anderen Ort– weilt sie nun. (4291)
Charlotte Salomon malt die Geschichte ihrer Mutter Franziska, die sich aus dem Fenster stürzte, als die Tochter acht Jahre alt war. Drei Bilder von ungeheurer Eindringlichkeit und schockierender Verknappung entfalten die erste Katastrophe in Charlottes Leben. Das Fenster als Motiv in ihrem Werk wird sie nicht mehr verlassen, immer wieder taucht es als Symbol der Verführung auf, sich fallen zu lassen ins Nichts. Aber Charlotte Salomon findet die Kraft, es von einer Einladung zum Tode zu einer Anstiftung zum Leben umzuwidmen. Auf einem ihrer letzten Bilder wird ihr der Zeichenblock zum durchsichtigen Fenster, durch das in weiß-blauer Schönheit das Meer schimmert.
Franziska zieht in den Krieg
»Das kommt überhaupt nicht infrage!« Ludwig Grunwalds Stimme hatte die schneidende Schärfe eines Mannes, der es gewohnt ist, seinen Willen durchzusetzen. Das Besteck klirrte, als er es unachtsam auf den Teller fallen ließ.
»Pas devant les domestiques!«, mahnte seine Frau Marianne, da im selben Augenblick Grete eintrat, um den Braten nachzulegen.
Es war Ende Juli 1914, der Krieg schien unausweichlich. Erst hatte es nach der Ermordung des österreichischen Thronfolgers so ausgesehen, als sollte der Konflikt lokal begrenzt bleiben. Aber mit den Verlautbarungen des deutschen Kaisers, Österreich im Kampf gegen Serbien und dessen möglichen Verbündeten Russland bedingungslos zu unterstützen, war auch in Deutschland die Kriegsbegeisterung gewachsen. »Serbien muss sterbien«, sangen betrunkene Burschenschafter in Berliner Kneipen. Die Zeitungen schrieben, nur ein Krieg könne die Situation auf dem Balkan ein für alle Mal bereinigen und Russlands Gier nach Expansion eindämmen.
Es war ein Bilderbuchsommer. Die Menschen in Berlin standen an den milden Abenden lange auf den Trottoirs und Plätzen und diskutierten die Weltlage. Der Krieg würde nicht lange dauern, drei Monate vielleicht, und an Weihnachten wären alle Soldaten wieder zu Hause. Die Einberufungsstellen vermeldeten einen Ansturm von Kriegsfreiwilligen. Am 28. Juli war der Krieg erklärt, und die ersten Soldaten rückten an die Front.
»Das kommt nicht infrage«, wiederholte Ludwig Grunwald, nachdem Grete das Esszimmer verlassen hatte.
Franziska hatte den Eltern soeben eröffnet, sich als Krankenschwester an die Front melden zu wollen. Als Hilfsschwester, genauer gesagt. Sie habe ja nichts Ordentliches gelernt. Aber auch ungelernte Kräfte würden in den Lazaretten gesucht. (4158)
Ludwig und Marianne Grunwald waren entsetzt. Der Idealismus ihrer 23-jährigen Tochter in Ehren, aber was stellte sich denn das Mädchen vor? Als ginge es in den Krieg wie zu einem Wohltätigkeitsball? Ludwig wusste von älteren Kollegen, die im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 gedient hatten, was die Arbeit in Lazaretten bedeutete. Nur die stärksten Naturen konnten das tägliche Elend verkraften, ohne verrückt zu werden. Und Gefahr für Leib und Leben drohte immer, auch wenn das Rote Kreuz auf den Krankenzelten deutlich sichtbar angebracht war.
Es war erst ein Jahr her, dass sich Franziskas Schwester Charlotte in einem Anfall von Melancholie als Achtzehnjährige im Schlachtensee ertränkt hatte. Die Trauer über den Verlust saß bei den Eltern tief. Und jetzt eine zweite Tochter verlieren? Sie in den Krieg schicken und nicht wissen, ob sie heil zurückkommt?
»Das kommt nicht infrage«, wiederholte Ludwig ein drittes Mal. Marianne hatte den Teller mit Braten und Teltower Rübchen weit von sich geschoben und ihre Serviette an die Augen gedrückt. Franziska hielt den Blick gesenkt. Aber sie hatte immer noch das Tafelmesser in der Hand, als müsste sie sich damit verteidigen.
Fränze, wie Franziska genannt wurde, setzte ihre Eltern in Erstaunen. Das Mädchen, das oft unlustig und untätig in den Tag geblickt und sich die Zeit mit Französischstunden, Lesen und Klavierspiel vertrieben hatte, entwickelte plötzlich eine Stärke, die ihr niemand zugetraut hatte. Und sie packte ihren Vater an seiner schwächsten, der patriotischen Stelle.
»Jetzt, wo ich endlich einmal etwas Nützliches für Volk und Vaterland tun kann, willst du es mir verweigern?«
Sie sah aus wie ein Strich in der Landschaft, ein ätherisches Wesen, das sich aufzulösen drohte, sollte sich ein starker Wind erheben. Schon mit zwanzig Jahren legte sie Wert auf elegante Kleidung, betonte ihre schlanke Figur durch lange, bleistiftenge Röcke und schmal geschnittene Jacken. Konnte man sich Franziska mit blutverschmiertem Kittel und derben Schnürschuhen vorstellen?
Sie konnte sich so sehen – und sie setzte sich gegen die besorgten Eltern durch. Sie wurde Krankenschwester, nicht an der Front, aber im Lazarett des Auguste-Victoria-Krankenhauses in Berlin-Weißensee. Wenn sie am Wochenende nach Hause kam, erschöpft und gleichzeitig heiter, setzte sie sich ans Klavier und spielte Chopin-Polonaisen, spielte sie nicht so lyrisch wie früher, nicht mehr sostenuto, sondern appassionato.
Es dauerte eine ganze Weile, bis die Eltern darauf kamen, dass nicht nur der neu gefundene Sinn durch Arbeit ihre Tochter so strahlend und unbesiegbar erscheinen ließ, sondern ein Ereignis eingetreten war, das gemeinhin junge Mädchen aufblühen lässt: Franziska Grunwald hatte sich verliebt. Hatte sich in den Arzt Dr. Albert Salomon verliebt, der als Chirurg an ihrem Lazarett tätig war. Vielleicht war es auch umgekehrt gewesen: Albert hatte Franziska umworben, und sie hatte seine Liebe erwidert.
Wie ihre Eltern sich kennen und lieben gelernt hatten, war für Charlotte Geschichte. Vielleicht hatte die Mutter ihr von der ersten Begegnung mit dem Vater erzählt. Dass der von Natur aus eher schweigsame Albert Salomon mit dem Kind darüber gesprochen hatte, war unwahrscheinlich.
Charlotte stellt sich die Ereignisse, die 25 Jahre zurückliegen, in der Art eines Comicstrips vor und malt die Annäherung des ungleichen Paares, des Oberarztes und der Hilfskrankenschwester aus großbürgerlichem Hause, als diagonal verlaufende Bildergeschichte. (4160) Sie spielt in einem Ambiente, das allgemein nicht als Ort romantischer Verführung gilt: im Operationssaal. Franziska Grunwald assistiert dem Doktor Salomon beim Operieren. Der Unterleib eines Patienten liegt nackt da, den Kopf hält die Schwester mit dem Laken zugedeckt. Im weiteren Verlauf des chirurgischen Eingriffs muss Franziska dem erkälteten Operateur die triefende Nase putzen: ein Körperkontakt, der alle Vorstellungen von erotischer Annäherung der Lächerlichkeit preisgibt.
Nach der Operation geht Franziska im Krankensaal von Bett zu Bett und versorgt die Patienten. Die weitere Geschichte entwickelt sich wie die Sequenz eines Stummfilms: Chirurg und Assistentin bewegen sich aus verschiedenen Richtungen aufeinander zu, treffen sich zunächst wie absichtslos am Ende der Visite, kommen miteinander ins Gespräch, die Köpfe werden größer, rücken einander immer näher …
Im Jahr 1916 erschien der 33-jährige Dr. Albert Salomon, der immer noch aussah wie ein junger Mann Anfang zwanzig und schüchtern und ein wenig linkisch wirkte – linkisch war er nur nicht, wenn er ein Skalpell in Händen hielt –, in der Villa des Ehepaars Grunwald in der Kochstraße und hielt beim Vater um die Hand der Tochter Franziska an. (4161) Er wurde nicht gerade mit Begeisterung aufgenommen. Das Abendessen war förmlich, und die Reaktionen auf die Auskünfte über seinen Besitz (Fehlanzeige), über seine Herkunft (das kleine Dorf Röbel im Mecklenburgischen), seine Eltern (beide schon gestorben) vermittelten ihm den Eindruck, dass sich die Eltern Grunwald einen anderen Ehemann für ihre Tochter vorgestellt hatten: einen von großbürgerlichem Zuschnitt, vornehm, reich. Das Einzige, was vielleicht für ihn sprach, war seine jüdische Herkunft.
Die Atmosphäre des Grunwald’schen Hauses schüchterte Albert ein. Franziskas Mutter trug ein Gesicht zur Schau, in das reine Missbilligung geschrieben stand. Franziska selbst war, wie es sich gehörte, für das Gespräch aus dem Raum gegangen. Nach dem Ende der Befragung folgten ihr die Eltern, um sich zu beraten, und ließen Albert auf dem schweren braunen Ledersofa wie einen armen Sünder sitzen, der kein gnädiges Urteil zu erwarten hat. Schließlich kam das Ehepaar zurück, und Ludwig Grunwald erhob die Stimme – offensichtlich liebte er seine Rolle als orthodoxer Patriarch: Ja, du sollst sie haben, doch– es ist ein kostbar Gut, was wir dir da anvertraun. Er wiederholte insistierend, daß seine Tochter– auch abgesehen von der ansehnlichen Mitgift, die er bereit ist, ihr zu geben– ein besonders kostbares Gut ist, das sehr schonend und liebevoll behandelt werden müsse. (4163)
Dem künftigen Schwiegersohn erschien die Zustimmung mehr Drohung als Einverständnis. Aber da betrat Franziska den Raum, umarmte ihren Verlobten zärtlich und geleitete ihn die geschwungene Treppe des Hauses hinaus ins Freie.
Als die beiden 1916 heirateten, war Albert weiterhin Lazarettarzt, er trug bei der Hochzeit Offiziersuniform. Die Braut war schön, die Hochzeitsgesellschaft erlesen, und nach der standesamtlichen Zeremonie erklang der Hochzeitsmarsch aus Mendelssohns Sommernachtstraum. Das Mahl im großen Salon des Grunwald’schen Hauses bog zwar nicht die Tische, doch es bedeckte sie vollständig mit lauter Köstlichkeiten der gehobenen Küche. Der Krieg schien weit weg. Zum Dessert erklang »Wir winden dir den Jungfernkranz« als weitere musikalische Untermalung einer deutschen Hochzeit. Die Braut selbst bediente das Piano und wurde gebührend gefeiert. Auf den Brautchor aus Wagners Lohengrin »Treulich geführt«, als Hochzeitsmusik in deutschen Familien ebenfalls höchst beliebt, wurde verzichtet. Nicht dass man sich im jüdischen Hause Grunwald vom Antisemiten Wagner distanzieren wollte, Marianne Grunwald liebte Wagner, aber sie hatte eingewandt, dass mit der Hochzeit Lohengrins und Elsas auch schon das Ende der Verbindung des Paares beginne, das müsse man nicht unbedingt beschwören.
Ludwig Grunwald hatte seinem Schwiegersohn deutlich zu verstehen gegeben, dass als Ambiente für die erste Nacht mit einem der vornehmsten Mädchen der Stadt nur das beste Hotel am Platz infrage komme, das Adlon also. Und Albert hatte eilfertig versichert: Ja, natürlich sei das Adlon die richtige Adresse. Er liebe den Komfort, schon als kleiner Junge habe er ein Faible für schöne Hotels gehabt.
Solche Selbstinszenierung passte überhaupt nicht zum bescheidenen Albert Salomon und war darüber hinaus eine Schwindelei: Er war in bitterarmen Verhältnissen aufgewachsen, seine Mutter bei der Geburt und der Vater neun Jahre später gestorben. Wechselnde Tanten hatten mehr oder weniger bereitwillig den Jungen aufgezogen. Aber wenigstens am Hochzeitstag wollte Albert einen weltläufigen Eindruck machen.
Charlotte malt die Hochzeitsnacht des jungen Paares als Theaterstück in drei Akten, mit dem feinen Hotel als Bühnenraum. (4166) Im ersten Bild reduziert sie das Hotel auf eine mit roten Plüschläufern ausgelegte Treppe, unten flankiert von einem livrierten Diener im Halbprofil. Albert und Franziska steigen die Treppe hinauf, aber nur ihre am Rumpf abgeschnittenen Beine bewegen sich aufwärts, die Oberkörper fehlen. Im Zimmer angekommen, stehen sie im zweiten Bild nah nebeneinander, Albert umfasst die Taille seiner Angetrauten, beide halten sich an den Händen, eher furchtsam als zärtlich. Die Zimmertür ist geöffnet, als böte sie eine Fluchtmöglichkeit. Auch hier köpft Charlotte das junge Paar, schneidet es an den Schultern ab. Ganz verloren wirken die Körper inmitten der in Himmelblau getauchten Belle-Époque-Pracht einer Hochzeitssuite: Empire-Sesselchen, geschwungene Kommode mit Kerzenleuchter, opulentes Bettgestell, über dessen Kopfteil ein holzgeschnitzter Engelkopf mit Flügeln wacht. Die Bettdecke schimmert weiß und seiden.
Nach dem Rot des Aufstiegs zum Hochzeitszimmer, der feierlichen Ankunft ganz in Blau, überantwortet Charlotte das junge Paar im dritten Bild einem hoffnungslosen Dunkel. Zwei winzige Köpfchen, kaum zu erkennen, ruhen im Bett wie in einer Gruft, die Körper unter einer schweren Daunendecke verborgen. Über die Szene paust die Malerin den Satz: Es scheint grade Vollmond zu sein. Aber nicht der geringste Schimmer Mondlicht durchdringt die Düsternis der Nacht. So lässt die Malerin mit einem Anflug spitzen Spotts im Dunkel, was in dieser Nacht aller Nächte stattgefunden oder nicht stattgefunden hat.
Albert musste am nächsten Tag wieder nach Weißensee ins Lazarett. Franziska aber verstaute die Krankenschwesterhaube im Schrank, in ihren Kreisen arbeitete eine verheiratete Frau nicht. So schien nach ihrem Aufbruch ins tätige Leben ihr Arsenal an Widerstand gegen etablierte Rollenbilder mit der Hochzeit aufgebraucht; sie zog als Hausfrau in die große Fünfzimmerwohnung, die Albert Salomon in der Wielandstraße im gutbürgerlichen Charlottenburg gemietet hatte. Bald wurde sie schwanger, und am 16. April 1917 kam Charlotte zur Welt. Albert wurde gegen Ende des Krieges an die Front versetzt und arbeitete in einem Kriegslazarett in Tucquegnieux im lothringischen Frankreich.
Vielleicht wäre es für ihn möglich gewesen, als Soldat in Deutschland zu bleiben: Militärärzte wurden schließlich nicht nur bei Kampfhandlungen eingesetzt. Die Königliche Chirurgische Universitätsklinik in der Berliner Ziegelstraße, an der er seit 1909 angestellt war, wartete auf die Rückkehr eines ihrer begabtesten Chirurgen. Aber Albert Salomon war ein überzeugter Patriot und sah es als seine Pflicht an, Kaiser und Vaterland in schwerer Zeit dort zu dienen, wo er am meisten gebraucht wurde. Je länger der Krieg dauerte und das Gemetzel an der Somme und bei Verdun sich hinzog, je mehr abgerissene Gliedmaßen Salomon bis zu zwanzig Stunden am Tag in den Lazarettzelten annähte, Granatsplitter entfernte, Arme und Beine amputierte und Stöhnen, Weinen und Brüllen verletzter oder sterbender junger Soldaten ertrug, desto mehr wurde sein Glaube an den gerechten Krieg erschüttert, nicht aber seine Loyalität als deutscher Soldat.
Zweifel hob er sich für später auf, in der akuten Situation handelte er als Arzt, der alles tat, um Leben zu retten, und harrte im provisorisch errichteten Feldlazarett am Operationstisch aus, selbst wenn um ihn herum Bomben und Granaten einschlugen. Natürlich würde er den Teufel tun, seiner jungen Frau von waghalsigen Rettungsaktionen zu schreiben, sie sollte im Glauben bleiben, er praktiziere weit hinter der Front in gut ausgestatteten, von deutschen Truppen beschlagnahmten französischen Krankenhäusern.
Vorwitzig und verbockt
Charlotte war ein Schreikind. Solche Kinder schreien Tag und Nacht ohne ersichtlichen Grund. Charlotte aber erschien es im Rückblick, dass sie sehr wohl einen Grund gehabt hatte, denn sie war mit ihrer Geburt ganz und gar nicht einverstanden gewesen. Niemand hatte sie gefragt, ob es ihr recht sei, auf diese Welt zu kommen, und der grundsätzliche Protest dagegen weitete sich schon in ihrer Kindheit auf alle Versuche anderer Menschen aus, über ihr Leben zu verfügen.
In den ersten Wochen herrschte in der Wielandstraße eine allmächtige Säuglingsschwester, eine matronenhafte Person, vor der Franziska Angst hatte. Diese Frau, die Marianne Grunwald als Hilfe für die unwissende junge Mutter engagiert hatte, wusste alles: »was sich gehört«, »wie man mit Kindern umgeht«, »wie man ihnen ungezogenes Verhalten abgewöhnt«. So ließ man ein Kind durchschreien, weil es sonst zum Tyrannen wurde. So durfte man es nur zu bestimmten Zeiten füttern, weil es sonst despotische Züge annahm, so sollte es nur in einem ungeheizten Zimmer schlafen, weil es sonst als Memme ständig kränkelte.
Franziska war manchmal mit den Nerven am Ende. Doch wenn sie das kleine Wesen stillte, in dem so viel Leben steckte, dass es das ständig herausschreien musste, spürte sie zugleich, wie sich ihr eigenes Leben mit Sinn füllte. Dann schickte sie die Säuglingsschwester aus dem Raum, um die Intimität und körperliche Nähe zu ihrer Tochter zu genießen, ihr den Kopf zu streicheln, auf dem ein seidig-zarter Flaum wuchs, ihr zuzusehen, wie sie gierig und laut schmatzend die Milch einsog. Franziska war eine glückliche Mutter. Auch den hohen weißen Kinderwagen mit dem Stecknadelknopfkopf von der neuen Charlotte schob sie immer selbst. (4171)
Aber sie war viel allein mit Charlotte. Manchmal besuchte sie ihre Eltern in der Kochstraße. Die Großmutter war begeistert von dem kleinen wohlgeratenen Mädchen. Der Großvater warf jedes Mal einen prüfenden Blick auf das eingepackte Bündel, als wollte er kontrollieren, ob es noch atmete. Mehr schien ihn nicht zu interessieren. Die Eltern versuchten Franziska zu bewegen, mit Charlotte zu ihnen in die Kochstraße zu ziehen, solange der Krieg andauere. »In der riesigen leeren Wohnung in der Wielandstraße musst du ja zipfelsinnig werden«, sagte Ludwig Grunwald. Aber Franziska wollte nicht bei ihren Eltern wohnen.