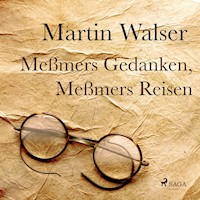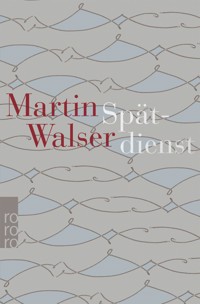12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die wichtigsten Interviews aus 40 Jahren: intellektuell brillant, weitsichtig und streitlustig. «Meine Muse heißt Mangel» – so hat Martin Walser schon früh den Ausgangspunkt seines Schreibens gefasst. Was es heißt, ein Leben als Schriftsteller und Intellektueller mit diesem Mangel zu führen, darüber geben die wichtigsten Interviews Martin Walsers Auskunft – und über so viel mehr: über Kafka, natürlich, über das Verhältnis von Literatur und Welt, die Gruppe 47, deutsch-deutsche Geschichte, große Zeitenwenden und die Größe der kleinen Momente, über das Schreiben als Belebung. Ein tiefer Einblick in das Werk und das Denken Martin Walsers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Martin Walser
«Ich würde heute ungern sterben»
Interviews von 1978 bis 2016
Über dieses Buch
Die wichtigsten Interviews aus 40 Jahren: intellektuell brillant, weitsichtig und streitlustig.
«Meine Muse heißt Mangel» – so hat Martin Walser schon früh den Ausgangspunkt seines Schreibens gefasst. Was es heißt, ein Leben als Schriftsteller und Intellektueller mit diesem Mangel zu führen, darüber geben die wichtigsten Interviews Martin Walsers Auskunft – und über so viel mehr: über Kafka, natürlich, über das Verhältnis von Literatur und Welt, die Gruppe 47, deutsch-deutsche Geschichte, große Zeitenwenden und die Größe der kleinen Momente, über das Schreiben als Belebung.
Ein tiefer Einblick in das Werk und das Denken Martin Walsers.
Vita
Martin Walser, 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren, war einer der bedeutendsten Schrifststeller der deutschen Nachkriegsliteratur. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche Preise, darunter 1981 den Georg-Büchner-Preis, 1998 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2015 den Internationalen Friedrich-Nietzsche-Preis. Außerdem wurde er mit dem Orden «Pour le Mérite» ausgezeichnet und zum «Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres» ernannt. Martin Walser starb am 26. Juli 2023 in Überlingen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2018
Die vorliegenden Texte sind auch Teil der limitierten Werkausgabe, die 2017 im Antiquariat Biebermühle erschien.
Covergestaltung Frank Ortmann
ISBN 978-3-644-00146-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Martin Walser und Tübingen
Ein Gespräch mit Peter Roos 1978
Wann sind Sie nach Tübingen gekommen, Herr Walser?
Im Sommersemester 1948, im April 1948 laut Studienbuch. Ich bin von Regensburg gekommen. Regensburg war Theologisch-Philosophische Hochschule, so nannte sich das. Dort kam ich im September 1946 hin, weil ich nirgendwo sonst einen Studienplatz erhielt. 1946 war ich neunzehn Jahre alt, nicht verwundet, nicht verfolgt, ganz kurz nur beim Militär gewesen, hatte also keinerlei Würden, die Voraussetzung waren für einen der knappen Studienplätze. So blieb mir nichts anderes übrig, als an eine jener bayerischen Rasch-Gründungen zu gehen. Es gab eine in Bamberg, eine in Regensburg. Dort waren ein paar Professoren aus Prag herübergeschickt worden, ein paar Bücher waren da, und es waren noch ein paar Theologen wie schon seit dem Jahre 1200 dabei, noch immer Scholastik genau zu lehren nach Thomas von Aquin, in denselben Mauern.
Wir haben damals mehr Studentenbühne gemacht als studiert, und wir haben vor allem das Stück eines Studenten, Heinz Schoeppe hieß er, aufgeführt. Das Schauspiel hieß Thomas, ist 1947 im Christian Kaiser Verlag in München als Christliches Gemeindespiel Nr. 83 erschienen: Es spielt in einem Wartesaal in der Nachkriegszeit. Das ist für mich ein herrliches, großartiges Stück gewesen. Der Schoeppe hat auch selber mitgespielt. Die Amerikaner haben uns einen Saal zur Verfügung gestellt, wir haben oft drei Aufführungen je Woche gemacht. – Wir hatten ein ständiges Kabarett und manchmal zwei verschiedene Stücke. Wir haben auch selber Stücke bearbeitet. Ein paar Leute, die heute noch in diesem Gelände beschäftigt sind, waren damals auch dabei, zum Beispiel der Intendant vom Tübinger Landestheater, Alf Reigl; er war unser jugendlicher Liebhaber, er war sozusagen unser Star damals, der Alfi.
Irgendwann hat das den Schoeppe – der eben ein Autor war, ein Intellektueller, ein großartiger Kerl! – nicht mehr befriedigt. Schoeppe war zwei Jahre älter als ich. Er ging weg von uns. Er hat uns verlassen, nachdem ich etwa ein Semester dort war, und ist nach Tübingen gegangen. Damals habe ich gedacht: Ja, der kann gehen. Eines Tages schrieb er mir: Ich mach, dass du auch hierherkommen kannst! Wie er das genau gemacht hat, weiß ich nicht. Die nächste Nachricht war, dass ich zu Professor Beißner in eine Art Aufnahmeprüfung kam, das heißt: Ich wurde zu einem Gespräch geladen zu Beißner, ob ich reif sei für sein Mittelseminar. Ich wusste damals natürlich nicht, wer Beißner ist – wenn ich es gewusst hätte, wäre ich zu diesem Gespräch nie erschienen. Ich bin also erst nach Wasserburg heimgefahren und dann von Wasserburg nach Tübingen mit dem Zug, wozu ich extra einen Passierschein der französischen Besatzung brauchte: J’ai l’honneur de vous recommander Mr. Martin Walser, étudiant allemand qui a jusqu’à présent fait ses études à l’université de Ratisbonne et que les autorités universitaires allemandes expulsent en quelque sorte de leur domaine sous prétexte qu’il est domicilié dans le Cercle de Lindau, et que par conséquent il doit faire ses études à Tübingen …
Im Zug von Regensburg nach Wasserburg hatte ich ein Buch angefangen zu lesen: Fontane, Effi Briest. Das hatte ich bis zur Seite 150 ungefähr gelesen, als ich zu Beißner kam. Beißner hat ein Gespräch angefangen über Autoren, und der erste Name, den er nannte, war – Fontane. Ich hatte von Fontane noch nichts gehört, zu Hause standen bei uns keine Fontanes herum, im Arbeitsdienst und im Gefangenenlager und beim Militär auch nicht, in Regensburg erst recht nicht. Hätte ich also nicht diese hundertfünfzig Seiten Effi Briest gelesen, ich hätte gar nicht gewusst, wovon der spricht. So sagte ich: O ja, Fontane, natürlich, ja, habe ich gelesen, allerdings erst hundertfünfzig Seiten. Ich habe nicht gesagt, dass ich es gerade erst gelesen hatte, ich sagte nur, ich hätte ungefähr hundertfünfzig Seiten gelesen, da war ich vorsichtig. Dann sagte ich noch, dass ich von Kafka eine Erzählung gelesen hätte, und zwar in einer Berliner Zeitschrift, die hieß Athena … Auf jeden Fall hat er mich in das Mittelseminar aufgenommen. – Ich war akzeptiert als Student, habe gleich eine Riesenlatte von Fächern belegt, zweiundzwanzig Wochenstunden – wie jeder zugeben wird: der reine Blödsinn. Aber ich musste alles belegen, was mich interessierte, und mich hat alles interessiert. Ich habe Philosophie mindestens sechs Stunden, also Guardini plus Spranger, belegt, ich habe Anglistik belegt, eine Vorlesung von Frau Gauger, dann habe ich Beißner belegt, Vorlesung und Seminar. Dann habe ich Altgermanistik bei Hermann Schneider belegt, außerdem bei Paul Kluckhohn 18. Jahrhundert, dann noch Psychodiagnostik bei einer Assistentin von Ernst Kretschmer auf der medizinisch-psychiatrischen Seite drüben hinter der Neuen Aula. Ich wollte jetzt natürlich alles wissen. In Regensburg war alles mittelalterlich eng, in Regensburg war mir alles vertraut, das war Kloster, das kannte ich sozusagen von zu Hause, von der Umgebung, zwei Tanten im Kloster, die man manchmal besucht hat – das war Mittelalter. In Regensburg war das noch düsterer präsent, als ich es schon kannte – die oberschwäbischen alemannischen Klöster sind ein bisschen lichter als diese frühmittelalterlichen, geradezu merowingischen, karolingischen Klöster von denen dadrüben.
Tübingen: das war für mich eine Riesenhalle, das war Paris, Rom – ich bin nie in Paris gewesen damals, aber ich habe mir eingebildet, dass diese Neue Aula ein Gebäude der Französischen Revolution war; wenn man in die Halle hineinging … Heute, wenn ich jetzt wieder in diese Halle hineinkomme, schaue ich immer, wo die Größe geblieben ist, denn inzwischen habe ich schon andere Hallen gesehen, jetzt finde ich sie nicht mehr so groß. Aber damals dachte ich, es kann doch gar nicht sein, dass man mich hier anwesend sein lässt.
Was haben Sie in Regensburg geschrieben, und hat Ihnen der Tübinger Studienplan überhaupt noch Zeit gelassen zum Schreiben?
In Regensburg hatte ich wegen dieser Theaterarbeit nur versucht, eine Bearbeitung von Leonce und Lena von Georg Büchner zu machen; ich habe eine Rolle hineingeschrieben, für mich selber, einen Heutigen, der das Stück mitspielt, während die anderen das historisch spielen! Für mich selber habe ich nicht viel geschrieben. In Regensburg hatte ich ja diese schöne Kameraderie der Studentenbühne. In Tübingen war ich isoliert. Kurz nachdem ich in Tübingen war, bin ich wieder heimgefahren. Der Schoeppe hat mich dann noch besucht, vielleicht sind wir sogar zusammen zu mir heimgefahren. Jedenfalls fuhr er weiter nach Regensburg, um seine Eltern zu besuchen – und ist nie mehr zurückgekommen. Er ist an Kinderlähmung innerhalb von vierzehn Tagen einfach weggestorben. Der Mann also, der mich nach Tübingen gebracht hatte, war tot. Er war vielleicht dreiundzwanzig Jahre alt, sein Vater war Arzt und so weiter – es war entsetzlich! Den hatte ich also gleich nicht mehr in Tübingen. Ich habe dann irgendwann ein Zimmer gekriegt in der Weizsäckerstraße bei einer schwäbischen Familie; da habe ich eine Zeitlang auf dem Sofa geschlafen, in einem Wohnzimmer, das die Familie kaum an Weihnachten berührt hat. Und ich habe diesem Zimmer auch sofort angespürt, dass sich hier nie jemand bewegen darf, ich also auch nicht. Da war keine Spur von Studentenbude und ausgelassenem Wohnen. Ich ging wie eine Balletttänzerin auf Zehenspitzen immer bis zum Sofa, habe mich möglichst leicht flachgelegt und dann kaum mehr geatmet die ganze Nacht durch, und am Morgen bin ich dann so schnell wie möglich wieder aus dem Zimmer hinaus. Die Familie hat sicher für dieses schöne, glänzende Zimmer viele Opfer gebracht.
Ich habe aber viel geschrieben neben dem Studium! Ich weiß nicht, ob ich immer in diese Vorlesungen gegangen bin, die ich belegt hatte; in die Seminare wahrscheinlich schon, aber ich habe auf jeden Fall viel geschrieben, an mehreren Büchern gleichzeitig. Eines nannte ich Aus einem ernsten Buch; dann habe ich ein Buch angefangen, das ich Schüchterne Beschreibungen nannte. Später in Stuttgart habe ich es erst fertiggeschrieben. Und ich habe in der Tübinger Zeit viele Skizzen geschrieben.
Im Seminar lernte ich einen Studenten, Peter Adler, kennen, dessen Frau bei der Tübinger Presseagentur Herzog Lektorin war. Mit dem Ehepaar Peter und Kathrinchen Adler bin ich da bekanntgeworden, wir sind heute noch Freunde, wir sind zusammen nach Stuttgart gezogen, dann wieder hierher in die Gegend – damals hat sich also etwas Lebenslängliches angebahnt. Plötzlich sah ich: Da kann man etwas verkaufen. Also habe ich einmal einen Schub hingegeben, sie haben mir das auch abgekauft, ich glaube, ich bekam 20 Mark für einen ganzen Schub Manuskripte. Davon habe ich mir weiße, lederne Tennisschuhe gekauft, die ich mindestens zwanzig Jahre lang getragen habe. Das waren hervorragende Schuhe. – Der Herzog hat meine Sachen angeboten, und als ich in Stuttgart war, habe ich ihm immer wieder Texte geschickt. Den ersten Abdruck hat er, nach langem Anbieten, am 29. September 1949 in der Frankfurter Rundschau erreicht, und weitere dann in kleineren Zeitungen.
Die Geschichten damals haben noch nichts mit Kafka zu tun. Was ich geschrieben habe, ist einfach abstrakte, weltlose, inhaltsarme Prosa, mehr Attitüden als Etüden, die davon handeln, dass einer allein in einem Ort ist, in dem er zu wenig Leute kennt, also durch Menschenleere, durch Kontaktlosigkeit erzeugte Bewusstseinsbewegungen. Wenn man keine Leute kennt und wenn man überhaupt keine gesellschaftliche Existenz hat, dann gehen auch keine Straßen und keine Häuser und keine Plätze in einen über; das kann man offenbar nur auf dem Umweg über Menschen erreichen. Es gab aber in Tübingen eine Studentenbühne; vielleicht hat der Schoeppe mir damals auch dorthin noch den Weg gewiesen, denn ich wüsste nicht, wie ich sonst dorthin gekommen wäre. Hier lernte ich Hans Gottschalk kennen, der heute Filme macht in München; bei dem habe ich dann später gewohnt in Stuttgart, wo wir fürs Fernsehen arbeiteten. Durch den Gottschalk lernte ich Helmut Jedele kennen, und mit Gottschalk, Jedele und Peter Adler und noch anderen haben wir in Stuttgart zuerst Funk, dann Fernsehen gemacht.
Dann kam das zweite Semester mit anbrechendem Goethe-Jahr 1949, und dazu haben wir ein Kabarett gemacht, ich glaube im Rittersaal da droben auf dem Schloss irgendwo. Ich weiß nicht genau, was wir gemacht haben; es waren irgendwelche Goethe-Juxereien. Da auch Helmut Jedele dabei war, der gute Beziehungen zum Rundfunk hatte, kam auch jemand vom Funk und hat sich dieses Goethe-Kabarett angeschaut. Der hat mich gefragt, ob ich mal beim Funk mitarbeiten wollte. Inzwischen war ja die Währungsreform gewesen, ich hatte vom Landkreis Lindau ein Stipendium erhalten in Höhe von 1500 DM für das gesamte Studium! Rückzahlbar, wenn ich einmal selber etwas verdienen würde. Die Währungsreform, wie gesagt, damit war es bei mir finanziell sowieso ganz aus. Dieses Angebot, nach Stuttgart zu gehen in den Funk, selber Geld verdienen zu können, war verführerisch. Ich bin nach dem Sommersemester 49, also nach dem dritten Semester in Tübingen, nach Stuttgart gegangen, blieb aber eingeschrieben als Student. Ich habe in Stuttgart beim Radio alle möglichen Abteilungen passiert, zuerst die Unterhaltungsabteilung, dann die politische Abteilung als Reporter, dann als Redakteur in der politischen Abteilung. Nach den Ferien bin ich nicht mehr nach Tübingen zurückgegangen, weil ich Angst hatte, diese Geldquelle belegt zu finden von einem anderen Durstigen. Es war ein bisschen irrsinnig, denn ich wollte ja Geld verdienen, um zu studieren, und dann habe ich das Geld verdient, um Geld zu verdienen. Auch zu Vorlesungen war ich nicht mehr in Tübingen. Nirgends mehr bin ich hingegangen, nur noch belegt, aus irgendeinem Trotz, weil … Auch meiner Mutter hatte ich nicht gesagt, dass ich praktisch aufgehört hatte. Meine Mutter hätte das als Scheitern oder mit einem viel furchtbareren Wort bezeichnet, verkrachter Student zum Beispiel. – Auf jeden Fall hätte sie das nur mit großer Trauer zur Kenntnis nehmen können. Ich wusste nicht, wie ich das jetzt irgendwann einmal lösen würde; ich habe es einfach einmal schleifenlassen. In der Zwischenzeit war ich immer wieder in Tübingen, habe für den Südfunk über die Tübinger Studentenbühne geschrieben.
Dann passierte etwas: Ich hatte mir damals natürlich schon – siehe oben! – Reportagen aus dem Geist-Feld so ein bisschen unter den Nagel gerissen: Theater, Universität. so wurde ich ein andermal nach Tübingen geschickt, um ein Interview zu machen mit Professor Erbe, damals Rektor der Eberhard Karls Universität. Ich bin mit meinem Tontechniker wieder den Gang in der Neuen Aula entlanggegangen, rechts vor, und plötzlich kommt auf der anderen Seite des Gangs uns entgegen – plötzlich war der Gang doch wieder sehr breit und groß! – Professor Beißner, mit diesem für den Körper immer ein bisschen schweren Kopf, leicht vorgeneigt. Ich grüß’ betreten, weil ich ja längst nicht mehr erschienen war in seinen Veranstaltungen, er grüßte herüber und sagte so ganz freundlich und unvorwurfsvoll, aber dadurch umso durchdringender, auf das Leiseste konstatierend, über den Gang herüber: So, Sie haben es auch aufgegeben! – Ich war schon vorbeigelaufen; aber beim Heimfahren hab ich gedacht: Das stimmt ja nicht! Ich hatte mir selber noch nicht eingestanden, dass ich es aufgegeben hätte. Da habe ich mich gefragt: Hab ich’s aufgegeben? Keinesfalls konnte ich mir eingestehen, dass ich aufgegeben hätte. Ich bin also mit unserem Übertragungswagen, einem alten roten Dodge – damals hatten wir noch keine tragbaren Mikrophone, da kam man immer mit einem riesigen, amerikanischen Dodge-Kastenwagen und einer langen Leitung, die durch alle Fenster geschleift werden musste! –, heimgefahren nach Stuttgart und habe gedacht: Das kann ja nicht wahr sein! Inzwischen war ich im Begriff zu heiraten – und ich sollte das Studium aufgegeben haben? Ich bin also heim und habe mir mein Zeug angeschaut; inzwischen im Jahr 1949/50 im Winter. In Stuttgart habe ich richtig angefangen, Kafka zu lesen, bin zu meinem Chefredakteur gegangen und habe gesagt, ich müsste jetzt ein paar Monate eine Doktorarbeit schreiben, worauf er sagte, es wäre besser, wenn ich vom Außendienst weggehen würde. Er hat mich in den Innendienst versetzt, mich angestellt mit 500 DM pro Monat. Und so konnte ich nebenher diese Arbeit machen. Ich hatte mittlerweile mehr Kafka gelesen, und es war mir klar, dass ich mich am liebsten mit Kafka beschäftigen würde.
Warum?
Weil ich den am liebsten gelesen habe. Alle Bücher, die ich gerade angefangen hatte, zum Beispiel André Gide hatte ich angefangen zu lesen, in diesem Zeitungsdruck von rororo, Die Verliese des Vatikan, Die Falschmünzer und so weiter, kamen mir unsäglich undicht, zerstreut und beliebig vor. In diesen Kafka-Monaten hat sich außer Dostojewski bei mir kein anderer Autor mehr gehalten – die wurden alle weggewischt von Kafka. Ich wollte gar nichts anderes mehr lesen, weder Stücke, noch Gedichte, noch irgendetwas. Ich wollte nur noch das lesen, das hat mich interessiert, mit dem konnte ich mich direkt beschäftigen, es waren ganz direkte Mitteilungen an mich.
Lag damals eine Kafka-Stimmung in der Luft? Hat es mit den Existenzbedingungen der Nachkriegszeit zu tun? Mit Ihrer eigenen geographielosen Tübinger Zeit?
Ich kann es überhaupt nicht erklären. Da ich ja innerlich noch nicht nein und ade gesagt hatte zum Studium und jetzt denke: da muss man eine Doktorarbeit machen!, obwohl ich nur noch in der Papierform weiter belegt hatte, muss ich mich ja jetzt mit Kafka wehren gegen diese Drohung, dass ich aufgegeben hätte. Mir war es auch klar, dass ich mich wiederum mit Kafka nicht inhaltlich beschäftigen konnte; mir war klar, dass ich Kafka nicht interpretieren konnte; dazu hatte ich kein Vermögen, keine Beziehung. Ich konnte Kafka in nichts anderes überführen als aus seinem Zustand in einen anderen, nichts Eigenes beanspruchenden Sprachzustand. Das war mir klar.
Ich habe dann eben angefangen, einfach äußerlich wie ein Bausachverständiger oder jemand, der Bausachverständiger werden will und ein Gebäude einschätzen muss – also Türen zählen, wie die Treppen zu den Stockwerken, wo die Ausgänge liegen –, eine Beschreibung einer Form zu machen. Ich bin wieder in das Doktorandenseminar zu Beißner zurückgekehrt. Vorlesungen konnte ich ja nicht hören, weil ich in Stuttgart arbeiten musste. Ich habe dann im Dezember 1950, nachdem diese Doktorarbeit abgeliefert und akzeptiert worden war, mich zum Rigorosum angemeldet. Mein Verhältnis zur Universität lässt sich hier am besten illustrieren: Der Professor, bei dem ich meine mündliche Prüfung in Geschichte machte, Professor Rothfels, diesen Professor hatte ich bis zur Prüfung noch nie gesehen, ich hatte kein Seminar, keine Vorlesung besucht, sondern von der Fakultät kriegte ich auf einer Karte mitgeteilt, ich sollte mich am Freitag um 10 Uhr in der Wohnung von Professor Rothfels in der Wildermuthstraße einfinden zur mündlichen Prüfung, auch die Telefonnummer war angegeben, im Fall ich mich vorher noch über irgendetwas mit Professor Rothfels verständigen wollte. Eine Situation, die ja heute nicht mehr gut denkbar ist, und ich glaube, nicht mit jedem deutschen Professor wäre eine solche Prüfungsverabredung, auch in Tübingen nicht, oder vielleicht gerade in Tübingen nicht, möglich gewesen. Nachgerade kann ich sagen, dass ich glaube, dass der Emigrant Rothfels vielleicht einfach die Formalitäten anders einschätzen gelernt hat als ein ewig am Orte beschützter Professor, der dafür weniger Verständnis gehabt hätte.
Es war also vorbei, und ich war in Stuttgart.
Und Tübingen nachher?
Ich könnte natürlich jetzt anfangen zu plaudern von Sachen am Neckar oder Sachen dadroben und dadrüben. Ich habe Herrn Weischedel nach seinen Vorlesungen die Hände waschen und trocknen sehen in einer Form, wie ich sie nur vom Pfarrer in Wasserburg von der Kirche kannte – nach der Wandlung hat unser Pfarrer auch die Hände so durch die Luft bewegt wie der Weischedel. Oder Spranger, der seine, ich hoffe von ihm selbst auch nicht ganz geglaubten, einfachen Seele-Geist-Einteilungen an die Tafel gemalt hat; oder Kretschmer habe ich gesehen und gehört, diese Vorlesungen haben mich oft mehr interessiert als die in der Philosophischen Fakultät und so fort. Es ist – wie gesagt – ein vollkommen ungeordneter Vorrat, den ich da habe.
Ich war verbaut für das direkte Erleben, obwohl ich da auch an allen möglichen studentischen Veranstaltungen teilgenommen habe. Ich habe ja auch Schicksal, wie man so sagt, erlebt, als der Schoeppe gestorben ist, stellen Sie sich das vor! Ich hätte nie gewagt – schon die Ausdrucksform «nie gewagt» ist zu positiv gesprochen! –, es kam überhaupt nicht in Frage, etwas von dieser Erfahrung, dass der Schoeppe gestorben ist, überhaupt aufs Papier, in die Nähe dieser Erfahrung, zu bringen. Das war so tabuisiert, so unmöglich, es wäre mir so gemein vorgekommen, eine solche Sache, die da mit dem Schoeppe passiert ist, schriftlich darzulegen. Auf jeden Fall, alles, was wirklich war in Tübingen, war total und vollkommen hermetisch vom Schreiben abgeschlossen. Das kann nicht heißen, dass ich da nicht gelebt hätte – ich habe ja auch Leute gesehen und weiß, auf welchen Bänken ich gesessen bin, ich weiß auch, wie ich Stadelmann über Bismarck gehört habe, ich kenne die Professoren, ich sehe doch noch den schönen Guardini da stehen und noch schöner reden. Das alles habe ich auch miterlebt, aber das ist bei mir nicht durchgekommen – also Realismus in dem Sinne, dass man sich da so direkt verhalten kann zu einer Erfahrung, das war alles nicht möglich.
Kannten Sie damals Walter Jens schon? Sie waren Student zu dieser Zeit, er war bereits Dozent – wie war das Verhältnis?
Ich weiß nicht mehr, durch wen ich ihn kennengelernt habe. Jens war natürlich mehr als eine Stufe höher, ein Mensch, der auch schon publiziert hatte. Unter dem Pseudonym Walter Freiburger hatte er Das weiße Taschentuch veröffentlicht – Jens war für uns eine von den Zukunftspersonen. Ich hab da gestern Abend noch, nach unsrem Gespräch, einen Tagebuchzettel vom 21. Juni 1949 gefunden; damals hab ich mir aufgeschrieben: Jens hat mich heute wieder zwei Stunden lang totgeschlagen. Er muss nur schauen, sprechen und die Hände mittun lassen. Aber oft tun die Hände viel mehr. Seinen Roman hat er in vier Wochen geschrieben.
Jens hat damals ein Manuskript von mir, die Schüchternen Beschreibungen, an den Rowohlt Verlag geschickt. Der Verlag hat sie ihm wieder zurückgeschickt; die wollten das nicht. – Walter Jens war ja damals Altphilologe. Wenn der damals schon einen solchen Lehrstuhl gehabt hätte wie heute, dann hätte ich natürlich immer beim Jens gehockt. Aber zur Altphilologie konnte ich mich ja nicht mehr emporschwingen, ich konnte kein Griechisch. Ich musste also auf meinem germanistischen Flügel bleiben.
Ich bilde mir ein, ich war im Hörsaal, als der Germanist Hermann Schneider triumphierend von seinem Katheder in den überfüllten Saal ausrief: Ich reiche nur bis 1832 – aber das «nur» war keine Ironie. Er war glücklich, dass er nur bis dahin reichte. Und als Professor Beißner für meine Dissertation einen Ko-Referenten suchte, fand er keinen, der über eine Kafka-Arbeit mitbefinden wollte. Wenn es mir richtig berichtet wurde, hat Professor Kluckhohn damals gesagt, er würde diesen Ko-Referenten machen, wenn er diesen Kafka nicht auch noch lesen müsse. So habe ich es damals wenigstens gehört. Mit so etwas Neuem wollte man in Tübingen wenig zu tun haben. Dabei war Kafka natürlich auch schon fast dreißig Jahre tot.
Haben Sie in dieser Tübinger Studienzeit auch Ihren späteren Verleger Siegfried Unseld und Ihre späteren Kritiker Hellmuth Karasek und Rolf Michaelis, die ja auch Beißner-Schüler waren, kennengelernt, oder kam das erst später?
Mit Unseld war ich im gleichen Seminar, aber ich war wenig da, und er war etwas voraus in dem Doktorandenseminar. Er ging vor mir weg. Wir waren zwar im selben Raum, aber wir haben uns nicht näher kennengelernt, noch nicht praktisch, wie man einander so kennt, wenn man in höheren Semestern ist. Richtig haben wir uns dann erst kennengelernt in der Verlagsarbeit. Die jüngeren Kollegen Karasek und Michaelis dürften erst dahin gekommen sein, als ich schon weg war.
Für mich stand Tübingen wahrscheinlich – von heute aus kann ich es so sagen! – unter einem ziemlichen Angstdruck. Ich war kaum dort, da kam die Währungsreform; dann hatte ich diese insgesamt 1500 DM, und dann wäre Schluss gewesen. Innerlich wollte ich Schriftsteller werden, äußerlich wusste ich, dass ich meiner Mutter eine Art bürgerliche Ausbildung vorspielen musste. Aber das musste ja auch finanziert sein. Ich war nicht losgelassen, es war keine sorglose Studienzeit. Ich musste feststellen, dass ich drei Semester lang in Regensburg nichts gelernt hatte, nicht viel, Althochdeutsch hatte ich gelernt bei einem Professor aus Prag, einem hervorragenden Altgermanisten, Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch konnte ich, glaub ich, besser als die Tübinger Kommilitonen. Das hat mich gefreut, dass ich da eine gewisse Ausbildung hatte. Aber sonst war ich doch blank. Meine Kinder, wenn sie achtzehn Jahre alt sind heute, haben mehr gelesen, als ich im sechsten Semester gelesen hatte. Ich hatte nur nach meiner Neigung gelesen, nur Kafka und Dostojewski, Schiller, Hölderlin – das waren die Autoren, die ich wirklich gelesen habe. Alles, was ich sonst noch hätte lesen sollen, habe ich dann nachgelesen, ich habe auch den Nachsommer nachgelesen, den Wilhelm Meister; damals erschien Lotte in Weimar, habe ich auch gleich gelesen. Ich versuchte sogar, den Faustus zu lesen im Omnibus und habe ihn selbst auf dem Sofa nicht weiterlesen können, weil ich diese Prosa nicht ertragen konnte. Gut. Aber ich bin, als ich nach Stuttgart ging und dann nur noch ein Papierstudent war, praktisch wie ein Hochstapler nach Tübingen zurückgekommen, universitätsmäßig gesehen bin ich immer ein Hochstapler geblieben. Das fing schon früher an: In der sechsten Klasse Oberschule bin ich zur Heimatflak, mit siebzehn bin ich zum Arbeitsdienst gekommen, dann zum Militär, dann habe ich nach dem Krieg in einem Dreivierteljahr das Abitur nachgemacht, ich habe mich in eine Abiturklasse hineingemischt, in der eher Ältere waren. So habe ich auch in der Oberschule eine Mordslücke, was sich an meinen Französischkenntnissen zeigt. Später kam wieder eine Mordslücke – in meinem Ausbildungsgang gehe ich wirklich auf lauter Löchern, auf sehr spürbaren Löchern. Deswegen nehme ich mir manchmal Zeit, jetzt macht es mir Freude, mich mit Romantik zu beschäftigen wie ein Student und viel zu lesen und nachzuholen.
Damals war das alles ein Angstgelände: diese beeindruckende Neue Aula! Schon die Universitätsbibliothek war für mich unbenützbar! Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, auf jeden Fall: mich hat die ganze Formalität UB weggespickt von sich, ich konnte gar keine Bücher richtig ausleihen, weil mir alles zu kompliziert, nicht handhabbar erschien. Ich bin oft im Seminar gesessen und habe so in diese Bücher hineingeschaut, und die Zeilen sind sozusagen unter meinen starren, stehenden Blicken durchgerauscht wie Gebirgsflüsse, verstehen Sie; es war nicht zu greifen, ich hatte kein Verhältnis zu dem, was ich hätte tun müssen. –
So bin ich auch wieder draußen gewesen, bevor ich richtig drin war. Ich habe nie auf acht ruhige Semester vorausgesehen!
Sind da auch soziale Probleme im Spiel? Die Uni als Ausbildungsinstitution für die obere Mittelschicht – Sie als der kleinbürgerliche Gastwirtssohn aus Wasserburg?
Dazu die geographische Veränderung: Waren Regensburg und Tübingen und Stuttgart einfach nur Schlenker auf dem Weg zurück zum Bodensee?
So sehen Sie das jetzt – ich habe es nicht so gesehen, damals. Dann habe ich doch Radio gemacht in den komischsten Formen: Ich bin herumgefahren und habe jeden Tag einen anderen Bürgermeister interviewt, obwohl ich mich natürlich nur für die Kultursphäre interessiert und lieber andauernd Kortner interviewt hätte, von mir aus auch noch Karajan, was ich auch einmal getan habe. Ich hätte am liebsten nur das gemacht – aber ich musste zu unendlich vielen Bürgermeistern fahren und Brücken einweihen. Damals wurden ja über jedem Bach die Brücken wieder eingeweiht, die habe ich alle mit eingeweiht. Ich konnte Brückeneinweihungsreportagen auswendig, und zwar von allen Gesprächspartnern, vom Architekten, vom Bürgermeister, vom Pfarrer – und meinen Text!
Stand dem literarischen Handwerker Walser die wissenschaftliche Begabung entgegen? Sind es zwei Valenzen in Ihnen? Ist der Essay für Sie ein Mittelweg?
Die Schreibweise halte ich nicht für eine andere, das muss ich jetzt ganz laut ausdrücken. Ich halte es nicht für zweierlei, sich über Goethe oder über eine Flussfahrt schreibend zu äußern. Das meine ich nicht. Ich glaube, Bücher über Bücher zu schreiben und Bücher sozusagen über sich selber zu schreiben, ist kein ganz ernsthafter Unterschied. Das habe ich inzwischen noch bei mehreren Leuten gesehen; Leute, die Germanistik studieren oder Literaturwissenschaft betreiben, sind ja auch Romanschriftsteller – die schreiben dann Romane über Goethe oder so. Die schreiben sie in wissenschaftlicher Form, aber das ist kein ernsthafter Unterschied, diese sogenannte Fiktion und das andere, die Non-Fiction. Das wächst für mein Verständnis viel näher beieinander, als es in der Öffentlichkeit gehandelt wird.
Was war denn Beißner für ein Typus in dieser Gelehrtengalerie? Beißner hat sich damals schon auf Ihren Kafka und auf Unselds Hesse eingelassen.
In meiner durchlöcherten und fragmentarischen Universitätsgeschichte ist der Beißner einfach die irrsinnige Ausnahme, weil der lebendig war von Sekunde zu Sekunde im Seminar. Ich war ja vor allem im Seminar, nicht so sehr in den Vorlesungen. Ich habe auch einmal eine Beißner-Vorlesung gehört, da hätte ich wahrscheinlich wacher sein sollen – aber vielleicht war die auch sehr verschränkt. – Beißner war für mich das große Entgegenkommen, weil er nicht verlangt hat, Literatur zu übersetzen – die anderen haben ja alle übersetzt. Es war ja auch die große Mode, Kafka ins Existenzialistische zu übersetzen wie Camus, Kafka ins Jüdisch-Theologische zu übersetzen, überhaupt ins Religiöse zu übersetzen wie Max Brod, Kafka ins Marxistische zu übersetzen, Kafka ins Psychoanalytische zu übersetzen wie Charles Neider, Kafka dahin und dorthin zu übersetzen. Die Kafka-Übersetzungen kursierten damals an der Kafka-Börse. Beißner dagegen hat nichts anderes gemacht als Kafka der Autor, der Erzähler Franz Kafka; wenn man Leuten, die nicht bei Beißner waren, davon erzählt hat, haben die so ein bisschen darüber gelacht, sagten: Jaja, das mit der Perspektive und so. Damals habe ich noch nicht gewusst, dass Beißner da ununterbrochen vom Wichtigsten redet. Mir hat nur eingeleuchtet: seine Enthaltsamkeit gegenüber dem Aufdrängen von Bedeutungen in dieser sogenannten Dichtung. Dass er die Sache hat entstehen lassen aus dem Text, ganz unambitiös, gar nicht überladen, gar nicht besserwisserisch.
Ich habe seinen ganzen Hölderlin-Kampf natürlich nur am Rande miterlebt, diese Hölderlin-Streite, diese Ausgaben, diese ihn verzehrende Arbeit, die Dankbarkeit und Undankbarkeiten, die da gewachsen sind, und so weiter. Beißner, das war für mich ein Glücksfall.
Ihr Vater war zu dieser Zeit schon gestorben. Worauf lag denn für Sie bei Beißner als Doktorvater die Bedeutung: mehr auf Doktor oder mehr auf Vater?
Das stimmt – der Ton, den Sie da anschlagen, der trifft mich zweifellos. Ich bin ausbeutbar geradezu, weil ich mich an solche Herren dann hinwerfe und merke erst zehn Jahre später, dass ich da wieder einmal nach einem Vater gegriffen habe; man greift natürlich manchmal furchtbar in die Dornen. Beißner habe ich so verehrt, vielleicht habe ich da schon so etwas Väterliches gesucht. Ich hatte ja keine private Nähe zu ihm. Ich war nie bei ihm zu Hause, habe nie mit ihm ein Glas Wein getrunken, ich habe nie mit ihm eine private Unterhaltung gehabt. Ich habe ihm einmal eine Hölderlin-Rede gewidmet und nie gehört, ob er furchtbar schimpfte. Nur was ich bei ihm gesehen habe: ihn als Fachmann, als den älteren Fachmann, als den einzigen Fachmann, der genau jenen Zugang zu einem Text vormacht, den man unter allen Umständen einem anderen auch noch anbieten kann, weil er fast voraussetzungslos ist, weil er fast nur den Text selber in eine konzentrierte Aufmerksamkeit bringt, auseinandernimmt und durchgängig und durchschaubar macht. Ich habe gesehen, dass das geht, und das war einzigartig.
Noch einmal zurück zum angesprochenen gesellschaftlichen Konflikt: Sie als Sohn eines Gastwirts mit hautnahem Kontakt zu Leuten in der sterilen Atmosphäre einer Universitätsenklave, in der die Verkehrsformen zwischen den Menschen doch sehr indirekt und über soundso viele Stufen und Themen vermittelt sind.
Ich weiß. Damals verkehrte ich als Student natürlich wie jeder in einem kleinen Kreis. Ich habe Einzelne schon genannt aus diesem Kreis von Leuten, die ähnlicher Herkunft waren wie ich. Ich war zum Beispiel bei Professor Stadelmann, einem sehr guten Historiker, auch zu früh gestorben, ein hochfahrender, jäher, energischer Professor, der Bismarck gelesen hatte. In diesem Seminar war nicht nur ein Nachkomme von preußischem Adel, also Nachkomme von Leuten, die damals bei Bismarck die Geschichte als Botschafter oder Sekretäre erlebten, die also irgendwie namhaft waren: Also haben da die Herren von Schweinitz und von Sowieso geredet, haben die Memoiren oder die Briefe ihrer Tanten aus Petersburg mitgebracht. Das hat mich beeindruckt, aber nicht gelähmt.
Für mich als besonders neugierigen Frager in Richtung Tübingen ist es sehr unbefriedigend, dass Sie ganz bestimmte Erfahrungen, die Sie in Tübingen gemacht haben, ausblenden. Warum eigentlich? Und: Was ist Tübingen heute für Sie? Kannten Sie den legendären Verleger vom Schwäbischen Tagblatt und Privatgelehrten Ernst Müller? Und wie sieht der Kontakt zu Bloch, Jens und Hans Mayer aus?
Ich blende sie nicht aus, ich blende sie noch nicht ein. Dabei denke ich an eine Menge stimmungsmäßig streng gebundener Tübinger Örtlichkeiten, die bei mir gehortet liegen, zum Beispiel eine schöne Frankfurter Konditortochter, eine Germanistik-Theologie-Studentin aus Worms mit einem besonders schön geflochtenen blonden Kranz oben die Frisur krönend, die auf eine ganz bestimmte Weise immer ihre Tasche hingestellt hat und deren Aura ich zum Beispiel schon kaum durch Blicke zu stören wagte und wahnsinnig erstaunt war, dass mein Kollege und Freund Gert König nicht nur mit Blicken, sondern mit Sätzen in deren Germanistik-Theologie-Aura ohne weiteres eingedrungen ist. All das ist eine Zuschauerexistenz, die selber keinen Punkt hat, auf dem sie stehen kann; diese mächtige Traditionsuniversität: Wo du hinschaust, ein Institut, und alles voller Bewährtheit, da eben bist du ein Hochstapler, aber du bist nicht lustig – ich habe keinen Humor entbinden können. Ich habe mich nie diesem Krull-Humor, dieser norddeutschen Variante von Humor, anschließen können, weil zu dieser Art von Verschmitztheit sehr viel hochverbürgte, großbürgerliche Existenz dazugehört, um sie überhaupt erleben zu können. Das habe ich nie gekonnt. Deswegen fand ich es auch nicht lustig.
Nicht zuletzt dürfte ein Umstand meine Tübinger Existenz zu einer Art Phantomexistenz gemacht haben – meine Freundin. Meinen Gefühlsschwerpunkt hatte ich zu Hause am Bodensee – meine jetzige Frau Käthe. Man hat sich zwei- bis fünfmal in der Woche einen Brief geschrieben, man hat niemals telefoniert, das gab es nicht, man hat nie unter dem Semester daran gedacht, am Samstag etwa mit dem Zug über Aulendorf, Ravensburg, Friedrichshafen heimzufahren. Die Zugfahrt kostete circa 6 DM bis 10 DM, und ich glaube, dass man mit 40 DM damals die ganze Woche ausgekommen ist – es war ein irrsinniger Preis. Auf jeden Fall, diese Überlegung, einfach wegzufahren und wieder herzukommen, wie heute mit einem Auto oder Zug, gab es gar nicht. In unseren Briefen hätte das vielleicht als Utopie, als Raumzeitalter, auftauchen können, sodass man also mehr oder weniger ein ganzes Semester voneinander getrennt war – eigentlich eine furchtbare Weise mit zweiundzwanzig Jahren. Das mag dazu beigetragen haben, dass ich dezentralisiert und nicht auf festem Boden dort stand, sondern schwankend in Tübingen einfach nicht ganz vorhanden war, dass ich kein richtiges Leben dort hatte in diesen Örtlichkeiten. Ich denke an den Marktplatzbrunnen in Tübingen, an ganz bestimmte Esslokale: da tritt man im Sommer aus dem Hellen in ein dunkles Studentenesslokal, da sitzt ein ganz bestimmter Mann, da könnte ich jetzt den Namen preisgeben: der hieß Reinhard Raffalt. Der hat damals schon in der Stiftskirche Orgel gespielt, später hat er Stücke geschrieben, war Korrespondent des Bayerischen Rundfunks in Rom und ist jetzt gestorben; er war vielleicht acht Jahre älter als ich, war sehr bekannt in Tübingen als Orgelspieler. Man wusste, er ist auch ein sehr gebildeter Mann, ein Bayer, ein Literat. Er erschien uns Studenten unglaublich hochmütig, einfach weil er alles Mögliche schon hatte, was wir noch nicht hatten. Wenn ich die Begegnung mit einem solchen Mann in einer Studentengaststätte bedenke – wo er lächelnd aufblickte, wenn wir Nullen eintraten, und ich mich auch so als Null angeschaut fühlte von dem, der gerade seine Hände von berühmten Orgeltasten genommen hatte! –, dann weiß ich, ich bin dem Etablierten zum ersten Mal begegnet. Es war ein Erlebnis für mich; in meine Nichtswürdigkeit, in meine Identitätslosigkeit hat das natürlich gepasst, dass da einer sitzen musste, der schon so unheimlich fest umrissen war, dass ich umso nichtser wurde, wenn ich in so ein Lokal trat, in dem er schon saß.
Und heute: Hans Mayer ist für mich eine lebendige Postadresse, und auch Bloch immer ein Grund, wieder nach Tübingen zu kommen, ihn zu besuchen mit Unseld zusammen. Bloch ist also auch eine Tübinger Adresse für mich – vor allem für euch, Peter Roos: ihr, eure Generation, ist zu Bloch, wegen Bloch nach Tübingen gekommen! Als ich den ersten Band vom Prinzip Hoffnung in die Hände bekam, 1959 oder 60, war Bloch ja noch in Leipzig, da war er noch nicht in Tübingen. Er ist erst 61 gekommen. Für mich ist Bloch natürlich auch nicht Leipzig, sondern für mich ist Bloch Ludwigshafen, oder Bloch ist der Rhein. Wenn ich Bloch höre, den Bloch-Ton, einmal von der Syntax abgesehen, soweit er Akustik ist – ist er Ludwigshafen, das Pfälzische. Das hat mit Tübingen nichts zu tun. – Ernst Müller ist dagegen also ganz sicher jemand, den ich so direkt und spürbar nicht hätte empfinden und erleben können, wenn ich nie in Tübingen gewesen wäre. Das stimmt. Als ich Ernst Müller zum ersten Mal in Stuttgart traf und wir einen Abend lang in Kontakt gerieten, da konnte sich dieser Kontakt natürlich bei mir beziehen auf Tübingisches, und Ernst Müller war plötzlich jemand, der mir unheimlich vertraut vorkam, obwohl ich gar nicht wusste, warum, aber das war dann also halt Tübingen. Das ist auch bei mir ein akustischer Reiz, weil er einfach in seiner Sprechweise alle gehörten Klänge Tübingens wieder aufgereizt hat, abgesehen von seinem sonst ehrwürdig breiten schwäbischen Wesen.
Das Bloch-Jens-Hans-Mayer-Gespann ist da abstrakter. Jens hat mich am Leben erhalten mit Tübinger Kleinbildern. Ganz von selbst, ohne dass er es vielleicht beabsichtigte, hat er mir, wenn ich ihn 1955 oder 57 traf oder später, schnell ein kleines Bild entworfen, wie er, als er zum letzten Mal über die Neckarbrücke ging, dem Professor Beißner begegnete, und wie er Beißner gegrüßt und der ihn wiedergegrüßt habe auf der Brücke, und er hat mir auch das Gesicht von Beißner angedeutet, ganz schnell, kurz und scharfgezeichnet, und so hatte ich wieder ein ganz echtes Tübinger Miniaturbild – Jens und Beißner auf der Neckarbrücke. Damit war also Tübingen wieder für ein Jahr lang repräsentiert.
Ansprüche an die Romanform
Ein Gespräch mit Irmela Schneider 1981
In Ihren Reden und Aufsätzen betonen Sie immer wieder die Bedeutung, die Hölderlin, Kafka und Robert Walser für Sie haben. In welcher Weise wirkt sich eine so enge Traditionsbindung auf den eigenen Schreibprozess aus?
Kafka hat mich in einem Augenblick des Prosaschreibenwollens getroffen, sodass ich jahrelang nicht anders konnte, als mein eigenes Schreibenwollen unter dem Klischee dieses Meisters ausbilden zu müssen. Ich bin jahrelang davon nicht losgekommen. Das war für mich eine Art universaler Resignation, als ich feststellen musste, nicht nur durch die Beobachtung dessen, was ich selber machte, sondern auch durch das Herumschauen in Europa und in der Welt, dass in der Kafka-Nachfolge sozusagen kein Roman mehr zu schreiben ist. Die, die das probiert haben, sind, glaube ich, ehrenvoll gescheitert. Ich habe unwillkürlich kürzere Prosastücke unter seinem Einfluss geschrieben, habe aber gemerkt, dass ich meine eigenen Erfahrungen, soweit sie romanhaft zu Buche schlagen wollten, in seinem Zeichen nicht habe ausarbeiten können.
Sehen Sie Ihr Romanschreiben in einer bestimmten literarischen Tradition?
Ich glaube, das ist die Crux beim Romanschreiben, dass es darin wenig Tradition gibt, viel weniger sicher als beim Theaterschreiben. Brecht hat eine ganze Reihe von Autoren beeinflusst, das kann man feststellen. Sie haben bei ihm was gelernt, und das merkt man, dass sie was gelernt haben. Beim Romanschreiben, das ist ziemlich schlimm für die ganze Gattung, wird wenig gelernt. Zum Beispiel glaube ich aus eigener Erfahrung, dass die meisten Autoren die Form des Romans gar nicht ernst nehmen, dass sie gar nicht glauben, dass es so etwas gibt wie eine Romanform. Für mich spielt die Romanform seit 1975/76 eine erahnbare Rolle. Vorher habe ich so eine Art Ich-Oratorien geschrieben. Jetzt habe ich das Gefühl, ich müsste meine eigene Romanform entwickeln.
Sie haben ja einmal die Lyrik als die höchste Form bezeichnet.
Lyrik ist die begehrenswerteste Ausdrucksweise oder die anspruchsvollste Ausdrucksweise, weil sie den größten Formwiderstand mit der größten Unmittelbarkeit synthetisieren können soll. Deswegen findet sie auch ziemlich selten statt.
Auf diesem Anspruchsniveau.
Ja, aber darunter ist es nicht. Das wäre im Grunde genommen auch das, was man vom Roman verlangen müsste, aber bei der Lyrik kann man es gedichtweise mit einem Blick fast überschauen: Hier ist es. In einem Stefan-George-Gedicht, in einem Stefan-George-Schlager, Im Jahr der Seele: Komm in den totgesagten Park und schau … – Das ist vollkommen. Und jetzt das Erzählen, nicht nur als Satz für Satz, sondern auch noch als Romanform, das heißt, ein glücklich sich rundendes Abenteuer aus nichts als Sprache heraus wirtschaftend, aus der Antwort, die man selber gezwungen ist, seinen Erfahrungen zu geben. Das ergäbe einen Roman. Und das ist auch schwer, gerade das sich Rundende, was zum Abenteuer gehört. Zum Abenteuer gehört der Schluss, und der Roman stammt wie alle Literatur aus der Religion, und die Religion ist der Versuch, ein Happy End aus einer Wüste und aus einem Wust von gegensprecherischen Erfahrungen herauszuwirtschaften. Das ist eben Kunst, diese Sinnlosigkeitswüste mit so einer Produktion zu beantworten. Und wenn man das nicht will, wenn man nur die Misere ihren Ton haben lassen will, dann braucht man erst gar nicht zu schreiben, dann soll man stammeln oder Surrealismus machen oder ich weiß nicht was.
Ich will ein Stichwort aufgreifen: Literatur als «bastardisierte Religion».
Das ist ein Understatement, eine die Herkunft vermuten lassende Formulierung.
Wenn man an die Formulierung von Marx denkt: Religion als Seufzer der bedrängten Kreatur und gleichzeitig Opium des Volkes, trägt dann nicht jedes literarische Werk notwendig diese Ambivalenz von schlechter Affirmation und Protest in sich?
Beide Meinungssplitter von Marx wären mir unzureichend als Charakterisierung dessen, was Religion ist. Das ist viel mehr. Der Seufzer ist zu wenig, weil Seufzer ja unmittelbar ist und Religion ist Form, Opium kann alles werden, da braucht es nicht Religion, alles was wir produzieren, kann umschlagen ins Gegenteil, alles kann formalisiert, entleert, hierarchisiert werden. Das passiert nicht nur der Religion. Wenn ich Religion sage, dann meine ich immer erstens meine Kindheitsgeschichte, von der ich natürlich weit weg bin, aber das habe ich ja erlebt, das war ja das literarische Erlebnis schlechthin, die ersten Geschichten, die man mir erzählt hat, von Absalom, Susanne, Abraham und Isaak. Das waren die ersten Geschichten, die ich gehört habe, und die waren natürlich noch vor Kafka da und haben deswegen noch mehr gewirkt auf mich. Auch die Rundungen dieser Geschichten sind natürlich ein unglückliches Vorbild für jeden, der Erzähler wird, weil auf diese Weise keine Geschichten mehr zu runden sind. Aber gut, nehmen wir mal an, dass man sich das so vorstellen kann, dass die Literatur eine geschichtliche Nachfolgerin dieser Bilderproduktion Religion ist, dann kann sie es auch auf sich nehmen, wie Sie es meinten, das hat sie ja auch oft bewiesen. Natürlich kann sie beides sein, natürlich kann sie Licht und Dunkel machen, das ist nicht schlimm, das ist eben so.
Natürlich gibt es eine Menge affirmativer Literatur. Mir kam es darauf an, ob in dieser Parallelisierung von Religion und Literatur die Implikation enthalten ist, dass Literatur notwendigerweise auch affirmativ sein muss.
Ich hatte einmal Anlass, mir das genau zu überlegen, und bin da zu einem für manche aktuelle Komplikation beschämenden Ergebnis gekommen. Ich möchte das, was ich jetzt sage, nicht für jede aktuelle Situation wieder anwenden oder anwenden müssen: nämlich wenn es heute möglich ist, dass irgendein negativer gesellschaftlicher Anlass, um es ganz abstrakt zu sagen, Anlass für Literatur wird, dann ist unter unseren Umständen selbst die negative Antwort eines Schriftstellers auf diesen negativen Anlass in der Wirklichkeit auch zu einem Teil Affirmation. Adorno hat in seinem Aufsatz Versuch, das Endspiel zu verstehen gesagt, Brecht sei affirmativ mit seiner ganzen Kritik, und das meinte Adorno böse, kritisch gegen Brecht, während irgendeine Unverständlichkeit Becketts unheimlich kritisch sei.
Durch die Verweigerung.
Ja, Entschuldigung, ich bin ja weit draußen, Laie am Rande – ich finde das blödsinnig. Ich finde schon, dass Brecht affirmativ ist, wenn er sich einlässt auf Wirklichkeit, aber ich finde, das ist nicht kritisierbar. Ich finde das ungeheuer gut, dass Brecht die Wirklichkeit in seine Diskussion so hineinzieht und dass die Wirklichkeit so mit sich reden lassen muss, und dass er ihr Darstellungsstrenge ablistet usw. Seinen ganzen listigen Umgang mit der Wirklichkeit finde ich bewundernswert. Es ist mir aber auch klar, dass das affirmativ ist. Aber das ist für mich etwas anderes, als Adorno es gemeint hat. Für mich ist das Affirmative daran, dass die Wirklichkeit doch schon so akzeptabel ist, dass man mit ihr reden kann und dass ich mir nicht selbst eine Pistole bastle und eine Revolution mache. Nur das meine ich damit. Es gibt Verhältnisse, da kann man nicht mehr schreibend umgehen damit, da muss man was anderes tun. Und wenn wir in diese Verhältnisse gekommen sind, wo wir uns auf diese Weise auseinandersetzen, ist jede schriftliche Äußerung auch etwas Affirmatives, auch die – in Adornos Sinne – becketthafte Verweigerung. Aber so wie es Adorno dort gesagt hat, da finde ich, das haben die Verhältnisse nicht verdient, das würde wohl auch kein Schriftsteller, der an diesem Allgemeinen, nämlich an der Sprache, so interessiert ist, das würde, glaube ich, keiner, wenn er nicht von allen guten Geistern verlassen ist, wollen. Denn dann benutze ich nicht Sprache. Dann mache ich wiederum etwas anderes, dann ist selbst Tachismus viel zu sehr ABC. Dann mache ich doch überhaupt nicht Ausdrucksgewerbe, dann nehme ich doch Sprengpaketchen und lege sie irgendwohin. Das ist doch dann viel vernünftiger, dann weiß ich wenigstens sicher, dass ich mich nicht eingelassen habe.
In Ihrer Abgrenzung scheinen Sie mir, was auch mit Ihrer Hinwendung zum Roman und dem zunehmenden Interesse am Roman zusammenhängt, von einer positiv gearteten Geschichtsphilosophie auszugehen, die bei Beckett ja zu einer negativen geworden ist.
Ich gehe nicht von irgendeiner Philosophie aus, aber ich habe ein Bedürfnis, natürlich, dass diese kurze Zeit mit Illusionen verbracht wird, die die Kürze dieser Zeit erträglicher machen, und dass sich die Kürzen dieser Zeit miteinander verbinden lassen, von einer Generation auf die andere, weil das sonst einfach ein bisschen blödsinnig ist.
Eine weitere Formulierung, die prägend geworden ist und die Sie auch schon häufig erläutert haben: Schreiben als Ausdruck eines Mangels. Was mir auffällt: Sie umschreiben diese Standortbestimmung mit gesellschaftskritischen Kategorien, und die Gestalten des Romans – etwa in Seelenarbeit und in Schwanenhaus – bekommen diesen Mangel nicht gesellschaftspolitisch in den Griff, sondern privatisieren ihn. Sie tun genau das, was die Gesellschaft abverlangt, nämlich erst einmal alle Misserfolge als persönliche Niederlagen zu sehen. Wie kommt es eigentlich zu dieser Umkehrung?
Nein, die Umkehrung würden Sie sozusagen verlangen. Sie verlangen die Deduktion, wo ich erzählerisch nur induktiv liefern kann. Das ist ja so, dass man nur auf diesem Wege zu etwas kommt. Ich habe ja keine Geschichtsphilosophie, ich komme ja nicht denkend zu etwas, ich komme ja nur – pathetisch ausgedrückt – erleidend zu etwas. Ich reagiere ja nur auf Mangelerlebnisse. Und wenn man dieses Reagieren eine Zeitlang betreibt, dann wäre es unlauter, wenn man in den Bereichen, in denen man auf Erleiden geradezu angewiesen ist, nun arbeitend die Umkehrung vollzöge. Aus dem Erleiden ist man zum Denken gekommen. Und jetzt würde man umgekehrt schreiben, als sei man durch Denken zur Erkenntnis gekommen. Das wäre unlauter, wenn man diese Chronologie umkehrte. Denn schauen Sie, ich weiß nicht, ob dies Beispiel Ihrem Zwecke dient, ich schlage es einmal vor, da es mein aktuellstes Beispiel ist, das ich gerade erlebt habe: Ich habe in mehreren Zeitungen erstaunend von Kritikerkollegen über Das Schwanenhaus gelesen, von Kritikern, die nichts dagegen hätten, wenn ich sage, sie seien, verglichen mit mir, grob gesagt, deutlich politisch rechts von mir. Sie haben sich über mich fast ein bisschen lustig gemacht, weil ich einen Makler als Romanhelden nehme und dies nicht als verurteilte Figur, sondern – wie man in diesem Jargon sagt – als eine positive, zur Identifikation angebotene Figur. Das ist ja schrecklich, einen solchen Kapitalistenknecht nimmt der Walser, und der will als das und das gelten, was weiß ich, so was nimmt der als Identifikationsfigur, und offenbar mag er den auch noch! Ich will nicht über die Realismusfähigkeit von solchen Kollegen etwas sagen, aber die tun so, als könnte man eine Hauptfigur haben, die man nicht mag, mit der man nicht eine Sympathie, mit der man nicht eine Art Mitleiden hat. Also da sehen Sie schon die ungeheure Oberflächlichkeit, die darin liegt, wenn man die Welt so einteilt. Wenn ich z.B., das kann ich gar nicht als Projekt planen, aber wenn ich von meiner Kindheit an bis zum heutigen Tag in sehr verschiedenen Wirtschafts- und Gesellschaftsbereichen eine intensive Erfahrung mit Konkurrenz erlebt habe und schreibe dann einmal einen Roman, lasse den selbstverständlich in der kleinbürgerlichen Perspektive spielen, wo allein ich zu Hause bin, und dann gibt es ein Vorurteil, weil so ein kleinbürgerlicher Beruf wie ein Makler nicht mit einer gesellschaftlichen Aura, mit einem Gratisselbstbewusstsein ausgestattet ist, dass es geradezu seelischen Ekel auslöst, sich mit so einer Figur zu identifizieren. Da muss ich sagen, das sagen Leute, die bedenkenlos mit jedem Bankdirektor jedes Mittagessen einnehmen, aber unfähig sind, so einen schlichten, christlich-demokratischen Tatbestand zu akzeptieren, dass ein Makler, der Erfüllungsgehilfe der freien Marktwirtschaft, als Identifikationsfigur hier angeboten wird. Nur mit der vollkommenen Übereinstimmung mit solchen Figuren kann etwas Gesellschaftliches durch mich selber, in mir, für mich geklärt werden, schreibend. Und ich nehme an und habe Anlass dazu, dass viele Leser eine solche Vorwegverurteilung einer solchen Figur auch nicht mitmachen, sondern sie werden vielleicht doch beim Lesen einfach auf das kommen und sagen: Was wird in so einem Manne angerichtet durch solche Bedingungen. Sie kommen auf all das selber.
Ich komme noch mal zurück auf das Phänomen, das ja beide Zürns auszeichnet, nämlich dass sie ihre Schuld nur privat sehen, sich individuell die Schuld am Versagen zuschreiben, einem Versagen, das gesellschaftliche Ursachen hat. Wenn Sie Ihre Figuren so agieren lassen, so scheinen Sie sich für mich von ihrer intellektuellen Haltung oder Erkenntnis verabschiedet zu haben. Als Leser wenigstens habe ich immer das Bedürfnis, den Figuren einen kleinen Tipp zu geben, dass sie nicht an allem selbst schuld sind.
Nun ja, das ist schön, das ist ja wunderbar, das ist fabelhaft.
Hat der Autor dieses Bedürfnis nicht auch?
Meine Diskretion ist vollkommen, das gehört zu meinem Handeln, weil ich den Roman ernst nehme. Nun können Sie sagen, wählen Sie eine andere Perspektive. Das kann ich aber nicht, weil dann meine ganze Atmosphäre verlorengehen würde. Meine Perspektive ist, dass ich seit 1976, seit Jenseits der Liebe, in einer vollkommenen Verbundenheit mit der Hauptfigur erzähle, aber trotzdem in der dritten Person. Die erste Person ist für mich für eine gewisse Zeit nicht mehr interessant, mich interessiert jetzt die dritte Person. Und mich interessiert, dass die Gegenüber dieser Hauptfiguren meistens stärker sind als meine Hauptfiguren, und ich kann meinen Hauptfiguren keinen Kommentartrost mitgeben oder einen aufklärerischen oder sonst einen, sondern alle Leiden – jetzt übertreibe ich etwas – gehen direkt durch die Hauptfigur auf den Leser weiter. Der Leser kann sich dann solche Gedanken machen, wie Sie sie gerade angedeutet haben, und ich glaube, das findet statt. Ich habe auf meine früheren Bücher nie solche Briefe gekriegt, wie ich sie jetzt kriege, Briefe der Auseinandersetzung. Die Leute schreiben jetzt immer von sich, sie schreiben mir über sich, parallel zu diesen Zürn-Figuren. Früher haben sie mir etwas über die Sprache geschrieben, ganz anders, gar nicht so unwillkürlich, jetzt sind wir sozusagen Kriegskameraden.
Würden Sie mir nicht doch zustimmen, dass es eine Art Rollenaufteilung bei Ihnen gibt zwischen der intellektuellen Zugangsform zu Problemen und der schriftstellerischen?
Also, zum Beispiel, ein Kritiker, der hat mir vorgeworfen, da sei jetzt der Roman für den Maklerbungalow geschrieben worden, und ich sei offenbar ein Erzähler, der ohne Denken nicht auskomme. Er meinte wohl auch, ich hätte da denkend eingreifen müssen. Ich bin aber nicht sicher, ob ich der Mann dazu wäre.
Ich fordere hier nicht den auktorialen Erzähler.
Das dachte ich ein bisschen.
Forderungen zu stellen, daran habe ich hier kein Interesse. Mir geht es darum, ob es in Ihrem Selbstverständnis nicht doch eine Rollenaufteilung gibt, die Sie vielleicht sogar bewusst vornehmen.
Eine Zeitlang habe ich das auch erlebt: den Unterschied zwischen dem und jenem Aufsatztext, den ich geschrieben habe, und dem und jenem Roman. Oder man hält eine Rede und schreibt einen Roman. Es ist natürlich verhältnismäßig einfach, in der Sprache der Meinungen Wünschbarkeiten auszudrücken, und es ist ein anderes, das mit dem Material der Wirklichkeit zu erzählen. Meinungen sind zu haben, die sagen nicht sehr viel. Ich glaube, das, was möglich ist innerhalb einer Zeit, konkret zu wünschen, das ergibt sich erst aus einem Roman. Zum Beispiel zunehmend ein Problem: der Romanschluss. Wie gut kann ein Roman aufhören? Ich hasse schlecht ausgehende Romane, und ich habe ein unheimliches Bedürfnis, dass der Roman gut ausgehe. Aber ich kann natürlich keinen guten Schluss draufpappen und kann ihn nicht erlügen, kann ihn nicht erfinden. Aber ich versuche aus dem Material, das ich habe, den besten Romanschluss herauszuschreiben. Das kann ich aber nur, wenn die Wirklichkeit ihn mir bietet. Ich weigere mich, einen Romanschluss zu schreiben, der eine ungeheuer kritische Potenz enthielte, aber diese Potenz erzielte mit einer reinen Fiktion, die in der Wirklichkeit keinen Gewährsmann mehr hat.
Ihre Romanschlüsse sind ja aber doch nur sehr punktuell positiv, es kann sehr rasch wieder umkippen.
In einem ironischen Buch ist es leichter, einen positiven Schluss zu machen, das ist klar.
Ihre gesellschaftspolitischen Aussagen werden in den siebziger Jahren härter, resignativer, etwa wenn Sie sagen, dass jetzt eigentlich das erreicht ist, was Erhard angestrebt hat, nämlich die total formierte Gesellschaft. Da stimmen Sie ja auch mit vielen Ihrer Kollegen überein. Zugleich wird es in Ihren Romanen irgendwo freudvoller.
Der Blick auf den Kampf hat sich zweifellos verändert. Ich würde mir heute nicht mehr zutrauen, eine aktuelle Sequenz in einen Roman hineinwirken zu lassen, um damit irgendetwas Positives darin repräsentiert zu haben. Am Beispiel: Ganz früher einmal habe ich, etwa 1964, ein zerknirschtes schlechtes Gewissensverhältnis zu so einer Figur wie Lumumba gehabt, der in der Weltpolitik eine Rolle spielte und durch unsere europäischen Auftraggeber von diesem Mobutu ermordet wurde. Damals hat natürlich jeder ein schlechtes Gewissen haben müssen, der ein Europäer ist, weil man diesen Mann ermordet hat. Und die Schamlosigkeit, wie dann seine Witwe fotografiert wurde. So etwas habe ich nicht abhalten können von dem Roman, an dem ich gerade arbeitete, auch weil ich selber einen Freund habe, einen schwarzen Schriftsteller, der in dieser Bewegung mitarbeitete. So hatte ich meine Beziehung dazu. Und trotzdem: Ich würde mir das nicht mehr gestatten, denn das ist exotisch. Es ist sogar exotisch, wenn Sie das Gute, das sie im Gange sehen wollen, in so eine Figur wie, in Jenseits der Liebe, in den Betriebsrat legen, so ein Engel auf dem Leichtmotorrad, der brav arbeitet, wenn auch seine kommunistische Partei dann alles wieder an einer höheren Stelle versiebt. Sehen Sie, so geht es nicht, mit solchen Randfiguren irgendeine schöne Tendenz vertreten zu lassen. So geht es nicht. Das Wichtigste muss in der Hauptfigur untergebracht sein. Ich habe in meinem letzten Roman das Geld aufgenommen in die Essenzen der Personen. Das ist für mich Arbeitsprogramm. Nur muss ich da viel weiter gehen und kommen, als ich bis jetzt gekommen bin. Aber da findet der Kampf statt. Sie nennen das mit einer nach meiner Meinung nicht ausreichenden Bezeichnung das Private. Ich glaube nicht, dass das Verhältnis einer Hauptfigur zum Geld im Roman etwas Privates ist.
Sie haben angedeutet, dass Sie bei der Gestalt Zürn bleiben wollen. Wird es immer eine Gestalt sein, die vielleicht bewusst Zürn heißt, die eben nicht zum Zorn fähig ist?
Das ist ein Nebenreiz, der fast mehr in Ihrem Sprachklima daheim ist als in meinem. Zürn ist ein häufiger Name in unserer Gegend, und er ist mir als Name sympathisch. Es ist auch eine Spielerei, zu der ich mich da gedrängt fühle. Ich habe ja angefangen mit dem Franz Horn und dem Helmut Halm und jetzt diese zwei Zürns. Das waren halt die einsilbigen, in Halbkonsonanten endenden Namen. Es ist ein kleiner Nebentrip, den ich da habe. Natürlich, wenn Sie es so damit verbinden, so wird wahrscheinlich der große Zorn nie ausbrechen. Wenn ich Ansprüche an mich stelle – ich will nicht nur mit diesem Zürn arbeiten, ich möchte mindestens noch einen Gallistl-Roman schreiben –, so ist es das, dass das Wichtigste, was auf mich wirkt, eben in den Romanen eine rein erzählerische Reaktion erfährt, weil ich dieser Reaktion vertraue. Es ist natürlich ein unbeweisbares Vertrauen, dass ich sage, man erlebt etwas und man prüft nicht die Verarbeitung. Man hat das Vertrauen, das Erzählen sei eine Verarbeitungsart. Wenn Sie solche Wörter bringen wie etwa Denken, Privates, so muss das nicht unbedingt an Ihrer speziellen, auch beruflich bedingten Sprachverwendung liegen. Das kann auch objektiv darin zum Ausdruck kommen, dass ein oder zwei Jahrzehnte oder vielleicht noch mehr Jahrzehnte nicht mehr richtig erzählt worden ist. Das heißt: das Erzählen ist so anspruchslos geworden. Man möchte seine Rechtfertigungen durch eine Beschränkung erreichen, mit deren Hilfe man immer authentischer zu werden hofft und dann eben außer der Misere nichts mehr authentisch sein lässt. Das wird natürlich immer authentischer und immer anspruchsvoller. Wenn aber jetzt richtig erzählt würde … – aber das ist ja etwas, was man nicht künstlich ausweiten kann, das kann man natürlich nicht als Programm beliebig weit stecken, konzipieren. Das bringt nichts. Das wäre nichts als Betrug. Aber andererseits erleben alle Menschen – und da sind Erzähler nicht ausgenommen – andauernd das Wichtigste, und trotzdem spielt das Wichtigste meistens keine Rolle in den Büchern.
Von welchem Zeitpunkt an ist das Erzählen für Sie anspruchsloser geworden, hat es – im emphatischen Sinn des Wortes – aufgehört?
Mit dem Schloss von Kafka hat es aufgehört. Danach ist nicht mehr so viel geschrieben worden über das, was zentral war und umfassend: dass nämlich ein Held nicht die Hauptsache ist, dass die Gegenwelt existiert, dass das ein Kampf ist, diesen Kampf ernst zu nehmen, wirklich ernst zu nehmen, ihn auch schreiberisch so ernst zu nehmen, wie er für jeden Menschen ernst ist, also auch für den Autor ernst ist. Heute tun ja alle nur so, als seien sie als Selbstporträts auf der Welt, und das kann nicht wahr sein.
Sie haben gestern die Vorlesung über Ironie hier in Frankfurt abgeschlossen. Sie selbst sagen, die Arbeit über Ironie sei eine Nebenarbeit über längere Jahre hinweg gewesen. Mir scheint das aber nicht zufällig zu sein, dass Sie sich kontinuierlich gerade um dieses Thema bemüht haben. Gibt es nicht doch so etwas wie eine Sehnsucht nach der Möglichkeit, einen ironischen Roman zu schreiben?
Ja, natürlich. Das ist die vollkommenste, weil am meisten verwandelnde, den meisten Widerstand bietende Prosaform. Da liegt auch die Chance und die Verführung, wieder konzentrisch und umfassend zu sein. Das ist alles klar. Aber man kann sich dem nicht auf direktem Wege annähern, auch nicht denkend. Ich habe diese Ironiesachen mit Passion betrieben, weil es mich interessierte, dass es so etwas gegeben hat, dass so etwas möglich war, aber ich weiß, dass von dieser Beschäftigung zu eigenem Tun überhaupt kein Weg führt. Da muss ich auf der Praxisseite meine Minischrittchen gehen.
Porträt Martin Walser
Ein Gespräch mit Anton Kaes 1984
Herr Walser, in Ihrem Vortrag What is an Author?, den Sie vor kurzem hier als Gastprofessor in Berkeley gehalten haben, ging es um die Frage nach der Identität des Schriftstellers. Lässt sich eine solche Identität heute überhaupt generell bestimmen? Worin würden Sie Ihre Identität als Schriftsteller sehen?
An ihren Mängeln. Oder, wenn ich den Vortrag zitieren darf: What author has the identity of an author? I only know that Hölderlin, Kafka and others vacillated to the bitter end about the assessment of their own selves. Oder mit Blick auf Muse, Inspiration, Kreativität: only someone who lacks something has anything to say. Also, meine Muse heißt Mangel. Wenn ich einen Schriftsteller treffe, der schriftstellerisches Selbstbewusstsein ausströmt, habe ich das Gefühl, er habe sich pensionieren lassen.
Wenn Sie sagen: «Meine Muse heißt Mangel», so möchte ich Sie doch fragen, Mangel an was?
Der Wilhelm Meister wurde geschrieben, weil für einen Bürger damals zu wenig Selbstbewusstsein vorhanden war. Aus demselben Mangelerlebnis stammt Fichtes Wissenschaftslehre: der Armeleutebub, Leinwebersohn aus der Niederlausitz, musste sich ein Selbstbewusstsein nach einer möglichst unangreifbaren, also fast mathematischen Methode ableiten, erdenken, weil die Wirklichkeit, sprich Gesellschaft, für seinesgleichen Selbstbewusstsein nicht vorgesehen hatte. Der auf seinen Mangel reagierende Schriftsteller veröffentlicht ihn und – unter günstigsten Umständen – damit auch noch die dafür verantwortlichen Bedingungen.
1969 schrieben Sie in einem programmatischen Aufsatz mit dem Titel Über die neueste Stimmung im Westen wie folgt über die soziale Funktion und den Status des Schriftstellers: «Wir sind Freizeitgestalter in spätkapitalistischen Gesellschaften. Wir stellen Produkte zur Verfügung, mit denen andere, fast immer Lohnabhängige, ihre freie Zeit vertreiben. Manche von uns vertreiben Hunderttausenden die freie Zeit. Wir können uns dieser Funktion nicht willkürlich anpassen. Wir sind angepasst, sonst wären wir unbrauchbar und könnten von dieser Arbeit nicht leben.» Was wäre dem heute, vierzehn Jahre später, hinzuzufügen?