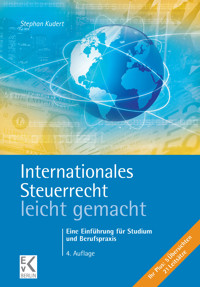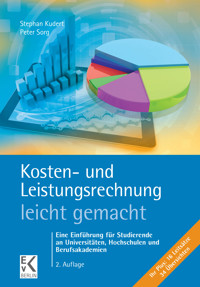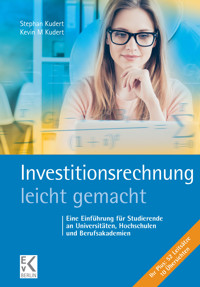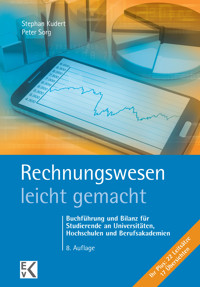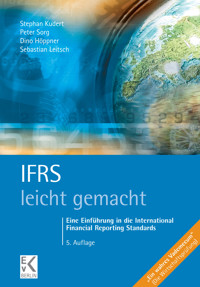
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Wissenschaft & Praxis
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Hier werden die International Financial Reporting Standards in leicht verständlicher und bewährt fallorientierter Weise dargestellt. Aus dem Inhalt:
– Rechnungslegung und Abschluss nach IFRS
– verbundene und kapitalmarktorientierte Unternehmen
– Erstbewertung und Folgebewertung
– Bilanzierung von Aktiva und Passiva
– Finanzinstrumente und Leasingverhältnisse.
Eine unerlässliche Lernhilfe für die Klausur, aber ebenso Beistand im Berufsalltag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
leicht gemacht® – Fachwissen aus Taschenbüchern
Die Gelbe Serie: Recht
Die Blaue Serie: Steuer und Rechnungswesen
[1]
BLAUE SERIE leicht gemacht®
Herausgeber: Dr. jur. Dr. jur. h.c. Helwig Hassenpflug Richter Dr. Peter-Helge Hauptmann
IFRS
leicht gemacht
Eine Einführung in die International Financial Reporting Standards
5. neu bearbeitet Auflage
Professor Dr. Stephan Kudert
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Professor Dr. Peter Sorg
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
Dr. Dino Höppner
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Professor Dr. Sebastian Leitsch
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt
Ewald v. Kleist Verlag, Berlin
[2]
Besuchen Sie uns im Internet:www.leicht-gemacht.de
Autoren und Verlag freuen sich über Ihre Anregungen
Umwelthinweis: Dieses Buchwurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedrucktGestaltung: Michael Haas, Joachim Ramminger, BerlinDruck & Verarbeitung: Druckerei Siepmann GmbH, Hamburgleicht gemacht® ist ein eingetragenes Warenzeichen
© 2021 Ewald v. Kleist Verlag Berlin
[3]
Vorwort
Die positive Resonanz auf die vorhergehenden Auflagen hat das didaktische Konzept der bislang in der Reihe „… leicht gemacht®“ erschienenen fallorientierten Einführungen bestätigt. Dieser Band soll Ihnen die International Financial Reporting Standards, kurz IFRS, nahe bringen. Das Buch kann und soll die einschlägige Fachliteratur, insbesondere Kommentare und Aufsätze in Fachzeitschriften, nicht ersetzen, sondern eher darauf vorbereiten. Es ist als erste Einführung für Studierende an Universitäten, Hochschulen und Berufsakademien konzipiert, aber ebenso für Praktiker geeignet, die sich mit der Internationalisierung der Rechnungslegung beschäftigen möchten oder müssen.
Die didaktischen Hinweise sollten Sie auch in diesem Band genau beachten: bei jeder im Text aufgeworfenen Frage vor dem Weiterlesen erst selbst nachdenken. Zusammenhänge, die man versteht, muss man nicht auswendig lernen! Alle deutlich gekennzeichneten Leitsätze und Übersichten genau einprägen und vor Beginn einer neuen Lektion wiederholen. Alle zitierten Standards nachschlagen und durchlesen, markieren und – sofern dies Ihre Prüfungsordnung gestattet – Randvermerke machen.
Der laufende Text wurde von den Zusätzen der Termini in englischer Sprache entlastet. Stattdessen wird Ihnen unter
www.rechnungswesen.study
ein Online-Glossar zur Verfügung gestellt. Auf der Webseite können Sie Begriffe der internationalen Rechnungslegung auf Deutsch (oder Englisch) eingeben und erhalten das Fachwort in der entsprechenden anderen Sprache angezeigt. Das Glossar ist auch über den auf der nächsten Seite abgedruckten QR-Code direkt aufrufbar.
Gelegentlich werden wichtige Informationen schlicht überlesen. Textstellen, bei denen dies keinesfalls geschehen sollte, sind mit dieser Kennung markiert. Diese Hinweise sollten also sehr bewusst zur Kenntnis genommen werden.
Die neuen Co-Autoren bedanken sich für die Aufnahme in den Autorenkreis und das damit entgegengebrachte Vertrauen. Aufgrund der [4] inzwischen erreichten Schnelllebigkeit der Änderungen im Bereich der internationalen Rechnungslegungsstandards liegt den Ausführungen der Rechtsstand vom 01. März 2022 zugrunde. Alle bis dahin von der EU übernommenen IFRS wurden berücksichtigt.
Die Verfasser
[5]
Inhaltsübersicht
Leitsätze und Übersichten
Inhalt
I.Stellenwert und Inhalt eines IFRS-Abschlusses
Lektion 1: Grundlagen der Rechnungslegung nach IFRS
Lektion 2: Der IFRS-Abschluss
Lektion 3: Regelungen für verbundene und kapitalmarktorientierte Unternehmen
II.Ansatz und Bewertung im IFRS-Abschluss
Lektion 4: Ansatz- und Bewertungsgrundsätze der IFRS
Lektion 5: Bewertungsmaßstäbe bei der Erstbewertung
Lektion 6: Bewertungsmaßstäbe bei der Folgebewertung
Lektion 7: Bilanzierung der Aktiva
Lektion 8: Bilanzierung der Passiva
Lektion 9: Finanzinstrumente
Lektion 10: Leasingverhältnisse
Sachregister
[6]
Leitsätze * Übersichten
Leitsatz 1 Gläubigerschutz und Vorsichtsprinzip
Leitsatz 2 Informationsfunktion
Übersicht 1 Bestandteile des Abschlusses
Übersicht 2 Grundstruktur einer Eigenkapitalveränderungsrechnung
Leitsatz 3 Bestandteile des IFRS-Abschlusses
Leitsatz 4 Verbundene Unternehmen
Leitsatz 5 Börsenorientierte Unternehmen
Leitsatz 6 Grundannahmen des IFRS-Abschlusses
Übersicht 3 Qualitative Anforderungen
Leitsatz 7 Qualitative Anforderungen an den IFRS-Abschluss
Leitsatz 8 Ansatz von Vermögenswerten und Schulden
Übersicht 4 Prüfung der Ansatzkriterien im IFRS-Abschluss
Leitsatz 9 Elemente der GuV
Leitsatz 10 Anschaffungskosten
Übersicht 5 Herstellungskosten nach IFRS
Leitsatz 11 Herstellungskosten
Übersicht 6 Fair-Value-Hierarchie
Übersicht 7 Folgebewertung
Leitsatz 12 Planmäßige Abschreibungen
Übersicht 8 Wertminderung von Vermögenswerten
Leitsatz 13 Neubewertungsmodell
Übersicht 9 Bewertung von Sachanlagen
Leitsatz 14 Sachanlagen
Übersicht 10 Immobilien
Leitsatz 15 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
Übersicht 11 Ansatzvoraussetzungen für einen immateriellen Vermögenswert
Leitsatz 16 Immaterielle Vermögenswerte
Übersicht 12 Vorräte
Leitsatz 17 Vorräte
Leitsatz 18 Fertigungsaufträge
Übersicht 13 Bilanzierung von Verpflichtungen
Leitsatz 19 Verpflichtungen
Übersicht 14 Arbeitnehmervergütungen
Übersicht 15 Steuerlatenzen
Übersicht 16 Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte
Leitsatz 20 Leasing
[7]
Inhalt
I.Stellenwert und Inhalt eines IFRS-Abschlusses
Lektion 1: Grundlagen der Rechnungslegung nach IFRS
1Gründe für die Anwendung internationaler Rechnungslegungsnormen
2Struktur der IFRS
3Ziel und Adressaten des IFRS-Abschlusses
Lektion 2: Der IFRS-Abschluss
1Bestandteile des IFRS-Abschlusses
2Bilanz
3Gewinn- und Verlustrechnung sowie Gesamtergebnisrechnung
4Eigenkapitalveränderungsrechnung
5Kapitalflussrechnung
6Anhang
Lektion 3: Regelungen für verbundene und kapitalmarktorientierte Unternehmen
1Verbundene Unternehmen
1.1Bilanzierung von beherrschten Unternehmen
1.1.1Der Unternehmenszusammenschluss
1.1.2Der Konzernabschluss
1.2Bilanzierung von assoziierten Unternehmen
1.3Bilanzierung von gemeinsamen Vereinbarungen
2Zusatzverpflichtungen kapitalmarktorientierter Unternehmen
2.1Segmentberichterstattung
2.2Zwischenberichterstattung
2.3Ergebnis je Aktie
II.Ansatz und Bewertung im IFRS-Abschluss
Lektion 4: Ansatz- und Bewertungsgrundsätze der IFRS
1Grundannahmen des IFRS-Abschlusses
2Qualitative Anforderungen an den IFRS-Abschluss
3Ansatz von Vermögenswerten und Schulden in der Bilanz
4Erfassung von Erträgen und Aufwendungen in der Gesamtergebnisrechnung
Lektion 5: Bewertungsmaßstäbe bei der Erstbewertung
1Anschaffungskosten
2Herstellungskosten
3Bewertung zum beizulegenden Zeitwert
Lektion 6: Bewertungsmaßstäbe bei der Folgebewertung
1Anschaffungskostenmodell
1.1Planmäßige Abschreibungen
1.2Außerplanmäßige Abschreibungen
1.3Wertaufholungen
2Neubewertungsmodell
2.1Neubewertung
2.2Neubewertungsrücklage
2.3Planmäßige Abschreibungen nach einer Neubewertung
Lektion 7: Bilanzierung der Aktiva
1Sachanlagen
2Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
3Immaterielle Vermögenswerte
4Vorräte
5Fertigungsaufträge
Lektion 8: Bilanzierung der Passiva
1Eigenkapital
2Verbindlichkeiten und Rückstellungen
2.1Sonstige Schulden
2.1.1Finanzielle Verbindlichkeiten
2.1.2Sonstige Verbindlichkeiten
2.2Rückstellungen
2.2.1Allgemeine Regelungen
2.2.2Belastende Verträge
2.2.3Restrukturierungsmaßnahmen
2.3Eventualschulden
3Arbeitnehmervergütungen
3.1Kurzfristig fällige Leistungen
3.2Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
3.3Andere langfristig fällige Leistungen
3.4Abfindungen.
3.5Aktienbasierte Vergütungen
3.5.1Echte Eigenkapitalinstrumente
3.5.2Virtuelle Eigenkapitalinstrumente
4Latente Steuerschulden
Lektion 9: Finanzinstrumente
1Stellenwert der IAS 32, IAS 39, IFRS 7 und IFRS 9
2Ansatz und Bewertung von Finanzinstrumenten
Lektion 10: Leasingverhältnisse
1Bilanzierung des Finanzierungsleasings beim Leasinggeber
2Bilanzierung des Operating-Leasings beim Leasinggeber
3Bilanzierung beim Leasingnehmer
4Sale-and-Leaseback-Transaktionen
Sachregister
[11]
I.Stellenwert und Inhalt eines IFRS-Abschlusses
Lektion 1: Grundlagen der Rechnungslegung nach IFRS
1Gründe für die Anwendung internationaler Rechnungslegungsnormen
Fall 1
X liest im Wirtschaftsteil einer überregionalen Tageszeitung, dass nach Art. 4 der EU-Verordnung Nr. 1606 / 2002 vom 19.07.2002 alle kapital-marktorientierten Mutterunternehmen mit Sitz in der EU dazu verpflichtet sind, ihre Konzernabschlüsse für ab dem 01.01.2005 beginnende Geschäftsjahre nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufzustellen. Außerdem ist diese EU-Verordnung unmittelbar gel-tendes Recht in allen EU-Ländern und bedarf keiner Transformation in nationales Recht (die IFRS selbst werden im so genannten Komitologie- Verfahren übernommen, das auch als Regelungsverfahren mit Kontrolle bezeichnet wird). Der deutsche Gesetzgeber hat diese in § 315e HGB über-nommen. Für die nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen räumt die EU-Verordnung den Mitgliedstaaten in Art. 5 Buchst. b ein Wahlrecht ein, den Konzernabschluss nach nationalem Recht (in Deutschland Han-delsgesetzbuch HGB) oder IFRS zu erstellen (ebenso in § 315e Abs. 3 HGB übernommen). X überlegt in diesem Zusammenhang, welche Gründe zur Entwicklung und Einführung der IFRS führten. Könnten Sie ihm das erklären?
Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Internationalisierung (= Globalisierung) der Unternehmenstätigkeiten gewinnt die Aufstellung und Prüfung von international vergleichbaren Abschlüssen zunehmend an Bedeutung. Vor allem multinational agierende Konzerne haben den Wunsch, sich internationale Kapitalmärkte zur Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital zu erschließen.
Damit ein Kapitalanbieter (= Investor) eine fundierte Anlageentscheidung treffen kann, ist er auf vergleichbare Informationen über potenzielle [12] Investitionsalternativen angewiesen. Die Abschlüsse börsennotierter Unternehmen stellen einen entscheidungsrelevanten und damit ganz we-sentlichen Teil des Informationssystems des Investors dar. Unterschiede zwischen den nationalen Rechnungslegungsnormen beeinträchtigen die Vergleichbarkeit der Abschlüsse und damit die Effizienz der Kapi-talmärkte. Die Globalisierung der Kapitalmärkte einerseits sowie der erhöhte Informationsnutzen für die Adressaten der Rechnungslegung andererseits, führten zu einer immer größeren Bedeutung der IFRS.
Fall 2
„Na toll‟, denkt X. „Wenn die IFRS nur die Konzernabschlüsse kapital-marktorientierter Kapitalgesellschaften betreffen, sind sie praktisch doch kaum von Bedeutung, denn deren Anteil an den Unternehmen insgesamt ist eher gering!‟ Würden Sie ihm zustimmen?
Falls dem so wäre, könnten Sie dieses Buch wieder weglegen. Allerdings sollten Sie vorher bedenken, dass die Anzahl dieser Unternehmen zwar gering ist, diese aber hinsichtlich der Kapitalbildung, Umsatzerlöse, Ar-beitnehmerzahl und anderer ökonomischer Größen für die Wirtschaft von erheblicher Bedeutung sind.
2Struktur der IFRS
Fall 3
Die Gründe für die Anwendung der IFRS im Jahresabschluss hat X verstanden. Er fragt sich nunmehr, wer diese international anerkannten Rechnungslegungsstandards herausgibt und wie deren Struktur aussieht. Sind sie geltendes Recht?
Die IFRS, vormals Internationale Accounting Standards (IAS), werden vom International Accounting Standards Board (IASB), früher International Accounting Standards Committee (IASC), einer internationalen, nicht staatlichen Fachorganisation im Rahmen eines Standardisierungsprozesses erarbeitet und verabschiedet. Das IASC wurde am 29.06.1973 durch eine Vereinbarung von Berufsverbänden aus Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan, Mexiko, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Irland sowie den USA gegründet und im März 2010 zur IFRS-Foundation umstrukturiert. Diese verfolgt vorrangig das Ziel, weltweit akzeptierte, qualitativ hochwertige und verständliche [13] Rechnungslegungsstandards sowie Standards zur Nachhaltigkeitsbe-richterstattung zu entwickeln und deren Anwendung zu fördern. Für die fachliche Arbeit der IFRS-Foundation sind das IASB und das In-ternational Sustainability Standards Board (ISSB) zuständig. Das IASB mit Sitz in London ist u.a. für die Verabschiedung von Standards und Interpretationen verantwortlich. Heute sind mehr als 150 Berufsorganisationen aus über 100 Ländern Mitglied des IASB. Aus deutscher Sicht ist neben dem Institut der Wirtschaftsprüfer (IdW) auch das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) vertreten. Im November 2021 wurde das ISSB mit Sitz in Frankfurt am Main und Montreal errichtet, dessen Schwerpunkt die Entwicklung von international gültigen Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung ist.
Die IFRS sind anders aufgebaut als das HGB. Das HGB ist ein typischer Vertreter des kontinental-europäischen Code Law. Die IFRS orientieren sich dagegen am angelsächsischen Case Law. Es handelt sich bei den IFRS um einzelfallbezogene Regelungen, die untereinander keiner systematischen Ordnung folgen. Die Reihenfolge und Nummerierung der IFRS ist eklektisch. Der Vorteil besteht in der genauen Regelung einzelner Sachverhalte, nachteilig sind die zwangsläufig auftretenden Wiederholungen. Da die IFRS von einer privatrechtlichen Vereinigung formuliert werden, stellen sie auch keine Rechtsnormen dar.
Damit die IFRS Rechtskraft erhalten, müssen sie von einer Legislative übernommen werden oder der Gesetzgeber muss auf sie verweisen. In der EU erfolgt die Übernahme durch die Kommission. Die IFRS bestehen aus folgenden Elementen:
▶Vorwort
▶Rahmenkonzept
▶Rechnungslegungsstandards
▶Interpretationen.
Das Vorwort legt die Ziele, den Anwendungsbereich und die Bindungs-wirkung der Standards dar. Außerdem wird das Verfahren zur Entwicklung und Verabschiedung der Standards geklärt.
Als theoretische Basis der IFRS fungiert das Rahmenkonzept (Conceptual Framework CF). Nach mehrjähriger Revision trat das überarbeitete, aktu [14] ell gültige Rahmenkonzept am 01.01.2020 in Kraft. Grundsätzlich richtet sich das Rahmenkonzept an den Standardsetter und legt die gemeinsame Basis aller Standards. Es unterstützt jedoch auch die Anwender beim Verständnis und der Interpretation von Zweifelsfragen bei der Auslegung von Standards (CF SP1.1, SP steht für status and purpose und stellt eine Art Einleitung des CP dar). Das Rahmenwerk selbst stellt keinen IFRS dar, vielmehr haben die Standards unbedingten Vorrang (CF SP1.2). Das Rahmenwerk kommt unmittelbar nur zur Anwendung, wenn ein Bilanzierungsproblem nach keinem Standard oder keiner Interpretation gelöst werden kann (IAS 8.11).
Die eigentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften sind in den Standards (Zitierweise: IAS 1.1, IFRS 3.1 etc.) enthalten. Die bis zur Restrukturierung des ISAC (im Jahr 2001) erlassenen Standards werden als IAS bezeichnet, während die danach vom IASB verabschiedeten Standards IFRS heißen. Die IAS werden nach und nach von den neueren IFRS abgelöst, so dass langfristig nur noch IFRS Anwendung finden werden. Die Standards sind das Ergebnis einer eingehenden Behandlung ausgewählter Themenbereiche und folgen einer fallbezogenen (kasuistischen) Ordnung. Die Anwendung aller gültigen Standards ist für eine Bestätigung der Übereinstimmung des Abschlusses mit den IFRS verpflichtend (IAS 1.16).
Die einzelnen Standards sind meist wie folgt aufgebaut:
▶Zielsetzung
▶Anwendungsbereich
▶Definitionen (bei den IFRS im Anhang A)
▶Bilanzierungsregeln
▶Offenlegungspflichten
▶Übergangvorschriften
▶Zeitpunkt des Inkrafttretens
▶Anhang
Daneben werden einige Standards um Anwendungshinweise, die die Um-setzung erleichtern sollen, und um Grundlagen für Schlussfolgerungen, die Begründungen zu den vorgenommenen Änderungen des Standards enthalten, erweitert. Diese Ausführungen sind nicht Teil der im Amtsblatt [15] veröffentlichten EU-Verordnungen. Dennoch sind sie für die Auslegung der IFRS heranzuziehen.
Neben den einzelnen Standards sind die Interpretationen, die vom International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) herausgegeben werden, ein verbindlicher Bestandteil der IFRS. Ihre Anwendung ist für den Abschlussersteller somit verpflichtend. Sie klären Zweifelsfragen in der Auslegung und schließen Regelungslücken, indem sie spezielle Bilanzierungsprobleme behandeln. Bis zum Jahr 2002 hieß das IFRIC Standing Interpretations Committee (SIC), weshalb die Interpretationen bis dahin die Bezeichnung „SIC‟ tragen (Zitierweise: IFRIC 1 bzw. SIC 1 etc.).
3Ziel und Adressaten des IFRS-Abschlusses
Fall 4
A ist ein amerikanischer Großinvestor. Er beabsichtigt, 5.000.000 € ent-weder in Aktien der deutschen Y-AG mit Sitz in Berlin oder in Aktien der irischen Z-Ltd. mit Sitz in Dublin zu investieren. Zu diesem Zweck hat sich A die letzten fünf Jahresabschlüsse beider Kapitalgesellschaften beschafft. Die Y-AG, die nach HGB bilanziert, weist durchschnittlich einen Jahresüberschuss i.H.v. 50.000.000 € aus, während die Z-Ltd., die nach IFRS bilanziert, durchschnittlich einen Jahresüberschuss i.H.v. 80.000.000 € ausweist. Beide Kapitalgesellschaften gehören der gleichen Branche an. Wie wird sich X entscheiden, wenn er seine Anlageentscheidung am Jahresüberschuss der Unternehmen ausrichtet?
Leider lässt sich diese Frage nicht eindeutig beantworten, da die Jahres-überschüsse der beiden Kapitalgesellschaften nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Die deutsche Y-AG bilanziert nach dem HGB; die irische Z-Ltd. bilanziert nach den IFRS.
Weiter mit Fall 4
Das versteht A nicht. Wenn sowohl nach HGB als auch nach IFRS Ver-mögen und Schulden bilanziert werden und in der Gewinn- und Verlust-rechnung (GuV) der Gewinn ermittelt wird, können die Unterschiede doch nicht so gravierend sein, oder?
[16]
Doch! Der Jahresüberschuss nach HGB wird eher zu niedrig ausgewiesen, da der Gedanke des Gläubigerschutzes und damit auch die Begrenzung der Ausschüttung von höchster Priorität sind. Die Dominanz des Gläubigerschutzgedankens spiegelt sich insbesondere im so genannten Vorsichtsprinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB wider, welches den vorherrschenden Grundsatz handelsrechtlicher Rechnungslegung in Deutschland darstellt. Diesem Prinzip liegt die Vorstellung des vorsichtigen Kaufmanns zugrunde, der sich vor sich selbst und vor anderen nicht reicher rechnet, als er tatsächlich ist.
Für Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens bilden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB die Obergrenze der Bewertung (= Anschaffungskostenprinzip). Steigt der Marktwert über die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, so bleibt dies aufgrund des Realisationsprinzips im Jahresabschluss unberücksichtigt. Eine Gewinnantizipation ist also verboten.
Sinkt der Marktwert von Vermögensgegenständen dagegen unter die An- schaffungs- oder Herstellungskosten, so wird diese (vielleicht auch nur drohende) Wertminderung aufgrund des Imparitätsprinzips, präzisiert durch das strenge und gemilderte Niederstwertprinzip, erfasst.
Auf der Passivseite der Bilanz führt das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip zum Höchstwertprinzip. Hiernach sind Verbindlichkeiten und Rückstellungen eher zu hoch als zu niedrig anzusetzen. Steigt beispiels-weise eine ausländische Währung im Kurs, dann ist die entsprechende Valutaverbindlichkeit (= Fremdwährungsverbindlichkeit) mit eben diesem höheren Kurs zu bewerten. Das ist Ihnen sicher sehr vertraut. Wenn nicht, sollten Sie in Lektion 6 von „Rechnungswesen – leicht gemacht®‟ nachschlagen.
Die im HGB verankerte starke Betonung des Gläubigerschutzes im In-teresse der Fremdkapitalgeber verpflichtet die Unternehmen, ihre wirt-schaftlichen Verhältnisse auf keinen Fall zu optimistisch darzustellen, sodass es nicht zu überhöhten Gewinnausschüttungen und der damit ver-bundenen Schwächung des Eigenkapitals bzw. der Liquidität kommt. Die Bildung stiller Reserven durch Unterbewertung des Vermögens und / oder Überbewertung der Schulden wird in der deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegung im Sinne „guter kaufmännischer Tradition‟ in Kauf genommen. Im Hinblick auf den Gläubigerschutz wird der Objektivierung [17] und Verlässlichkeit der Rechnungslegung mehr Bedeutung beigemessen als der Vermittlung entscheidungsrelevanter Informationen. Daran hat auch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 15. Mai 2009 (BilMoG 2009) wenig geändert.
Leitsatz 1
Gläubigerschutz und Vorsichtsprinzip
Der Gedanke des Gläubigerschutzes ist von höchster Priorität für die Rechnungslegung nach HGB. Das Vorsichtsprinzip stellt den dominierenden Grundsatz handelsrechtlicher Rechnungslegung dar. Aus ihm leiten sich das Realisations- und das Imparitätsprinzip ab.
Völlig anders sieht dagegen die Konzeption der IFRS-Rechnungslegung aus, deren Ziel gemäß CF 1.2 die Vermittlung entscheidungsnützlicher Informationen an aktuelle und potentielle Investoren, Kreditgeber und sonstige Gläubiger darstellt. Die entscheidungsnützlichen Informationen betreffen hierbei die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage sowie Cashflows eines Unternehmens (IAS 1.9). Investoren und Gläubiger haben insbesondere ein großes Interesse an den Informationen über die künftige Ertragslage des Unternehmens. Während Anleger anhand der künftigen Ertragslage die Rendite ihres investierten Kapitels ermitteln können, gibt Gläubigern die Information über die künftige Ertragslage Aufschluss über die Wahrscheinlichkeit der Tilgungen von gewährten Krediten und Zinszahlungen.
Damit erfolgt in der IFRS-Rechnungslegung eine Fokussierung auf die Informationsbedürfnisse von Investoren und Gläubigern.
Die angesprochenen Investoren und Gläubiger fällen Entscheidungen hinsichtlich der Kapitalvergabe an das Unternehmen. Deshalb benötigen sie Informationen, die sie bei der Prognose künftiger Cashflows unterstützen (CF 1.2). Um diese Prognose treffen zu können, müssen die Ressourcen des Unternehmens, seine Verpflichtungen und Informationen darüber, wie effizient und effektiv das Management diese Ressourcen nutzt, dargestellt werden (CF 1.3).
[18]
Leitsatz 2
Informationsfunktion
Die Erfüllung der Informationsfunktion ist alleiniges Ziel des IFRS-Abschlusses. Die Zahlungsbemessungsfunktion (Bemessung von Gewinnausschüttungen oder gar Steuerzahlungen) ist hingegen kein Ziel der Rechnungslegungskonzeption nach IFRS.
Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass sich die periodi-schen Gewinnunterschiede zwischen HGB- und IFRS-Rechnungslegung in der Totalperiode, also über die Gesamtlebenszeit eines Unternehmens, ausgleichen, es also nur zu temporären Gewinnunterschieden kommt.
[19]
Lektion 2: Der IFRS-Abschluss
1Bestandteile des IFRS-Abschlusses
Fall 5
Die deutsche, nicht börsennotierte X-AG möchte zum 31.12.21 ihren Ab-schluss nach IFRS aufstellen. Der Vorstand beabsichtigt, eine Bilanz, eine GuV und zusätzlich einen Lagebericht zu veröffentlichen. Zu Recht?
Nein! Die Bestandteile des Jahresabschlusses nach IFRS sind umfangrei-cher als die nach § 264 Abs. 1 Satz 1 HGB. Sie beinhalten gemäß IAS 1.10 nicht nur Bilanz, GuV, sondern auch eine Gesamtergebnisrechnung, eine Eigenkapitalveränderungsrechnung und eine Kapitalflussrechnung. Die Erstellung eines Lageberichtes wird dagegen gem. IFRS nicht vorgeschrieben. Die GuV und das sonstige Ergebnis können im Rahmen der Gesamtergebnisrechnung in einer einzigen fortlaufenden Darstellung ausgewiesen werden. Alternativ kann eine separate GuV aufgestellt werden, die der verkürzten Gesamtergebnisrechnung unmittelbar voraus-gehen muss (IAS 1.10A; siehe nachfolgend unter 3). Diese Pflichtbestandteile des Jahresabschlusses gelten gemäß IAS 1.2 gleichermaßen für den Einzel- und den Konzernabschluss. Größenabhängige Erleichterungen, vergleichbar dem § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB, kennen die IFRS nicht. Übersicht 1 fasst die Pflichtbestandteile des IFRS-Abschlusses zusammen.
Übersicht 1: Bestandteile des Abschlusses
a)Statement of financial position
Bilanz
b)Statement of profit and loss
Gewinn- und Verlustrechnung
c)Statement of comprehensive income
Gesamtergebnisrechnung
d)Statement of changes in equity
Eigenkapitalveränderungsrechnung
e)Statement of cash flows
Kapitalflussrechnung
f)Notes
Anhang
[20]
2Bilanz