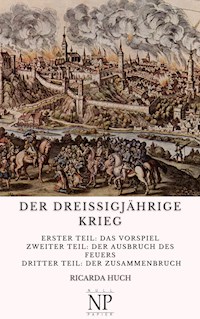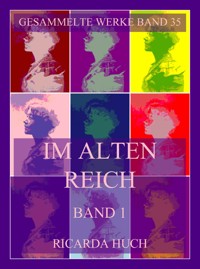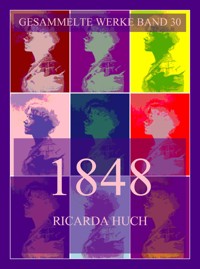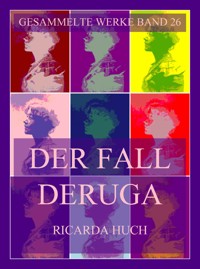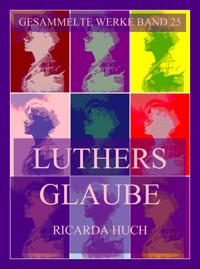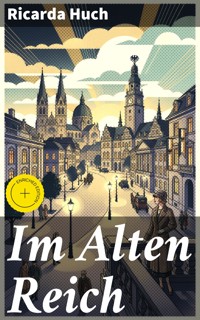
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Im Alten Reich" entführt Ricarda Huch ihre Leser in die Zeit des Deutschens Kaiserreiches, einer Epoche, die von gesellschaftlichen Umbrüchen und tiefgreifenden politischen Veränderungen geprägt ist. Der Roman entfaltet sich in einem eleganten und bisweilen nostalgischen Erzählstil, der den Leser in die Lebenswelten der Protagonisten eintauchen lässt. Huchs Fähigkeit, Einblicke in die menschliche Psyche und die sozialen Strukturen ihrer Zeit zu gewähren, verleiht dem Werk eine besondere Tiefe und schafft einen scharfen literarischen Kontext zur Entstehungszeit Anfang des 20. Jahrhunderts, in der Fragen der Identität und Nation zentral waren. Ricarda Huch, eine der ersten weiblichen Stimmen in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts, ist nicht nur als Romanautorin, sondern auch als Lyrikerin und Essayistin etabliert. Ihr persönlicher Hintergrund, geprägt von einer universitären Ausbildung in Philosophie und Geschichte sowie von ihrer politischen Haltung, inspirierte sie dazu, die Verstrickungen von Vergangenheit und Gegenwart zu beleuchten. Diese Verquickung von persönliche Erfahrung und literarischem Schaffen macht sie zu einer bedeutenden Stimme ihrer Zeit, die auch in "Im Alten Reich" erkennbar wird. Leser, die sich für historische Literatur und profundes Charakterstudium interessieren, werden in "Im Alten Reich" eine fesselnde Lektüre finden. Huchs meisterhaftes Gespür für Dramaturgie und ihre Kunst, komplexe Themen greifbar zu machen, laden dazu ein, die unterschwelligen Spannungen und die Emotionalität jener Zeit zu entdecken. Dieses Buch ist nicht nur ein bedeutendes literarisches Werk, sondern auch ein zeitgenössisches Spiegelbild, das zum Nachdenken anregt. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Im Alten Reich
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Zwischen glanzvoller Vergangenheit und tastender Gegenwart erkundet dieses Buch, wie Städte das Gedächtnis eines Reiches bewahren und zugleich dessen Wandel bezeugen, indem es die vielfarbigen Lebensformen des Alten Reiches in präzise beobachteten, poetisch verdichteten Bildern ordnet, die Topographie mit Mentalität, Bürgerrecht mit Alltag, städtische Freiheit mit obrigkeitlicher Bindung verbinden und so sichtbar machen, dass Geschichte nicht bloß in Chroniken, sondern in Straßen, Häusern und Gewohnheiten fortlebt, wo Stimmen, Gerüche und Lichter ein Geflecht bilden, in dem Macht und Gemeinsinn, Herkunft und Aufbruch, Frömmigkeit und Weltklugheit einander erweitern und begrenzen, ohne in Nostalgie zu verfallen.
Im Alten Reich von Ricarda Huch ist kein Roman, sondern ein literarisch geformtes Geschichtsbuch, das über essayistische Stadtskizzen die Welt des Heiligen Römischen Reiches anschaulich werden lässt. Die Schauplätze sind deutsche Städte in ihrer Vielfalt von Handelszentren bis zu Residenzen; das Geschehen entfaltet sich in Gassen, auf Märkten, in Ratsstuben und Zünften. In Huchs Œuvre steht das Werk an der Schnittstelle von Dichtung und Historie und knüpft an ihre breit angelegte Beschäftigung mit deutscher Vergangenheit an. Es verbindet Erkundung und Deutung und richtet den Blick auf Strukturen, Sitten und Selbstverständnisse, weniger auf einzelne Heldengeschichten.
Die Ausgangssituation ist die Einladung, eine historische Landschaft aus Bewohnerinnen und Bewohnern, Institutionen und Räumen zu betrachten, ohne dass ein linearer Plot vorgegeben wäre. Huchs Erzählinstanz spricht gelehrt und zugleich nah, eine Stimme, die Quellenkenntnis, Beobachtung und feine Ironie mischt. Ihr Stil ist bildkräftig, rhythmisch, häufig von sorgfältigen Übergängen getragen; der Ton bleibt respektvoll, bisweilen melancholisch, mit wachem Sinn für Widersprüche. Das Leseerlebnis ist kontemplativ und episodisch: Man folgt Miniaturen, die sich zu einem Panorama fügen, und gewinnt dabei den Eindruck, den Pulsschlag einer vielgestaltigen Ordnung zu hören, die im Detail klar und im Ganzen durchlässig erscheint.
Zentrale Themen sind die urbane Freiheit und ihre Grenzen, die Selbstverwaltung und die Spannungen zwischen Bürgersinn, Standespflicht und fürstlicher Macht. Die religiöse Vielfalt und ihre sozialen Folgen werden ebenso sichtbar wie die ökonomischen Verkehrswege, die Städte verbanden und Konkurrenz schürten. Huch zeigt, wie Recht, Ritual und Alltag ein Gefüge bilden, das Sicherheit schafft und Wandel ermöglicht. Das Reich erscheint dabei nicht als monolithischer Staat, sondern als Netzwerk vielfältiger Ordnungen, in denen Loyalitäten geschichtet sind. Daraus erwächst ein Verständnis von Geschichte, das weniger Schlagworte als dichte Prozesse betont und dem Lokalen exemplarische Bedeutung zuspricht.
Für heutige Leserinnen und Leser bleibt das Buch relevant, weil es eine Kunst des genauen Hinsehens lehrt und politische Ordnung jenseits einfacher Gegensätze denkt. Debatten über Föderalismus, europäische Integration und kommunale Selbstbestimmung erhalten durch Huchs Blick auf städtische Aushandlungsprozesse historisches Tiefenlicht. Wer über Identität, Zugehörigkeit und Vielfalt nachdenkt, findet Anregungen in der Art, wie das Werk Differenzen beschreibt, ohne sie zu nivellieren. Zugleich wirkt die Darstellung städtischer Resilienz und solidarischer Praktiken überraschend aktuell: Sie erinnert daran, dass Gemeinwesen nicht allein durch Programmsätze, sondern durch geübte Formen des Miteinanders bestehen und wachsen.
Huchs Methode gleicht einer behutsamen Montage: Sie fügt Beobachtungen, historische Kenntnisse und literarische Einfälle so, dass Figuren, Räume und Institutionen ein lebendiges Ganzes ergeben. Statt abstrakter Formeln treten Szenen, die Sprachen, Gesten und Rituale spürbar machen; an die Stelle großer Schlachtfelder rücken Werkstätten, Kanzleien und Stuben. Damit unterläuft das Buch heroische Vereinfachungen und fragt nach den Voraussetzungen gelingender Ordnung im Kleinen. Es ist eine Geschichtsschreibung, die von innen schaut und doch Überblick behält, indem sie Atmosphären genau erfasst und ihre Erkenntnisse in klarer, gelenkiger Prosa formuliert. Die Erzählbewegung bleibt ruhig, aber zielbewusst, und gibt jeder Beobachtung den nötigen Atem.
Wer Im Alten Reich liest, betritt einen Raum, in dem historische Genauigkeit und erzählerische Kunst sich gegenseitig schärfen und die Vergangenheit als Erfahrungsraum zugänglich wird. Die sorgfältig komponierten Kapitel laden zu langsamen, aufmerksamen Lektüren ein, bei denen sich Motive wiedererkennen und private Beobachtungen in größere Linien fügen. So entsteht ein ruhiges, doch anregendes Buch, das keine fertigen Thesen aufzwingt, sondern Urteilsvermögen schult. Seine Bilder von Stadt, Bürgertum und Vielheit sprechen in Zeiten beschleunigter Debatten besonders klar: Sie ermutigen, Traditionen kritisch zu bewahren, Wandel verständig zu gestalten und Komplexität mit Gelassenheit zu lesen.
Synopsis
Ricarda Huchs Im Alten Reich ist eine historisch-essayistische Darstellung, die das Leben deutscher Städte im Heiligen Römischen Reich durch prägnante Porträts erhellt. Statt einer reinen Ereignischronik ordnet sie soziale, rechtliche und kulturelle Erfahrungen, um zu zeigen, wie städtische Gemeinschaften sich selbst verstanden. Der Weg der Darstellung verläuft von überlieferten Formen der städtischen Freiheit über konfessionelle Umbrüche bis zu politischen Verschiebungen, die die Autonomie aushöhlen. Leitfragen sind: Woraus speist sich bürgerliche Selbstverwaltung? Wie wirken Recht, Glaube und Handel zusammen? Ihre Kapitel folgen dabei einer inneren Logik von Lebenswelt, Konflikt und Erneuerung.
Zunächst entwirft Huch Grundzüge der Stadtverfassung im Alten Reich: Rat und Zünfte, Patriziat und Bürgerschaft, die in einem fragilen Gleichgewicht Gemeinwohl und Besitzstand balancieren. Sie macht sichtbar, wie Markt, Handwerk und Fernhandel die materiellen Grundlagen urbaner Kultur liefern und wie Feste, Bräuche und Vereinswesen Zugehörigkeit stiften. Im Vordergrund steht der bürgerliche Ethos aus Pflicht, Maß und öffentlichem Anstand, der die Stadt als rechtlich geschützten, zugleich moralisch verpflichtenden Raum definiert. Daraus erwächst ein Spannungsfeld zwischen Selbstbehauptung nach innen und der Notwendigkeit, sich gegenüber Nachbarn, Territorien und Reichsinstanzen zu behaupten, ohne ihre Eigenart preiszugeben.
Anschließend akzentuiert sie die religiösen und intellektuellen Umbrüche der Frühen Neuzeit. Die Reformation, in manchen Orten gefördert, in anderen gebremst, verändert Bildung, Predigt und Verwaltung und verschiebt Loyalitäten innerhalb der Bürgerschaft. Neue Schulen, Druckereien und gelehrte Zirkel verbreiten Ideen, die Ratsentscheidungen und Alltagsfrömmigkeit gleichermaßen berühren. Huch zeigt, wie konfessionelle Profile öffentliche Räume prägen und zugleich Kompromisse notwendig machen, damit Handel und Ordnung nicht zerbrechen. Der Konflikt verläuft weniger als Glaubenskrieg im Kleinen denn als dauernde Aushandlung zwischen religiöser Überzeugung, politischer Klugheit und ökonomischen Interessen der Stadt. Dabei gewinnen Predigt, Schulordnung und Armenpflege neue organisatorische Formen.
Ein markanter Einschnitt ist die Erfahrung kriegerischer Belastungen, vor allem in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Belagerungen, Einquartierungen und Abgaben lassen Ressourcen schrumpfen, Institutionen erlahmen und soziale Gegensätze schärfer hervortreten. Zugleich werden Bewältigungsstrategien sichtbar: improvisierte Verwaltung, karitative Netzwerke, rechtliche Anpassungen. In der Phase des Wiederaufbaus gewinnen Repräsentation, Baukunst und höfisch-bürgerliche Formen an Gewicht, wodurch sich die symbolische Ordnung der Städte wandelt. Huch verknüpft diese Entwicklungen mit dem Anwachsen territorialstaatlicher Macht, die Privilegien prüft, Zuständigkeiten einschränkt und der kommunalen Selbstgewalt immer engere Grenzen setzt. Städtische Außenpolitik wird vorsichtiger, finanzielle Spielräume enger.
Aufklärerische Tendenzen rahmen die nächste Etappe ihrer Argumentation. Ökonomische Reformen, statistische Erhebungen und administratives Denken verändern die städtische Steuerung, während Bildungsinitiativen, Lesegesellschaften und bürgerliche Salons neue Öffentlichkeiten hervorbringen. Huch beobachtet, wie traditionelle Korporationen unter Druck geraten, ohne sofort zu verschwinden: Zünfte reformieren Verfahren, Räte professionalisieren Abläufe, soziale Mobilität nimmt behutsam zu. Zugleich bleibt die Ordnung verletzlich, weil modernisierende Impulse auf Zensur, konfessionelle Schranken und fiskalische Zwänge treffen. Die Stadt erscheint als Labor vorsichtiger Neuerung, das den Nutzen des Rationalen sucht, ohne seine historischen Bindungen preiszugeben. Neue Vereinsformen erproben Gemeinsinn, doch Loyalitäten bleiben lokal verankert.
Im letzten historischen Bogen beschreibt Huch die dynamische, teils abrupte Umgestaltung an der Wende zum 19. Jahrhundert. Die Verflechtung mit europäischen Konflikten, administrative Neuordnungen und die Auflösung des Alten Reiches setzen der alten städtischen Eigenständigkeit enge Grenzen. Medialisierung, Säkularisierung und territoriale Integration verändern Besitz, Rechtstitel und politische Teilhabe. Huch deutet diese Prozesse weniger als bloßes Ende denn als Verschiebung von Formen: Bürgerliche Tugenden und Selbstorganisationskräfte suchen neue Kanäle, während die Erinnerung an frühere Freiheiten zu Maßstab und Reibungsfläche zugleich wird. Verwaltungen werden zentralisiert, Verkehrswege umgestaltet, und militärische Anforderungen greifen tief in den Alltag ein.
Am Ende bündelt das Buch seine Beobachtungen zu einer übergeordneten Aussage über die Dauer bürgerlicher Kultur. Huch macht geltend, dass die Kraft der Städte weniger in spektakulären Ereignissen als in alltäglichen Institutionen, eingeübten Regeln und gemeinsamer Verantwortung liegt. Ihre literarisch dichte, zugleich quellenbewusste Darstellung will nicht nostalgisch verklären, sondern Verständnis für die historischen Voraussetzungen urbaner Freiheit schärfen. Die nachhaltige Wirkung besteht darin, Städte als Träger von Identität und politischer Mündigkeit neu zu sehen und die Spannungen zwischen Tradition und Wandel als produktiven Motor städtischer Geschichte zu begreifen. So bleibt das Werk anregend und zugleich zurückhaltend im Urteil.
Historischer Kontext
Im Alten Reich bezeichnet das Heilige Römische Reich Deutscher Nation zwischen der Reichsreform von 1495 und der Auflösung 1806. Der geographische Rahmen umfasste große Teile Mitteleuropas mit Schwerpunkten in den deutschsprachigen Territorien sowie in Freien Reichsstädten und geistlichen Fürstentümern. Prägende Institutionen waren Kaiser und Kurfürstenkolleg, der Reichstag als Ständeversammlung, die Reichskreise zur Verwaltung und Verteidigung, das Reichskammergericht und der Reichshofrat als höchste Gerichte. Die Verfassung war zusammengesetzt und föderal, die Reichsstände verfügten über weitreichende Gesetzgebungs-, Steuer- und Gerichtshoheit. In den Reichsstädten prägten städtische Selbstverwaltung und Ratsverfassungen eine eigenständige republikanische Tradition.
Die Reformation leitete tiefgreifende Umbrüche ein, die das Reichsgefüge prägten. Martin Luthers Thesenanschlag 1517 und der Reichstag zu Worms 1521 markierten den Beginn der konfessionellen Auseinandersetzung. Die Confessio Augustana wurde 1530 vorgelegt, der Augsburger Religionsfrieden von 1555 regelte mit dem Grundsatz cuius regio eius religio das Nebeneinander der Bekenntnisse und enthielt das Reservatum ecclesiasticum. In vielen Städten erwarb der Rat kirchliche Jurisdiktion und ordnete Gottesdienst und Schulwesen neu. Katholische Reform und Jesuiten wirkten parallel. Dieses Spannungsfeld aus städtischer Kirchenordnung und landesherrlicher Konfessionalisierung bildet einen wichtigen historischen Horizont von Huchs stadtgeschichtlich ausgerichtetem Zugriff.
Die Freien Reichsstädte wie Nürnberg, Augsburg, Frankfurt am Main, Lübeck und Köln verbanden kaufmännische Netzwerke, Ratsaristokratien und Zünfte. Patrizische Ratsfamilien dominierten vielfach die städtische Politik, doch Zunftbewegungen und Reformstatuten erweiterten Mitspracherechte oder setzten Verfassungsänderungen durch. Handelsgesellschaften, Messen und Stapelrechte strukturierten Märkte; die Hanse spielte im späten Mittelalter eine zentrale Rolle und verlor in der Frühen Neuzeit an Einfluss. Stadtbefestigungen, Kirchen und Rathäuser bezeugten kommunale Autonomie. Archive, Chroniken und Ratsprotokolle dokumentieren Konflikte um Steuern, Wehrpflicht, Versorgung und religiöse Ordnung, die Ricarda Huchs Darstellung von Stadtgemeinden im Alten Reich eine quellengesättigte Grundlage geben.
Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 traf Territorien und Städte des Reiches schwer. Ausgelöst durch die Prager Fensterstürze, verschränkten sich dynastische, verfassungs- und konfessionspolitische Konflikte. Belagerungen, Kontributionen und Einquartierungen prägten den urbanen Alltag; Handelswege brachen ein, und Bevölkerungsverluste waren beträchtlich. Der Westfälische Friede 1648 bestätigte die reichsständische Souveränität in Außenbeziehungen innerhalb eines reichsrechtlichen Rahmens, erkannte den Calvinismus an und regelte zahlreiche Streitfragen zwischen Ständen und Kaiser. Für die Reichsstädte sicherte er Rechte und Religionsverhältnisse ab. Huchs Blick auf kommunale Lebensformen lässt die Resilienz und Anpassungsfähigkeit städtischer Gemeinwesen in dieser Belastungsprobe erkennbar werden.
Nach 1648 stabilisierte sich die Reichsverfassung in einem Gleichgewicht aus kaiserlichen Vorrechten und ständischer Mitbestimmung. Der Immerwährende Reichstag tagte ab 1663 dauerhaft in Regensburg und wurde zum Forum reichsweiter Gesetzgebung, Gesandtenverkehrs und Konfliktbeilegung. Die Reichskreise koordinierten Militäraufgebote, Reichssteuern, Münzordnungen und Polizeiordnungen. Das Reichskammergericht in Wetzlar und der Wiener Reichshofrat sicherten Rechtsmittelwege zwischen Untertanen, Städten, Ständen und Fürsten. Ein überregionales Kommunikationsgefüge entstand mit der Kaiserlichen Reichspost der Familie Thurn und Taxis. Diese dichte, rechtlich fundierte Vielgliedrigkeit bildete die Bühne, auf der städtische Selbstverwaltung, Wirtschaftsregulierung und Konfessionsfrieden ausgehandelt und praktiziert wurden.
Wirtschaftlich prägten Montanreviere und Handelsplätze das Alte Reich. Der Buchdruck, seit der Mitte des 15. Jahrhunderts in Mainz entwickelt, förderte Bildung, Verwaltung und religiöse Debatte; Buchmessen in Frankfurt und Leipzig wurden zentrale Drehscheiben. Kaufmannshäuser wie die Fugger und Welser in Augsburg finanzierten im 16. Jahrhundert Bergbau, Fernhandel und habsburgische Politik. Reichsstädte profitierten von Zoll-, Münz- und Waagerechten, zugleich verschob sich der Fernhandel mit der atlantischen Expansion. Gewerbliche Produktion blieb durch Zünfte reguliert, während Manufakturimpulse zunahmen. Diese wirtschaftlichen Entwicklungen spiegeln das Nebeneinander von Tradition und Innovation, das Huchs städtische Lebensbilder historisch strukturieren.
Kulturell verband das Alte Reich konfessionelle Prägungen mit Aufklärung und Cameralwissenschaften. Universitäten wie Wittenberg, Heidelberg, Altdorf oder Göttingen, Gymnasien und städtische Bibliotheken bildeten Eliten aus; Predigt, Schulordnungen und Pietismus (etwa Philipp Jakob Spener in Frankfurt) formten Frömmigkeit und soziale Fürsorge. Zeitschriftenwesen und gelehrte Gesellschaften beförderten Öffentlichkeit. Militärische Konjunkturen wie der Österreichische Erbfolgekrieg und der Siebenjährige Krieg belasteten Finanzen und Handel, ohne die Reichsverfassung aufzuheben. In vielen Städten führten Polizeiordnungen, Bauprogramme und Armenpflege zu administrativen Verdichtungen. Solche langfristigen, alltagsnahen Prozesse entsprechen dem sozialkulturellen Fokus, den Huch ihren Stadtporträts verleiht.
Ricarda Huchs Im Alten Reich arbeitet mit historisch belegten Stadt- und Milieubildern, die aus Chroniken, Akten und zeitgenössischen Berichten gespeist sind. Sie verbindet erzählerische Gestaltung mit sorgfältiger Quellenarbeit und zeichnet die Vielfalt eines föderalen Reichs, ohne eine nationalstaatliche Teleologie in den Vordergrund zu stellen. Die Konzentration auf kommunale Institutionen, bürgerliche Sitten und rechtliche Rahmenbedingungen wirkt wie ein Kommentar zur Epoche: Autonomie, Rechtskultur und Pluralität erscheinen als tragende Ordnungselemente. Das Werk entstand in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts; Huchs Austritt aus der Preußischen Akademie der Künste 1933 im Protest gegen den Nationalsozialismus beleuchtet die ethische Haltung, aus der heraus sie historische Gemeinwesen darstellt.
Im Alten Reich
Vorwort
Ich gestehe, daß ich aus Liebe zur Vergangenheit von verschiedenen alten Städten erzähle. Ich glaube, daß es eine Grenze des Umfangs gibt, jenseits welcher die Dinge und Verhältnisse nicht mehr schön, nicht mehr zweckdienlich, nicht organisch mehr sein können, und ich glaube, daß wir diese Grenze überschritten haben. Nur das halte ich dem Menschen angemessen, was er persönlich übersehen kann, nur das befriedigt seinen Schönheitssinn und seine Vernunft. Aus diesem Grunde liebe ich unsere alten Städte so wie sie bis etwa zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts waren. Sie hatten drei Feinde: das Feuer, die Franzosen und die Zerstörungswut und den Ungeschmack der neuen Zeit. Es liegt mir fern, den Menschen das Recht absprechen zu wollen, das Überlieferte nach ihrem Bedürfnis und Geschmack umzugestalten, insbesondere der Schrei nach Luft und Licht war ohne Frage berechtigt. Alle Lebensformen, auch die besten, verderben oder erstarren einmal; hätte man immerhin verändert und niedergerissen, wenn man nur etwas Gutes, Taugliches an die Stelle gesetzt hätte. Ich weiß wohl, daß die Kraft, zu schaffen, sich nicht zwingen läßt, daß nie die gleichen Bedingungen wiederkehren, und daß etwas Verquältes entsteht, wenn man eine Richtung erzwingen will, die dem Zeitgeist nicht entspricht. Indessen könnte der Zeitgeist, der über menschlichem Willen und menschlicher Einsicht ist, auch einmal zur geschlossenen, organischen Form zurückkehren; tut er es nicht, so muß es doch erlaubt sein, des Schönen, Großen und Merkwürdigen, was unsere Vorfahren hervorgebracht und erlebt haben, mit Anteil und vielleicht mit Wehmut zu gedenken. Man braucht nicht ohne Sinn für die Gegenwart zu sein, wenn man die Vergangenheit und ihre Werke schätzt. Viele wissen nicht, wieviel Ursachen wir Deutsche haben, auf unseren Reichtum an Schönheit stolz zu sein, und daß wir nichtnötig hätten, nach Italien zu reisen, um Kunstwerke anzustaunen, wenn dies glückliche Land nicht eins vor uns voraus hätte: das gute Wetter. Wir haben fast immer schlechtes, und zwar ein solches, in dessen tonloser Stumpfheit alles Schöne erlischt. Daß ich einen stimmungsvollen Himmel über meinen geschilderten Städten aufgerichtet habe, wird man mir hoffentlich als poetische Freiheit zugute halten, nicht als Fälschung vorwerfen.
Eine eingehende Beschreibung wolle man nicht erwarten, die Sache des Kunsthistorikers wäre; ich habe versucht, der Städte geschichtliches Dasein in kleinen Zügen, wie sie mir zu Gebote standen, aufleben zu lassen und dadurch zugleich ihre Erscheinung zu würdigen. Niemand kann sagen, wieviel von dem Aroma eines Bauwerks, einer Landschaft, einer Stadt von den großen oder merkwürdigen Erinnerungen abhängt, die damit verknüpft sind. Zuweilen geht von einer alten Mauer ein Hauch aus, der uns überzeugt, hier müsse Wunderbares sich begeben haben, auch wenn wir es nicht wissen; umgekehrt kann unser Wissen Steine formen und melodisch erbeben lassen.
Von den Neubauten des verflossenen Jahrhunderts, die das Bild der alten Städte so vielfach stören, habe ich wenig gesprochen; ich habe sie ignoriert wie das schlechte Wetter, damit meine bescheidenen Skizzen desto hübscher würden.
Frankfurt a/Main
Das alte Reich konnte eine Hauptstadt nicht haben, denn sein Haupt, der Kaiser, hatte keinen festen Sitz, sondern wanderte, wenn er nicht Krieg führte, von Ort zu Ort, um seiner höchsten Aufgabe zu genügen, nämlich Recht zu sprechen. Die Kaiser waren keine Monarchen in dem später aufkommenden Sinne und das alte Reich kein Fürstentum nach heutigem Begriff; eher könnte man es ein Gottesreich nennen, mit einem Richter an der Spitze, dem das Volk sich freiwillig unterwarf, wie der Mensch sich Gott unterwirft. Die Idee eines höchsten Herrn, der Gott und göttliche Gerechtigkeit auf Erden vertritt, ist uralt und taucht immer wieder auf, sei es durch Überlieferung oder weil der menschliche Geist überall und jederzeit Ideen hervorbringen muß, die mit ihm übereinstimmen und die das Vereinzelte zum Universum runden. Aus fernstem Altertum stammt der betupfte Königsmantel als Abbild des gestirnten Himmels, der Reichsapfel als Bild der Erde, die in der Hand Gottes ruht und so in der Hand seines irdischen Vertreters ruhen sollte. Es gehört zu dieser uralten Kaiseridee, daß der Erwählte die ganze Erde beherrsche, wenn sich das auch niemals verwirklicht hat[1q].
Ist die Grundidee stets dieselbe, so gestaltet sie doch jedes Volk anders, nach dem Urbild, das in ihm wohnt, in dem es sich selbst verherrlicht und sich selbst ein Ziel setzt. Derrömische König und Kaiser deutscher Nation glich dem deutschen Gotte: er war der Inbegriff der Macht, Weisheit, Güte und Gnade, namentlich der Quell des Rechtes und der Freiheit. Ihm gehörte die Erde, nicht damit er sie für sich ausnutzte, sondern damit er sie allem Volk austeile und wieder einziehe, wenn der Belehnte gestorben war oder seinen Anteil durch Schuld verwirkt hatte. Wie Gott den Menschen verlieh er seinem Volke Freiheit und Verantwortlichkeit, er ließ sie, anstatt sie zu fesseln, in weiten Kreisen wirken und schaffen. So bildeten sich mannigfache Formen menschlichen Zusammenlebens in dieser kaiserlichen Republik aus und ergab sich eine Ordnung, die man, obwohl es nicht an strengen Bindungen, zum Teil rein ideellen, fehlte, im Vergleich zu den Anschauungen neuerer Zeit Anarchie nennen könnte.
Einige Orte, die zu den Kaisern in besonderer Beziehung standen, konnte man immerhin Hauptstädte nennen: Aachen als die alte Krönungsstadt, Frankfurt als die Stadt, wo die Kaiser gewählt, später auch gekrönt wurden, Wien als die Residenz der Habsburger in einer Zeit, als die fließenden Verhältnisse des Mittelalters zu erstarren begannen. Denkt man an Frankfurts Lage am Main, der die deutschen Lande in eine nördliche und südliche Hälfte teilt, und daß es Goethes Heimat ist, so darf man es wohl einen Mittelpunkt des alten Reiches nennen.
Wer auf dem Römerberge vor dem Rathause steht, im Hintergrunde prächtig herrschend den Bartholomäusdom aufragen sieht, den Weg überblickt, den die Kaiser unter Glockengeläute zur Krönung zogen, dem wird, wenn er die Geschichte seines Volkes auch nur in großen Zügen kennt, Stolz und Andacht das Herz ergreifen. Der Bogen, den die das Rathaus umgebenden Häuser bilden, gleicht in seinem sanften Schwunge einem Diadem, dessen Mitte der denkwürdige Römer mit Limpurg und Frauenstein einnimmt. Ungleich schöner, durch wundervolle Schnitzereien reich verziert,überaus vornehm wirkend durch den dunkelschwarzen Ton des Holzes, sind andere Häuser des Platzes, namentlich das Salzhaus; der Römer ist erst in neuester Zeit durch einen Balkon, Kaiserfiguren und Wappen geschmückt, aber immer noch schlicht. Es gibt auch originellere und schmückendere Brunnen als der mit der Justitia, und die Nikolaikirche mit dem graziösen Umgang, von dem aus einst die Ratsherren den Mysterienspielen zusahen, die von Handwerkern und Schülern auf dem Platze aufgeführt wurden, steht vielen anderen Kirchen an Schönheit nach. Gemessen an den Verhältnissen moderner Großstädte, ist der Römerberg und seine Umgebung klein, und auch wenn man von solchen Vergleichen absieht, wirkt er mehr anmutig als gewaltig. Das Anmutige, Maßvolle ist für Frankfurt charakteristisch, ein Patengeschenk vielleicht des schöngewundenen Flusses, an dem die Stadt erblühte. Ein Zug der Anmut und Heiterkeit geht auch durch die Geschichte der Republik, wie sie ihrem Dichter, dem größten Deutschlands, eigen sind, dessen Leidenschaft, Tiefe und Tragik in ihrer Erscheinung durch freie Anmut und Mäßigung gemildert werden. Dessenungeachtet vermittelt der Römerberg die Stimmung historischer Größe, und weht es vom Turme der Nikolaikirche schwarzrotgolden, in den Farben der Sturmfahne des alten Reichs, so ertönt er in einem strahlenden Akkord feierlicher Freude.
Die Entstehung Frankfurts hängt mit dem Namen Karls des Großen zusammen, der auf der Flucht vor den Sachsen hier eine Furt gefunden haben soll, die ihm den Übergang über den Main ermöglichte und ihn und sein Heer rettete. Daß eine bequeme Übergangsstelle schon früh zum Entstehen einer Ortschaft Anlaß gegeben hat, ist wahrscheinlich und sicher, daß Karl der Große sich gern dort aufhielt und dem von ihm leidenschaftlich betriebenen Jagdvergnügen in dem großen Reichsforst nachging, von dem noch Teile um Frankfurt erhalten sind. Im Jahre 794 hielt ereine Kirchenversammlung in Frankfurt ab, und im selben Jahre starb dort Fastrada, die geliebteste seiner Frauen. Die Entstehung Sachsenhausens wird darauf zurückgeführt, daß eine Anzahl sächsischer Familien am jenseitigen Ufer angesiedelt wurden, was den Bau der Brücke notwendig machte. Der Neigung des Ahnherrn folgend, hielten Ludwig der Fromme und Ludwig der Deutsche sich gern in Frankfurt auf und in der Pfalz wurde Karl der Kahle geboren und starben Ludwig der Deutsche und dessen Sohn Ludwig. Einige nehmen an, daß Ludwig der Fromme die alte Pfalz umbaute, andere, daß er eine neue errichtete; die Leonhardskirche am Main und der Saalhof sollen die Stellen bezeichnen, wo sie sich befanden. Alle Kaiser, die sich nach den Karolingern in Frankfurt aufhielten, bewohnten den königlichen Hof, bis auf Heinrich VII.; dann verfiel er. Im Jahre 1353 kaufte ihn ein reicher Patrizier namens Knoblauch, von dessen Erben er im 18. Jahrhundert an die Familie Bernus überging. Nach mehrfachem Umbau ist von der alten Pfalz nur noch eine romanische Kapelle übrig, aber auch diese wohl kaum karolingischen Ursprungs.
Auch von der Salvatorkirche, einer karolingischen Gründung, die der Legende nach den Namen daher hat, daß der Sohn Ludwigs des Deutschen, Karl, dort vom Teufel erlöst wurde, der ihn besessen und zur Empörung gegen den Vater angestiftet hatte, ist keine Spur geblieben, da sie ganz im Dome aufgegangen ist. Ein erhebender Augenblick aus der Zeit der sächsischen Kaiser, der fälschlich nach Quedlinburg verlegt worden ist, hängt mit der alten Salvatorkirche zusammen. Als Otto der Große im Jahre 942 nach glücklicher Beendigung von Kriegen und Empörungen in Frankfurt die Weihnacht feiern wollte, warf sich ihm vor dem Portal der Kirche ein Mann im Büßergewande zu Füßen; es war sein Bruder Heinrich, der nach der Niederwerfung des von ihm geleiteten Aufstandes entflohenwar. Der Kaiser stutzte und stieß den Flehenden in der ersten Aufwallung des beleidigten Gefühls zurück. Den Bischof, der ihn an die Aufgabe des Christen mahnte, dem Feinde zu verzeihen, erinnerte er daran, daß er das schon siebenmal getan habe, worauf der Bischof die in der früher beliebten Ballade so gefaßten Worte erwiderte: »Nicht siebenmal vergib – Nein, siebenzig mal sieben – das ist dem Herren lieb.« Rethel hat den Augenblick, wo der Kaiser sich verzeihend zu dem knienden Bruder herabbeugt, auf einem Bilde dargestellt, das auf dem Frankfurter Historischen Museum aufbewahrt wird.
Mit dem Jahre 1239 beginnt die Geschichte des Domes, den wir jetzt kennen. Nach der Art des Mittelalters, wo alle Pläne unter dem phantastischen Szepter der Zeit, des Zufalls und der Notwendigkeit erwuchsen, zog sich der Auf- und Umbau der Kirche bis zum Jahre 1514 hin. In den letzten hundert Jahren entstand der Turm, Pfarrturm genannt, für den erst der Brand des Rathauses, das an der Westseite der Kirche stand, den Platz hatte freimachen müssen. In kraftvoll harmonischer Hoheit erhebt sich Frankfurts steinernes Haupt, anstatt in gotischer Spitze einst endigend, in einer stumpfen Haube, über der in einer Laterne die Sturmglocke hing, die der Sage nach aus reinem Silber gegossen war und vier Zentner wog. Dem Apostel Bartholomäus wurde der Turm geweiht, weil die Stadt kurz vorher in den Besitz der Hirnschale dieses Heiligen gelangt war, die noch im 19. Jahrhundert am Bartholomäustage öffentlich gezeigt und verehrt wurde.
Mit der Gründung des Domes hängt der Beginn einer Einrichtung zusammen, die eine irdisch nährende Quelle der Größe Frankfurts bedeutet, nämlich die Messe. Die neue Weihe der Kirche zu Ehren des heiligen Bartholomäus gab Anlaß zu der Kirchweih, aus der die Messe sich entwickelte, anfangs eine Herbstmesse, zu der etwa hundert Jahre später eine Ostermesse hinzukam. Von den Kaisern begünstigt,erlangte sie bald großen Ruf und legte den Grund zu Frankfurts Blüte als Handelsstadt.
Inzwischen war aus der den römischen Königen gehörigen und von ihnen abhängigen eine freie, sich selbst regierende Stadt geworden. Wie die Dome eine sich oft durch Jahrhunderte hinziehende Baugeschichte hatten, so war auch die mittelalterliche Freiheit nicht etwas Angeborenes oder eine mit einem Male zufallende, einheitliche Gabe, sondern sie wurde erworben, erkauft, erkämpft, stückweise, mit Mühe und durch Glück, ein goldenes Kleinod, vielmal in Feuersglut gehärtet, ein Edelstein, aus Tiefen herausgegraben und mit Fleiß und Geschick geschliffen und gefaßt. Nachdem durch Friedrich II. die Stadtvogtei, welche die königlichen Güter verwaltete, aufgehoben war, bemühten sich die beiden städtischen Bürgermeister und der städtische Rat, den Schultheißen zu verdrängen, der in Kaisers Namen das Recht sprach. Erst im Jahre 1372 führten diese Bemühungen zum Ziel, indem Karl IV. der Stadt das Schultheißenamt verkaufte, nachdem der Ritter Ulrich von Hanau, dem er es vorher verpfändet hatte, gestorben war. Die Möglichkeit indessen, der Kaiser könne auf das verkaufte Recht einmal wieder zurückgreifen, blieb bestehen, weswegen noch zu Goethes Jugendzeit, wie er selbst erzählt, nach dem Tode eines Schultheißen hastig zur Wahl eines neuen geschritten wurde. Das wichtige Recht, daß kein Frankfurter Bürger vor ein auswärtiges Gericht gefordert werden dürfe, war 1291 erworben und wurde immer wieder bestätigt, ebenso das Versprechen, nicht verpfändet zu werden.
Aus dieser Frühzeit des Gemeinwesens werden Züge berichtet, die aufrechte, stolze Gesinnung und vernünftige Mäßigung in der Leitung der inneren Angelegenheiten beweisen. Als Adolf von Nassau die Frankfurter Juden zur Zahlung einer bedeutenden Geldsumme zwingen wollte, trat einer von den beiden damals regierenden Bürgermeistern,es waren Heinrich von Prumheim und Volrad von Seligenstadt, dem Kaiser entgegen, um die Ungerechtigkeit, als welche er es offenbar empfand, zu verhindern. Ebenso unerschrocken verhielten sich die Frankfurter dem Papst gegenüber. Während der Regierung Ludwig des Bayers war die Stadt, die ihm anhing, zwanzig Jahre hindurch mit dem Interdikt belegt. Nach des Kaisers Tod wollte der Papst es aufheben, wenn der Rat sich und die Bürgerschaft für Ketzer erkläre und verspräche, keinen mehr als deutschen König anzuerkennen, der die päpstliche Genehmigung nicht erhalten hätte. Der Rat erwiderte, diese Bedingungen ablehnend, er werde fortfahren, dem jeweiligen deutschen Könige zu gehorchen, auch wenn der Papst die Genehmigung versage; die vorgelegte Absolutionsformel zeige antichristlichen Stolz und Übermut und beeinträchtige die Hoheit des Königs und der Kurfürsten. Leider entsprach die Gesinnung des damaligen Königs, es war Karl IV. von Luxemburg, der seiner Reichsstadt nicht; immerhin, als sie auf seinen Befehl sich fügen mußte, tat sie es unter Vorbehalt ihres Rechts.
Gegen das Ende des Jahrhunderts hatten die Frankfurter Unglück in einer Fehde mit den Herren von Kronberg, die der Kurfürst von der Pfalz unterstützte. Trotz der Übermacht des Feindes griffen sie unter Führung des Schultheißen Winter von Wasen und des Stadthauptmanns Breder von Hohenstein und unter Beteiligung aller Patrizier tapfer an, erlitten aber eine vernichtende Niederlage. Unter den 620 durch die Feinde gemachten Gefangenen waren der Schultheiß, der Stadthauptmann, drei Holzhausen, zwei Glauburg, zwei Frosch, ein Weiß von Limburg und die ganzen Metzger-, Bäcker-, Schlosser- und Schuhmacher-Zünfte. Auch das Banner, das der Schultheiß getragen hatte, war verloren. Die finanzielle Belastung, die das mit sich brachte, denn nach Frankfurter Gesetz wurden gefangene Mitbürger auf Kosten der Stadtausgelöst, hätte leicht innere Unruhen erregen können; dem beugte die Regierung vor, indem sie sofort den Rat erweiterte und die Zahl der Bürgermeister auf drei vermehrte, von denen je einer aus dem Patriziat, aus den Zünften und aus der Gemeinde besetzt wurde. Diese Einrichtung wurde bis zum Jahre 1408 beibehalten, wo die Ordnung im Finanzwesen wiederhergestellt war.
Durch Handel und Gewerbe überragte damals Frankfurt seine wetterauischen Schwesterstädte Wetzlar, Friedberg und Gelnhausen noch nicht erheblich; aber als Wahlstadt hatte es doch viel mehr Einfluß und Bedeutung. Von 1140 bis 1500 fanden in Frankfurt zehn Königswahlen statt, von 1140 bis zum Beginn des Interregnums, 1254, einundzwanzig Reichstage. Was für einen Zusammenfluß von Menschen und welche Vorteile das mit sich brachte, kann man aus den Tatsachen ableiten, daß bei Rudolfs I. Königswahl allein der Erzbischof von Trier mit 1800 Vasallen einzog und 1555 Mark Silber ausgab.
Bei einer Doppelwahl war es herkömmlich, daß der Erwählte sechs Wochen und drei Tage vor der Stadt lagerte und seinen Gegner zum Kampf erwartete. Auf Bitten des Kurfürsten ließ Frankfurt Günther von Schwarzburg schon nach sieben Tagen ein. Dieser, der bald darauf, der Sage nach vergiftet, starb, ist der einzige römische König, der in Frankfurt beigesetzt ist; sein Grab ist im Dom durch eine Platte bezeichnet, auf der er in ganzer Figur gerüstet dargestellt ist. Die schöne Stadt am Main hütete nicht die kaiserlichen Grüfte, sondern begleitete die ersten Schritte des Gewählten mit festlichen Bräuchen, altheiliger Symbolik und dem Jubel der Hoffnung.
Durch die Goldene Bulle[1], im Jahre 1356 von Karl IV. erlassen und wahrscheinlich von seinem Geheimschreiber Rudolf von Friedberg verfaßt, die eine Art Reichsgrundgesetz aufstellte, wurde Frankfurt gesetzlich zum Ort der Königswahl bestimmt. Von den 22 Königen, die seitdembis zum Ende des Reichs regiert haben, sind nur fünf nicht in Frankfurt gewählt worden, nämlich Ruprecht von der Pfalz, Ferdinand I., Rudolf II., Ferdinand III. und Joseph I. Ruprecht von der Pfalz, der in Lahnstein gewählt worden war, lag die übliche Zeit von sechs Wochen und drei Tagen, seinen Gegner erwartend, vor Frankfurt, um seine Wahl gesetzlich zu machen. Zur Krönungsstadt bestimmte die Goldene Bulle Aachen; sie blieb es aber nur bis zum Jahre 1521, wo Ferdinand I., in Köln gewählt, in Aachen gekrönt wurde. Seitdem wurden die Könige in Frankfurt nicht nur gewählt, sondern auch gekrönt, nicht ohne daß jedesmal das Recht Aachens gewahrt wurde. Drei Könige, Rudolf II., Ferdinand III. und Joseph I., sind nicht in Frankfurt gekrönt worden.
Die Goldene Bulle, die ihren Namen von dem in Gold gekapselten großen Siegel hat, das an der Urkunde hängt, befindet sich jetzt im Historischen Museum und wurde schon im 17. und 18. Jahrhundert als größte Sehenswürdigkeit Frankfurts hervorragenden Fremden gezeigt. Das Frankfurter Exemplar ist eine Abschrift, die zehn Jahre nach dem Erscheinen der Urkunde auf Ansuchen Frankfurts hergestellt und natürlich teuer bezahlt wurde, ausgezeichnet vor anderen Abschriften durch ein Siegel, das dem der Original-Ausfertigung gleich ist. An Original-Ausfertigungen der Goldenen Bulle sind noch vorhanden die Exemplare von Kurtrier, Kurköln und Böhmen.
Die ritterlichen Geschlechter, die im 12. und 13. Jahrhundert die höchste Schicht in Frankfurt gebildet hatten, die von Bonames, von Bommerstein, von Carben, Kranich von Kranichsberg, von Eppstein, von Kronenberg, die Schenk von Schweinsberg, Schelm von Bergen, von Selbold, von Gödele, von Treisa, von Ursel, starben zum Teil aus, zum Teil verließen sie Frankfurt. Es bildete sich ein neues Patriziat aus größtenteils von auswärts eingewanderten Familien, deren Reichtum hauptsächlich aufHandel beruhte. Die Stalburg, Melem, Heller, Ugelnheimer, Knoblauch hatten zwar noch Grundbesitz; aber im ganzen war wegen der Billigkeit der Bodenprodukte die Landwirtschaft nicht mehr einträglich. Einer der glänzendsten Repräsentanten der damaligen Frankfurter Großkaufleute war der aus Mainz stammende Claus Stalburg, genannt der Reiche. Er trieb hauptsächlich Handel mit Venedig; in seinem Besitz war an Gewändern, Stoffen, Bechern, Schmuckstücken und Kostbarkeiten, was die Zeit Kostbares und Schönes hervorbrachte. Er liebte und sammelte Bücher und interessierte sich für die geistigen Bewegungen seiner Zeit; der Reformation, deren Anfänge er erlebte – er starb im Jahre 1524 – war er geneigt und übertrug die Erziehung seiner Söhne Wilhelm Nesen, einem Freunde des Erasmus von Rotterdam, und den Melanchthon eine Zierde der Wittenberger Universität nannte. Er stiftete ein großes Anbetungsbild in die Karmeliterkirche, auf dem von den drei heiligen Königen einer den Kaiser Maximilian, einer ihn selbst wiedergibt. Unter den vielen Häusern, die er besaß, war auch das Haus Löweneck, das später Goethes Lili bewohnte. Der reiche Jakob Heller stiftet den Kalvarienberg an der nördlichen Seite des Dom-Kirchhofs und ein Altarbild von Dürer in die Dominikanerkirche, das die Mönche später gegen eine jährliche Rente von 400 Gulden dem Herzog Maximilian von Bayern überließen. Es ist im Jahre 1673 in München verbrannt. Ludwig zum Paradies, der Letzte seines Geschlechtes, vermachte der Stadt einen Teil der Bücher, die er gesammelt hatte, und legte damit den Grund zu einer Stadt-Bibliothek. In diesen Kreisen verkehrte Hutten gern, besonders mit den Glauburg, einer von den alten Adelsfamilien Frankfurts; man sagte, er habe eine Tochter aus diesem Hause heiraten wollen.
Wie unsicher indessen auch für diese Bevorzugten die Lebensbedingungen waren, geht aus der großen Kindersterblichkeithervor, der die Zahl der Geburten entsprach. Margarete Stalburg, die Claus den Reichen mit 15 Jahren heiratete, hatte in den folgenden sechzehn Jahren vierzehn Kinder, von denen mehrere früh starben. Jakob Heller, der selbst das älteste von neunzehn Kindern war, mußte sein Vermögen dem Kinde einer Schwester hinterlassen, weil sonst keine Erben da waren; er war der Letzte seines Geschlechts. Das Haus Stalburg wurde im Jahre 1789 abgerissen, um Platz für eine deutsch-reformierte Kirche zu machen; es hatte Türme und Zinnen wie eine Burg und enthielt ein großes Altarbild, das im Jahre 1813 zugrunde ging. Die beiden Seitenflügel, die die Eheleute Claus und Margarete Stalburg in ganzer Gestalt reichgekleidet darstellen, sind erhalten.
Man muß sich die Patrizier dieser Zeit gebildet, großzügig, lebenslustig, aber auch menschlich und warmherzig vorstellen; das scheint die freundliche Sorgsamkeit zu beweisen, mit der sie ihre Dienstboten und andere arme Leute testamentarisch bedachten. Sie gingen, solange sie nicht etwa durch unglückliche Spekulationen ihr Vermögen einbüßten, wie es den reichen Brüdern Bromm ging, die ihren ganzen Besitz in die Ausbeutung Mansfeldischer Kupfergruben steckten und verloren, auf der Höhe des Lebens unangefochten, erwiesen sich gern mildtätig und gönnten jedem das Seine, wie man ihnen das Ihre ließ. Eine untergehende Kultur entfaltete eine letzte wundervolle Blüte, zu der schon neue Verhältnisse beitrugen, deren üble Folgen sich noch kaum bemerkbar machten. Die Verteilung des Vermögens war noch nicht so, daß eine darbende Mehrheit mit Neid und Bitterkeit auf die Besitzenden geblickt hätte, die Daseinsbedingungen waren auch für die unteren Schichten noch erträglich, die Herrschaft der Patrizier noch nicht erdrückend. Indessen, es war doch an dem blühenden Organismus ein krankhafter Flecken zu bemerken, das Gesetz von 1495, wonach die Vermögen, die über 10000 Guldenbetrugen, von der Steuer frei sein sollten. In dieser offenbaren Begünstigung der Reichen und Mehrbelastung der Armen, die auch durch die indirekten Steuern härter als die Besitzenden betroffen wurden, kann man den Beginn schamloser Geldwirtschaft sehen. Man muß deshalb diese Zeit als einen Wendepunkt betrachten, wo sich inmitten der schön gereiften Früchte mittelalterlicher Weltanschauung das Verderben neuer Grundsätze bemerkbar macht.
Nach mittelalterlicher Auffassung hatte die wirtschaftliche Tätigkeit nicht dem Vorteil des einzelnen, sondern der Gesamtheit zu dienen und schloß man, um eine möglichst gleiche Verteilung von Arbeit und Gewinn zu erzielen, den freien Wettbewerb aus. Geld auf Zinsen zu leihen, galt als unchristlich und unsittlich. Da nun der Kaufmann große Gewinne einheimste, die er mehr der Benutzung günstiger Umstände und der Überforderung des Käufers verdankte als der Arbeit, faßte Luther, ganz und gar mittelalterlicher Anschauungsweise anhängend, eine leidenschaftliche Abneigung gegen diesen Stand. Er warf ihm namentlich vor, wie er in der Schrift Von Kaufhandlung und Wucher ebenso scharfsinnig wie wohlwollend auseinandergesetzt hat, daß er die Regel angenommen habe, er dürfe seine Waren so teuer verkaufen, wie er könne, womit der Hölle Tür und Fenster aufgetan sei, während die gute Regel sei, so teuer zu verkaufen, wie recht und billig sei. Dieser und noch anderer Tücken und Schliche halber hielt er die Kaufleute für nicht viel besser als Räuber. Als Gegner des Importhandels klagte er, daß die Frankfurter Messe das Gold- und Silberloch sei, »dadurch aus deutschen Landen fließt, was nur quillt und wächst bei uns und gemünzt und geschlagen wird«. Die Deutschen seien dazu in die Welt geschleudert, alle Länder reich zu machen und selbst Bettler zu bleiben. Nach seiner Auffassung sollten die Deutschen nach Möglichkeit mit eigenen Produkten und selbstverfertigten Waren sich begnügen, anstatt sich an fremdländischen Luxus zugewöhnen. Mit Widerwillen sah er das mit der Messe verbundene Geldgeschäft um sich greifen, das bereits sehr lebhaft war, wenn auch noch nicht so wie im achtzehnten Jahrhundert, wo es in Frankfurt 40-50 sogenannte Wechseljuden gab, die sich damit beschäftigten, gute Münze aufzukaufen und schlechte in Umlauf zu bringen. Das war zwar durch Reichsgesetz verboten, aber die Frankfurter Regierung ließ es stillschweigend hingehen, wenn sie nicht gar Vorteil dabei fand.
Die Folge davon, daß diese Verhältnisse sich im Laufe des 16. Jahrhunderts immer mehr zuspitzten, die reichen Patrizier sich von den verarmenden Handwerkern immer mehr abschlossen, war der große Aufstand des Jahres 1614, den der Lebküchler Vincenz Fettmilch[2] leitete, und der sich zugleich gegen die oligarchische Regierung und gegen die Juden wendete.
Im Jahre 1240 wurden in Frankfurt 180 Juden teils erschlagen, teils verbrannt. Diese Verfolgung, bei Gelegenheit welcher zuerst eine Judengemeinde in Frankfurt erwähnt wird, soll dadurch entstanden sein, daß eine wider Willen getaufte Jüdin einem angesehenen Christen ihre Hand verweigerte, weil sie mit einem Juden versprochen war. Als Kammerknechte des Kaisers waren die Frankfurter Juden damals gut gestellt, hatten eigenen Gerichtsstand und eigene Gemeindeverwaltung, durften Grundeigentum erwerben und ihren Wohnsitz nach Belieben wählen. Die Judengasse[3] wurde durchaus nicht nur von Juden bewohnt. Nachdem die Stadt das Eigentumsrecht über die Juden an sich gebracht hatte, verschlimmerte sich ihre Lage: im Jahre 1460 wurde ihnen die Judengasse als ausschließlicher Wohnort angewiesen. Anderseits konnten sich auch die Juden immer mehr bereichern, je mehr der Frankfurter Handel aufblühte und das Geld- und Wechselgeschäft, wie es die Anwesenheit der Meßfremden mit sich brachte, zunahm, das ja in ihren Händen lag. Während in der Bürgerschaftsich Haß gegen die Juden ansammelte, denen sie vielfach verschuldet war, nahm die Regierung sie in Schutz, weil sie an den gewinnbringenden Geldgeschäften beteiligt war oder daraus Vorteil zog. Die eigentlich handelnden Träger des Aufstandes waren unzufriedene Kleinbürger, im Hintergrunde wirkten aber auch Angesehene mit, namentlich die neu zugewanderten niederländischen Familien, die du Fay, de Neufville, Bernoully, d'Orville, die erst später in das Patriziat eintraten.
Nach langen wechselvollen Verhandlungen und Kämpfen wurde Fettmilch mit mehreren Genossen hingerichtet. Beim Besteigen des Schafotts, das an der Stelle des jetzigen Gutenbergdenkmals stand, soll Fettmilch gesagt haben, er hoffe zu Gott und wisse bestimmt, daß Gott, bevor er sterbe, ein Zeichen tun werde. Erst nach vollzogener Hinrichtung stürzte der anwesende Ratsherr Joh. Ad. von Holzhausen vom Schlage getroffen zusammen, was vom Volke als Erfüllung der Prophezeiung angesehen wurde.
Die von der Volkswut vertriebenen Juden wurden im Triumph und mit Trommelschlag in die Judengasse zurückgeführt. Es wird berichtet, daß ein Jude namens Oppenheim gebeten habe, eine Strecke weit selbst die Trommel schlagen zu dürfen, was ihm auch bewilligt worden sei. An den drei Toren der Judengasse waren drei große, auf Blech gemalte Reichsadler angebracht mit der Aufschrift: Römisch-kaiserlicher Majestät und des heil. Reiches Schutz. Aller Schaden, den die Juden während des Aufstandes durch Plünderung oder sonst erlitten hatten, wurde ihnen ersetzt. Im übrigen Reich bemerkte man mit Groll, daß die den Lutheranern verliehenen Privilegien nicht überall mit demselben Eifer innegehalten würden, wie auf den Schutz der Frankfurter Juden verwendet werde. Als beständiges Merkmal der Warnung und Drohung ließ die Regierung die Köpfe der hingerichteten Rebellen am Brückenturm befestigen. Dort sah sie noch mit GrauenGoethe als Knabe und fand, im Alter sich daran erinnernd, Worte des Mitgefühls und der Anerkennung für den unglücklichen Bekämpfer sozialer Mißstände.
Wie in allen Städten hatte in Frankfurt die herrschende Klasse im 17. Jahrhundert einen engherzigen Charakter angenommen; trotzdem zeigte sich gelegentlich der Geist überlegener Menschlichkeit. Als die Gelnhauser Bürger sich im Jahre 1629 bei der Regierung beschwerten, daß den Hexen nicht genügend zuleibe gegangen werde, und als der Gelnhauser Magistrat sich deshalb an den Frankfurter wendete, da Gelnhausen das Recht von Frankfurt hatte, gaben die Frankfurter folgende besonnene Antwort: »… den anderen von Euer fürsichtigkeit burgerschafft erregten puncten aber betreffendt, sihet solches einem glimmenden feur sehr ähnlich und wirdt mitt gottes beystandt sonderlich darbey zu wachen sein; erachten zwar, daß nur der gemeinste man und feldarbeitter interessiert, welchen als dan die Prediger dero wahn, als ob dergleichen geclagte schäden von zauberern herrühren theten auff den cantzlen oder auch etwa den principalioren privatim mitt guten gründen zu benehmen und eines besseren zu underrichten ahnzumahnen weren; da aber auch verständigere den sachen beyfällig und von gemelten ihrer intention und vorhaben gedachter masen nicht zu differriren und lassen zu underrichten, so würden Euer fürbesichtigkeit darauff zu sehen, was die in allegirten aussagen vermelte persohnen sonsten für ein leben und wandel führeten, auch deren besagungen zu observiren und darüber rechtsgelährten raht zupflegen und sonderlich dabei zu gedencken haben, daß die peinliche halsgerichtsordnung art. 15 item 44 und sonsten gelehrt, damit unschuldiger menschenbluht nicht vergossen werde; und erinnern wir uns benachbarter exempel, wie weit ahn etliche orten solch wesen einreisen thutt, ahn andern aber sehr behutsam verfahren und solchen blosen aussagen nicht nachgesetzet, auch von hohen standtspersohnenalso zu verfahren bedenken getragen, ob auch schon fast dergleichen ahnsuchen bey ihnen auch bestehen.« Das Ergebnis der Betrachtungen wird darin zusammengefaßt, daß nur greifbare schwere Verbrechen, wie Mord und ähnliche Missetaten, mit dem Tode zu bestrafen wären.
Denkt man daran, wie fast überall der Hexenwahn die Einsicht der Menschen verdunkelte und sie zu einem sinnlosen Rechtsverfahren und bösartigster Grausamkeit antrieb, so vernimmt man dieses von Vernunft und Menschlichkeit durchleuchtete Gutachten beglückt wie eine Bürgschaft nicht ganz erloschenen Lichtes.
Der Sage nach wurde die Tortur in Frankfurt durch das kluge und gute Vorgehen des Henkers Ulrich Waldmann abgeschafft. Nachdem er sich von der Unschuld der vermeintlichen Zauberinnen, deren Geständnis er erpressen mußte, überzeugt hatte, weigerte er sich eines Tages, an ein paar vorgeführten Frauen seinen schrecklichen Dienst zu verrichten. Dem erzürnten Rat erklärte er, beweisen zu können, daß durch die Folter Unschuldige gewaltsam zu Schuldigen gemacht würden. Er tötete vor Zeugen sein bestes Pferd und bezichtigte dann einen seiner Knechte, es getan zu haben. Der Tortur unterworfen, gestand der Knecht, was er zuvor abgeleugnet hatte, das Pferd, um seinen Herrn zu ärgern, umgebracht zu haben, worauf den Ratsherren die Augen aufgingen und die Folter künftig nicht mehr angewendet wurde. Hat sich dies auch nicht wirklich begeben, so meint man doch, es hätte sich da begeben können, wo es erdacht und geglaubt wurde.
Frankfurt hatte ein doppeltes Gesicht: das der Geldstadt und das der Krönungs- und freien Reichsstadt, Noch zu Goethes Zeit, ja noch um 1848, als Frankfurt die Hauptstadt eines idealen Reiches wurde, herrschte im ganzen ein fröhlich unbekümmerter, jovialer Geist, und neben etwaigem, steifem Wesen in den regierenden Kreisen entfaltete sich Unabhängigkeitssinn und ausgelassenes Kraftgefühlder Bürgerschaft. Einig waren alle im Festhalten an der stolzen Überlieferung, in der Anhänglichkeit an Kaiser und Reich, in der Abneigung gegen die aufgedrängte preußische Herrschaft. Als im Jahre 1867 der Pfarrturm, der Turm des Kaiserdoms, brannte und zusammenstürzte, erschien der Untergang des vertrauten Hauptes als Symbol des Untergangs einer ruhmreichen und glücklichen Existenz.
Mit prahlerischen Denkmälern und plump überladenen Häusern machte sich anfangs die neue Zeit breit; die vornehme Gemessenheit der Barockpaläste an der Zeil mußte anspruchsvoll häßlichen Geschäftshäusern weichen. Trotzdem, wieviel Gutes auch verschwand und wieviel Geschmackloses einzog, hat Frankfurt doch in vielen Teilen den Charakter heiterer Majestät bewahrt. Ein Häuflein putziger Häuser mit Verkaufsschirnen und Ladenerkern, traulicher Höfe, winziger Plätze mit Brunnensäulen zwischen Dom und Römerberg entfaltet neuerdings durch größtenteils verständnisvolle Bemalung, die die Konstruktion hervortreten läßt, bestrickenden Reiz. Schon die Namen der Straßen: Fünffingereck, Rapunzelgäßchen, Goldhutgasse, Hinter dem Lämmchen, Goldenes Löwenplätzchen und die ebenso wunderlichen Namen der Häuser entrücken den Wanderer in eine Kindermärchenwelt. An den Eschenheimer Turm, Frankfurts Wahrzeichen, reiht sich noch manche würdige Front und das Goethehaus und seine Umgebung versetzt uns in die Zeit eines herrschaftlichen Bürgertums, das sich auf Grund ererbter und bewahrter Tüchtigkeit neben Fürsten stellte. Möchte doch das Antlitz der freien Reichsstadt nicht ausgelöscht werden, sondern auch ferner durch das blendende der neuen Großstadt mit unvergänglicher Anmut hindurch schimmern.
Mainz
Als die ehemalige Erzherzogin Marie Luise[4] zum ersten Male, von ihrem kaiserlichen Gemahl geführt, auf den Balkon des Deutschherrenhauses in Mainz trat, rief sie überwältigt von der sie umgebenden Schönheit aus: Ah, comme c'est beau! worauf Napoleon sich sofort erbot, das Haus zu einem kaiserlichen Palast einzurichten. Der breite Rhein, der eben den Main in sich aufgenommen hat, rollt hier mit gelassener Majestät, auf der Höhe seines Daseins in die unabsehbare, fruchtbare Ebene. Die sanften Ufer, die nahen Hügel, der ferne charakteristische Umriß des Taunus mischen Lieblichkeit und Abwechslung in die einfache Größe der Landschaft, die einen Sitz bequem genießender Herrschaft zu tragen bestimmt scheint. Aber die Stadt, die hier entstand, hieß von jeher das goldene Mainz, und von dem Glanz des Goldes kam ihr Verhängnis und Gefahr. Gefährlich und verhängnisvoll war die Lage zwischen den Völkern, von denen jedes diesen beherrschenden Punkt begehrte, und zwischen Gefahr und Verhängnis hat immer Mainz geblüht, immer untergehend und sich erneuernd. Eine römische Stadt hat die Erde verschlungen, eine mittelalterliche, die darüber erwuchs, das Feuer zerstört.
Die junge und jüngste Generation kennt kaum noch das schöne, balladenhafte Gedicht Simrocks vom Helden Drusus[5], der die römischen Adler in die deutschen Wälder trug, bisihm ein dämonisches Weib warnend entgegentrat: »Jene Marken unsrer Gauen – Sind dir nicht vergönnt zu schauen – Stehst am Markstein deines Lebens – Deine Siege sind vergebens – Säumt der Deutsche gerne lange – Nimmer beugt er sich dem Zwange – Schlummernd mag er wohl sich strecken – Schläft er, wird ein Gott ihn wecken!« Erschüttert kehrte Drusus nach Mainz zurück und starb, unendlich betrauert von seinen Legionen, die ihm, so geht die Sage, das gewaltige Grabmal auftürmten, das noch jetzt, wenn auch beträchtlich weniger hoch, als ein Denkmal der Römerzeit innerhalb der Zitadelle sich erhebt.
Das Unsichtbare ist stärker als das Sichtbare:[2q] die festesten Mauern verzehrt die Zeit, der Name dauert, leuchtet sonnenhafter, wie er sich mehr und mehr im Äther verklärt, erklingt mit vollerem Ton, je tiefer der Körper, der ihn trug, in die Vergangenheit versinkt. Nicht viel mehr als Namen sind übriggeblieben von den Heiligen und Hohen, die den Charakter und die Bedeutung von Mainz begründeten. Die Namen Dagobertwik und Alteburg deuten auf den Merowingerkönig Dagobert, auf den die Anfänge des germanischen Mainz zurückgehen. Wer ihm aber für ein Jahrtausend das Gepräge gab, das war der Angelsachse Winfried Bonifazius[6], einer jener Auserwählten, die, einem angeborenen Drange folgend, halb bewußt, halb unbewußt die Zukunft der Völker bestimmen. Die Heiden, insbesondere die seinem Vaterlande benachbarten Friesen zu bekehren, das war der erste Trieb des Jünglings; auch künftig und im Alter zog es den Träger höchster Würden wieder zu den Friesen, die ihn erschlugen, als hätte dort von jeher der Tod gestanden und ihn magisch gezogen, wo der Ring des Schicksals, zugleich Deutschlands Schicksal, sich bildete und schloß. Der Mann, der sich nach dem Märtyrertode sehnte, erstrebte doch auch eine irdisch feste Ausgestaltung des Christenglaubens, die eins war mit der Herrschaft der Franken und ihrer von der römischen gespeisten Kultur. Die festländischen germanischenStämme waren für ihn Heiden, die bekehrt werden mußten, und um sie an das Christentum zu binden, band er sie an den Papst, den höchsten Bischof der Christenheit, das Haupt des einstigen Mittelpunktes der Erde. Indem er sich ihn zum Herrn wählte, seine Befehle suchte und annahm, fesselte er die deutsche Kirche an Rom und schuf eine Verbindung, die den Ideen der Zeit gemäß war und bei allen zerstörenden Folgen für Deutschland dem Zusammenhang des Abendlandes diente und insofern groß und notwendig war. Damals war Bischof zu Mainz Gerold, der Karlmann, den Sohn Karl Martells, in eine Schlacht gegen die Sachsen begleitete und dort fiel. Karlmann machte zu Gerolds Nachfolger dessen Sohn Gewilieb, der wiederum, von Rachegedanken erfüllt, mit in den Krieg zog. Als die feindlichen Heere sich an der Weser begegneten, ließ Gewilieb denjenigen, der seinen Vater getötet hatte, um eine Unterredung bitten und stieß ihm das Schwert in die Brust. Karlmann, der in dieser Schlacht siegte, fand die Tat seines kriegerischen Bischofs nicht anstößig; aber Bonifazius hatte eine andere Auffassung von den Pflichten der Geistlichen und bewirkte Gewiliebs Absetzung. Zwei Jahre später kam er selbst an seine Stelle. Gregor III. hatte ihn zum Erzbischof ernannt und ihm die Bekehrung und Leitung aller Germanen anvertraut, Papst Zacharias erhob das Erzbistum Mainz zur Metropolitankirche, der fast alle damaligen Bistümer unterstellt wurden. Bonifazius hätte Köln vorgezogen, weil er dort den noch unbekehrten Friesen näher gewesen wäre, aber er ordnete sich dem Willen des Papstes unter. Nachdem er sich mit der Organisation der deutschen Kirche jahrelang beschäftigt hatte, folgte er, sich dem Tode nahe fühlend, noch einmal dem Drange seiner Jugend und begab sich mit mehreren Gefährten nach Friesland, wo er im Jahre 755 erschlagen wurde. Seine Leiche wurde, so wie er es bestimmt hatte, nach dem von ihm gegründeten Kloster Fulda gebracht, seine Eingeweide jedoch behieltMainz, und sie wurden in der Johanniskirche in einer besonderen Gruft beigesetzt. Diese Kirche in nächster Nähe des Doms gilt als die älteste von Mainz und soll schon in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts als Taufkirche bestanden haben. Im 12. Jahrhundert wurde sie der Aldedum, der alte Dom, genannt, und aus gewissen Gebräuchen ging die Abstammung des Domstiftes vom Johannisstift hervor. Im 13. Jahrhundert drohte der alten Kirche der Einsturz, aber erst hundert Jahre später wurde sie neu erbaut und im 17. Jahrhundert neu hergerichtet. Nachdem sie von den Franzosen als Magazin benutzt worden war, wurde sie im Jahre 1825 ›ganz verfallen‹ den Protestanten überlassen, die sie wiederum erneuerten. Turm, Südmauer und Dach stammen noch aus alter Zeit. Erzbischof Gerhard von Nassau, ein Enkel König Adolfs, ließ im Jahre 1357 ein Grabmal aus rotem Sandstein bei der Gruft des heiligen Bonifazius aufstellen, worauf er im erzbischöflichen Gewande dargestellt ist. Der Stein ist vor hundert Jahren in den Dom versetzt worden.
Ein würdiges Denkmal aus der Frühzeit der im Schutze der Erzbischöfe erblühenden Stadt sind die Bronzetüren, die der große Erzbischof Willegis am Ende des 10. Jahrhunderts gießen ließ, die ältesten in Deutschland nächst denen zu Aachen. Er schenkte sie der Bürgerschaft für die Liebfrauenkirche oder Sankt Marien zu den Greden, die sie damals erbaut hatte, und die lange die einzige Pfarrkirche von Mainz war. Hundert Jahre später war ein Graf von Saarbrücken, Adelbert, Erzbischof, der Kanzler Kaiser Heinrichs V. war. Als nun Heinrich in den Bann getan wurde, fiel Adelbert von ihm ab, worauf der erzürnte Kaiser ihn nach der Burg Trifels in Rheinbayern bringen und dort in ein Verließ werfen ließ. Die Ritter und Bürger von Mainz nahmen die Partei ihres Bischofs, belagerten den Kaiser in seinem Palast, als er ein paar Jahre darauf in Mainz eine Reichsversammlung hielt, und erzwangen die FreilassungAdelberts, der zum Gerippe abgemagert und entkräftet zurückkehrte. Diesen erfolgreichen Trotz der Stadt verzieh der Kaiser nicht, sondern rückte mit Heeresmacht gegen sie heran; aber es gelang Adelbert, sie zu entsetzen. Eingedenk der Opfer, die die anhänglichen und tatkräftigen Bürger ihm gebracht hatten, verlieh der Erzbischof ihnen ein Privileg, das seiner Wichtigkeit wegen nicht nur auf Pergament geschrieben, sondern in die ehernen Türflügel des Willegis eingegraben wurde. Es ist in lateinischer Sprache abgefaßt und erkannte den Bürgern von Mainz das Recht zu, außerhalb ihrer Mauern keinem Gericht und keiner Besteuerung unterworfen zu sein, sondern innerhalb ihrer Mauern nach ihrem angeborenen Recht gerichtet zu werden und keine anderen als die hergebrachten Steuern zu zahlen. Während die unvergleichliche Liebfrauenkirche vernichtet ist, bewahren die Metalltüren, an den Dom versetzt, noch die ehrwürdige Inschrift. Die Liebfrauenkirche, von jeher ein Ziel der Blitze, wurde nach mehreren Bränden im gotischen Stile aufgebaut; vielleicht war grade der Umstand, daß nur ein verhältnismäßig kleiner Platz für sie verfügbar war, die Ursache ihrer phantasievoll eigenartigen Gestalt. Die übriggebliebenen Abbildungen zeigen die Pracht des durchsichtigen Turmes, der kühnen Fenster, die kaum noch zusammenhängende Mauer übrigließen, so daß das schwere Gebäude wie ein wunderbar verzweigtes, aus überirdischem Samen aufgeschossenes Riesengewächs aussah. Das Portal, zu dem von der Rheinseite her die Stufen hinaufführten, von denen die Kirche den Namen hatte, war mit einer Darstellung des Jüngsten Gerichtes geschmückt, das in seiner figurenreichen Entfaltung einem steinernen Epos geglichen haben muß. Nachdem Sankt Marien durch das Bombardement des Jahres 1793, das so viele Kirchen vernichtete, stark beschädigt, aber keineswegs zertrümmert war, wurde sie von den Franzosen, deren Zerstörungslust fast auch der Dom zum Opfer gefallen wäre, trotz aller Gegenbemühungenkunstverständiger Mainzer abgetragen und verschwand.
Weit eher schon als ihre Kirche ging die Freiheit und Kraft der Mainzer Bürgerschaft unter. Je selbständiger sie wurde, desto reizbarer wurden die Beziehungen zwischen ihr und den Erzbischöfen, und bei den Kaisern, die mit ihrem Kanzler und dem Primas der deutschen Kirche sich so gut wie möglich abfinden mußten, fand sie nicht immer Unterstützung. Als der wegen seiner Schroffheit bei Volk, Ritterschaft und Domkapitel gleichmäßig verhaßte Erzbischof Arnold von Seelenhofen von den Aufständischen im St. Jakobskloster, wo er sich verschanzt hatte, getötet worden war, vollzog Friedrich Barbarossa furchtbare Strafe, indem viele Bürger verbannt, die Stadtmauern niedergerissen, Rechte und Privilegien aufgehoben wurden. Das Sinken der Kaisermacht war für Mainz wie für fast alle Städte im Reich günstig. Im Einverständnis mit dem Erzbischof Siegfried III. von Eppstein, der die Gegenkönige Heinrich Raspe und Wilhelm von Holland erhob, nahm die Stadt gegen die Hohenstaufen Partei. Der mächtige Mann wurde von den Bürgern zur Nachgiebigkeit gezwungen und gestand ihr eine weitgehende Unabhängigkeit zu. Sie durften einen Rat wählen, der lebenslänglich im Amte blieb, sie waren frei von Kriegsdienst, brauchten sich keine willkürliche Besteuerung gefallen zu lassen, und der Erzbischof durfte weder in der Stadt noch im Umkreis einer Stunde vor den Toren eine Burg bauen. Dagegen verpflichtete sich die Bürgerschaft, den Erzbischof um keines Menschen, auch um des Kaisers willen nicht zu verlassen. Sie wollten also nicht den Kaiser, sondern den Erzbischof als den Quell ihrer Freiheit betrachten, den Erzbischof, der doch im Grunde nach ihrer Unterwerfung trachten mußte.
Die Verwüstungen im Rheinlande, die eine Folge des Kampfes zwischen Hohenstaufen und Welfen waren, ließen in einigen Häuptern der Mainzer Bürgerschaft den Gedankeneines Bundes entstehen, der seinen Gliedern durch ihre vereinigte Kraft den Frieden verbürgen würde. Der ausgesprochene Zweck des Bundes war die Aufrechterhaltung von Recht und Frieden und der Schutz aller Schwächeren gegen die Mächtigen. Seinen Kern bildete die Verbindung der Städte Mainz und Worms, die sich vorher befehdet hatten, weil Worms zu den Hohenstaufen hielt, die aber schließlich die Gemeinsamkeit ihrer Interessen begriffen. Bald traten Bischöfe, Fürsten und Edle dem Bunde bei, denn er war nicht auf Städte beschränkt, und auch der Erzbischof, es war Gerhard I., billigte ihn. Kam der Rheinische Bund auch nicht zu der Wirksamkeit, die von ihm erwartet wurde, so war er doch ein Zeichen erstarkter Kraft und selbständiger Politik der Bürger. Als sein eigentlicher Begründer gilt Arnold der Walpode, einer der bedeutendsten Mainzer Familien angehörig, die im Jahre 1128 zuerst genannt wird. Der Name kommt von dem Amt des Gewaltboten, das die Walpod im 14. Jahrhundert aufgaben, worauf es an die Zum Baumgarten kam. Die Walpoden teilten sich in verschiedene Zweige; der berühmte Arnold führte einen gekrönten Löwenkopf im Wappen.
Das städtische Regiment lag in Mainz wie in allen anderen Städten in den Händen der begüterten vornehmen Familien, die in festungsartigen Häusern wohnten, deren Namen sie annahmen. Eines der hervorragendsten und weitverzweigtesten dieser Geschlechter waren die Gensfleisch, die mehrere Höfe in Mainz besaßen und die höchsten Stellen bekleideten. Die Geschlechterherrschaft erfuhr die erste Erschütterung durch finanzielle Schwierigkeiten, in welche die Stadt geriet. Als im Jahre 1328 zwei Erzbischöfe, Balduin von Luxemburg und Heinrich von Virneburg um den Besitz des Erzstifts stritten, entschied sich die Stadt für Heinrich, der Kaiser für Balduin, und in dem daraus entstehenden Kampfe zerstörten die Mainzer drei Klöster. Vom Kaiser in die Acht getan, mußten sie sich endlich fügen und wurden verurteilt,den angestifteten Schaden wieder gutzumachen. Die daraus sich ergebenden Schulden und Verlegenheiten benützten die Zünfte, einen Anteil am Regiment zu fordern und durchzusetzen. Gegen die neue demokratische Ordnung erhoben sich viele junge Patrizier, und ein Kampf entspann sich, in dem die Burg des Friele zum Gensfleisch geplündert wurde. Eine Anzahl Patrizier wanderten aus, kehrten aber zum großen Teil zurück, und eine Sühne zwischen den Parteien wurde geschlossen. Wie es zu gehen pflegte, waren die Zünfte nun zwar in die Regierung eingetreten, konnten aber den überwiegenden Einfluß der Geschlechter nicht hindern, wovon neue Unzufriedenheit die Folge war. Im Jahre 1411 wanderten wieder Patrizier aus, darunter die Gensfleisch, Salmann, zum Jungen, Humbrecht, Fürstenberg, Wallertheim, von denen nicht alle zurückkehrten, und dasselbe wiederholte sich zehn Jahre später. Das Ergebnis der Zwietracht war eine neue Verfassung, in der die Zünfte nun sogar das Übergewicht hatten, indem den aus 36 Mitgliedern bestehenden Stadtrat nur zwölf Patrizier besetzten. Die Gemeinde konnte sich ihres Sieges nicht lange freuen; denn der völlige Untergang der alten städtischen Freiheit stand bevor.
Wieder wurde eine zwiespältige Bischofswahl den Bürgern zum Verhängnis. Diether von Isenburg, ein kluger und herrschsüchtiger Mann, wurde von Papst und Kaiser abgelehnt, die ihm Adolf von Nassau entgegenstellten. Die Bürgerschaft blieb dem Isenburger treu, der das Erzstift schon drei Jahre innehatte, und entschloß sich zum Kampfe. Niemandem war es bekanntgeworden, daß ein kleiner Teil der Bürger und die Domherren, darunter der Bürgermeister Zum Dymerstein und der Domherr Ewald Faulhaber von Wechtersbach mit Adolf in verräterisches Einverständnis eingetreten waren. Mit ihrer Hilfe gelang es dem Feinde, durch das Gautor einzudringen und unter der überraschten Einwohnerschaft ein Blutbad anzurichten. Als die Stadt überwältigt und besetzt war, zog Adolf, der draußen denAusgang abgewartet hatte, ein und verhängte ein vernichtendes Strafgericht über die Bürger. Sie wurden auf den alten Tiermarkt, den jetzigen Schillerplatz, geführt, um unter Bewachung der siegreichen Gegner ihr Schicksal zu erfahren. Alle Freiheiten und Privilegien wurden aufgehoben, die Stadt dem Erzbischof untertänig erklärt, eine Menge von Höfen und Häusern eingezogen und alle Bürger, ausgenommen die, welche nicht entbehrt werden konnten, wie zum Beispiel die Bäcker und andere Handwerker, bis auf weiteres aus der Stadt gewiesen.
War dies unglückliche Ende bürgerlicher Freiheit auch nicht die unmittelbare Folge der demokratischen Regimentsveränderung – denn ob zurückgesetzte Patrizier aus Unmut und Rachsucht am Verrat beteiligt waren, ist nicht bekannt – so wäre es doch vielleicht nicht soweit gekommen, wenn die Stadt nicht durch die vorhergehenden Bürgerkämpfe und die veränderte Besetzung des Rats geschwächt gewesen wäre. Alles aber mag wohl damit zusammenhängen, daß die alten Geschlechter überhaupt schon ihrem natürlichen Ende zuneigten. Manche erloschen schon im 14. Jahrhundert, wie die Zum Pilgrim, die Seelhofen, die Zum Baumgarten und die Zum Ageduch, die meisten aber im 15., Zum Weidenhof, Zum Clemann, Zum Blashof, Zum Lichtenberg, Zum Bart, Zum Spiegel, von Bingen, Bechtelminzer, Seeheimer, Achheimer. Andere, deren Häuser vom Erzbischof Adolf eingezogen waren, wanderten aus, einige nach Frankfurt, andere nach Straßburg, und unter diesen waren die Zum Frosch, die Zum Landeck und die Gensfleisch zum Laden, jener Stamm der Gensfleisch, dem Johannes Gutenberg, der Erfinder der Buchdruckerkunst, entsprossen sein soll. Von dem verräterischen Bürgermeister Zum Dymerstein erzählen einige, er sei im Kampfe gefallen, andere, er habe sich, als er die unerwartet furchtbaren Folgen seiner Tat erkannt habe, in Verzweiflung selbst getötet. Das Haus »Zum Dymerstein« soll lange verrufen gewesen sein und kam endlichan einen Domherrn Knebel von Katzenellnbogen, der im Jahre 1600 ein neues, noch stehendes Haus auf der Stelle errichten ließ.
Adolf von Nassau hatte nicht den Mut, in der durch ihn gestürzten Stadt zu wohnen, sondern residierte in Ellfeld, wo auch Gutenberg, unter das Hofgesinde des Erzbischofs aufgenommen, seine besten Lebensjahre zubrachte. Mehr Haß als Adolf von Nassau hatte Diether von Isenburg verdient, der nach Adolfs Tode, von ihm selbst vorgeschlagen, das Erzstift erhielt und nunmehr unangefochten in seinem Besitz blieb. Uneingedenk der unsäglichen Leiden und Verluste, die die Bürgerschaft um seinetwillen erlitten hatte, erkannte er die von seinem einstigen Gegner herbeigeführte Umwälzung an und ließ sich als Herrn der Stadt huldigen. Die alte Inschrift auf den Bronzetüren des Willegis erinnert somit nicht nur an die Dankbarkeit Adelberts, der im 12. Jahrhundert die Freiheitsurkunde ausstellte, sondern auch an den Undank Diethers, der im 15. Jahrhundert das durch ihn veranlaßte Unglück für sich ausnutzte. Auf demselben Platze, wo Erzbischof Adolf die Bürger versammelte, damit sie ihr Urteil vernähmen, das sie ihrer Rechte und ihrer Heimat beraubte, veranstaltete Diether ein Turnier, zu dem er die Ritterschaft, Grafen und Herren des Rheins und der Länder Franken, Bayern und Schwaben einlud. Das Geschenk, das er der Stadt machte, vielleicht als Ersatz für die verlorene Selbständigkeit, die Universität, ist niemals zur Blüte gekommen; auch spätere Kurfürsten bemühten sich vergebens, ihr Leben einzuflößen.