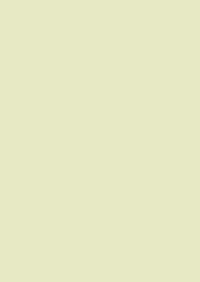
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die vorliegende Thesis wurde von Olaf Keser-Wagner im Rahmen des Studienganges "International MBA in Management & Communications" zur Erlangung des wissenschaftlichen Grades "Master of Business Administration (MBA) erstellt. Sie umfasst insgesamt 123 Seiten, bei 57 Quellen. Note 1,0. Verteidigt an der FH-Wien der WKW Ausgehend von einer Vielzahl von Berichten und Studien über die Notwendigkeit individueller Mitarbeiterführung und individueller Einkaufserlebnisse, arbeitet der Autor heraus, dass sich überschneidende Motivlagen in allen diesen Veröffentlichungen ergeben. Ergänzt durch neuere Berichte aus der Neurobiologie und Herangehensweisen der personaldiagnostischen Tools Reiss-Profil, MotivStrukturAnalyse und MotivationsPotenzialAnalyse, durchleuchtet er die Komplexität eines wirklich individuell zu führenden Dialogs. Um aus dieser hohen Komplexität herauszukommen, schlägt Keser-Wagner vor, sich der Qualität von Dialogen mehr zu widmen und beschreibt am Beispiel von dm-Drogeriemarkt eine Dialogkultur in einem Unternehmen. Abschließend zeigt er auf, wie mit der "Dynamischen Urteilsbildung" von Lex (Alexander) Bos Dialoge in Zukunft anders geführt werden können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 104
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorgelegt von Dipl. ing. agr. (FH) Olaf Keser-Wagner
Jahrgang MBA 2012-14
Matrikelnummer: T-1012-00112
Wintersemester 2013/14
14.März.2014
Eidesstattliche Erklärung
Ich erkläre, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und mich auch sonst keiner unerlaubten Hilfe bedient habe. Ich erkläre weiteres, das ich diese Arbeit bisher weder im In- noch im Ausland in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt habe."
München, 14.März 2014
Olaf Keser-Wagner
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Gallup Engagement Index im Zeitverlauf
Abbildung 2: Kundenzufriedenheit nach Dornach als Gleichgewichtszustand
Abbildung 3: Magisches Dreieck in Unternehmen
Abbildung 4: Einflüsse auf das Magische Dreieck
Abbildung 5: Leistungswirtschaftlicher Prozess
Abbildung 6: Schlechte Meinung von Entscheidern zu Netzwerken
Abbildung 7: Anteil Tablet-Nutzer 2010 - 2016
Abbildung 8: Nutzung von Smartphones
Abbildung 9: Reiss-Profile Muster
Abbildung 10: Beispiel MSA-Analyse
Abbildung 11: Darstellungsvarianten der MPA
Abbildung 12: Limbic Map nach Häusel
Abbildung 13: Lemniskate als Polarität
Abbildung 14: Konzept der Urteilsbildung angepasst von
Tabelle 1: Fragenkonstruktion in der MPA
Tabelle 2: Biologische Aufgaben von Emotionen nach Häusel
Abkürzungsverzeichnis
ABM - Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
HVB - HypoVereinsBank
KZA – Kundenzufriedenheitsanalyse
MPA – MotivPotenzialAnalyse
MSA – MotivStrukturAnalyse
o.A. – ohne Angabe
o.J. – ohne Jahresangabe
p. – Seite
pp. - Seiten
RP – Reiss-Profile
S. – Seite
Inhaltsverzeichnis
1 Welche Trends bestimmen das Thema?
1.1 Think Limbic!
In den vergangenen Jahren wurde die Forderung nach ganzheitlicher Führung und einem Marketing, welches das Unbewusste im Menschen anspricht, immer deutlicher. Nach dem Bestseller "Think Limbic!" von Hans-Georg Häusel (Häusel, 2003) wuchsen die Webseiten mit Schlagwörtern wie "Limbic Marketing" und "Neuro-Marketing". Auch in der Entwicklung neuer Führungsmodelle wird nicht erst seit Reinhard K. Sprengers Buch "Aufstand des Individuums" (Sprenger, 2000) über ganzheitliche Ansätze diskutiert. Motivationale Führung, limbische oder neurobiologische Erkenntnisse nehmen Einfluss auf die Führungskräfteentwicklung. Unzählige Angebote zu Weiterbildungen, wie man Mitarbeiter und Führungskräfte motiviert, kursieren im Internet. Allein zum Keyword Mitarbeitermotivation liefert Google am 19.2.2014 über 680.000 Sucheinträge. Bei der Führungskräftemotivation sind es sogar 1.100.000. Dabei werden neben Weiterbildungsangeboten jede Menge von Fachbüchern und Zeitungsartikeln aufgelistet. Das Thema ist nach wie vor von großer Bedeutung. Gibt man das Schlagwort "Kundenbindung" ein, erhält man ebenfalls rund 600.000 Sucheinträge. Bei der "Kundenmotivation" sind es jedoch gerade mal 5.240. (Google, kein Datum)
1.2 Wachsende Unzufriedenheit
Obwohl unser Wissen über derartige Zusammenhänge vermutlich täglich zunimmt, gibt es eine andere Tendenz: Mitarbeiter werden immer unzufriedener. Der Gallup Engagement Index zeigt in den vergangenen 10 Jahren einen stetigen Zuwachs an Mitarbeitern mit geringer emotionaler Bindung. Dabei wurden Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ab 18 Jahre in deutschen Unternehmen befragt. (Gallup. inc, 2014)
Mangelnde Innovationskraft und eine hohe Mitarbeiterfluktuation verursachen hohe Folgekosten für die Volkswirtschaft. Die Ursache lasse sich „in der Regel auf Defizite in der Personalführung zurückführen.“ (Gallup.Inc, 2013)
Abbildung 1: Gallup Engagement Index im Zeitverlauf (Gallup.Inc, 2013)
Die Google-Suchergebnisse für "Kundenzufriedenheit" werfen 1.980.000 Ergebnisse aus, für "Mitarbeiterzufriedenheit" werden 324.000 Ergebnisse geliefert. Dabei lassen sich unter den Links zahlreiche Anweisungen und Tipps finden, wie beides gesteigert werden kann und eine ganze Reihe von Diagnosemöglichkeiten werden angeboten.
Bei Wikipedia findet man eine anschauliche Grafik, die Elemente der Kundenzufriedenheit nach Dornach darstellt (siehe Abbildung 2 S. →). Wahrgenommene Leistungen und persönliche Erwartungen kommen dabei in ein Gleichgewicht. Das zeugt von einem Prozess, in dem Zufriedenheit entsteht.
Im Begriff Zufriedenheit steckt die Vorsilbe „zu“, die auf etwas Zukünftiges hindeutet. Und das Wort Frieden, welches einem Gefühlszustand eines Gleichgewichtes entsprechen kann.
Ist der Gefühlszustand dieses Gleichgewichtes erreicht, macht man sich häufig wieder auf die Suche, egal, ob von außen Erwartungen geweckt wurden, oder innerlich neue Erwartungen entstehen.
Kundenzufriedenheit ist das Ergebnis des Vergleichsprozesses zwischen Erwartungen und Leistungen
Abbildung 2: Kundenzufriedenheit nach Dornach als Gleichgewichtszustand (Wikipedia, 2011)
1.4 Zukunftstrends
Das Zukunftsinstitut hat 2013 seine Megatrend Dokumentation aktualisiert. Aus zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen haben die Wissenschaftler dreizehn Megatrends herausgearbeitet. (Zukunftsinstitut, 2013). Die mit dem Thema Kunden- und Mitarbeitermotivation in engem Zusammenhang stehenden sind hier benannt und aus den Grundbegriffen der Megatrend-Map 2.0 stichpunktartig beschrieben. :
Individualisierung :
Ansprüche des Kunden und Mitarbeiters als individuelle Person wahrgenommen zu werden und handeln zu dürfen.
Neues Lernen :
Lernen in anderen Kontexten, lebenslanges Lernen, Lernen lernen – dies erfordert andere Vertriebswege und Beteiligungen der Kunden an der Produktentwicklung, stellt Erwartungen an den Kundendialog und Herausforderungen für die Arbeitswelten als Lernwelten.
New Work:
Wandel in Führung und Mitarbeit. Projektorientierung und Geschwindigkeit der Neuerungen. Vor allem auch Mitarbeitermotivation und Lebensgefühl
Konnektivität:
Wenn es der Eine weiß, dann weiß es gleich auch der Andere. Vernetzung via Mobile Services und Internet machen einen schnellen Informationsaustausch auch über Führungsfehler und schlechten Service leicht.
Globalisierung:
Interkulturelle Anforderungen in den Unternehmen und globale Marketingstrategien werden sich an kulturellen Unterschieden messen müssen. (Zukunftsinstitut, 2013)
Die Nutzung von Internet und Online-Marketing-Maßnahmen wächst rapide. Wir leben in einer vernetzten Gesellschaft, deren ausgeklügelte Technik es möglich macht, Cookies auf Rechnern so zu platzieren, dass der Internet-Nutzer mit Anzeigen bombardiert wird, die seinem Verhalten im Internet entsprechen. Über Facebook, WhatsApp und YouTube wird die Selbstinszenierung soweit betrieben, dass es fraglich erscheint, warum - bei all der selbst gewählten Öffentlichkeit im Internet - der NSA-Skandal durch die Enthüllungen von Edward Snowden solche Bedeutung findet.
Nicht von der Hand zu weisen ist, dass Diskussionen über den Umgang mit Daten aus dem Internet oder mit Kundendaten im Unternehmen mit großer Emotionalität geführt werden - wie sonst ließen sich die Überschriften in den Tageszeitungen erklären?
Wenn der Begriff der Zufriedenheit etwas mit Frieden zu tun hat, dann handelt es sich zumindest um ein Abwesendsein von Kampf oder Krieg. Was jedoch verursacht die Unzufriedenheit jenes Aufeinandertreffen von verschiedenen Meinungen und Zielsetzungen? Wie kommt es, dass die beiden Themen Mitarbeitermotivation und Kundenzufriedenheit nachhaltig im Trend stehen? Und was lernen wir daraus als übergeordnete Prinzipien im Umgang mit Kunden und Mitarbeitern?
Die Antworten darauf scheinen vielfältig. Häufig erscheint es zu komplex, sich mit den Motivationen der Mitarbeiter auseinander zu setzen oder auch die Denkweisen der Kunden zu durchleuchten. Wie müssen Fragen gestellt sein, um in Marktanalysen etwas heraus zu finden, damit Unternehmen zukunftsfähige Entwicklungsschritte gehen können? Was können einfache Schritte sein, die Führungskräfte berücksichtigen, um die Mitarbeitermotivation zu steigern?
1.5 Qualität und Dialog – die These
Diese Arbeit untersucht aktuelle Trends in Marketing und Führung und geht der folgenden These nach:
Im Dialog kommt es auf die Haltung an
- oder -
Die Qualität der Kundenzufriedenheit und Mitarbeitermotivation hängen maßgeblich von der Dialoghaltung des Unternehmens ab.
Zur Erforschung dieser These werden verschiedenste Fragen an das Thema gestellt. Zwei Leitfragen helfen, die Bandbreite des Themas zu verstehen und die vielfältigen Untersuchungsfelder zu durchwandern:
Was für eine Kultur brauchen wir im Kunden- als auch im Mitarbeiterdialog?
Wie wird echtes Interesse an den Themen des jeweiligen Gegenübers erzeugt, damit es entscheidende Qualitätsverbesserungen für Kunden- und Mitarbeiterbindung ermöglicht?
Dazu wird der Versuch unternommen, die aktuellen Trends miteinander zu verbinden und Ansatzpunkte für eine Dialog-Kultur zu darzustellen.
Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert Unternehmenskultur als „Grundgesamtheit gemeinsamer Werte, Normen und Einstellungen, welche die Entscheidungen, die Handlungen und das Verhalten der Organisationsmitglieder prägen.“ (Gabler, o.A.)
Ausgehend von dieser Definition geht die erste Leitfrage davon aus, dass Kultur sichtbar wird, durch die definierten Ziele der darin agierenden Menschen und der Gestaltung der dahin führenden Prozesse.
1.6 Ein einfaches Unternehmensmodell
Ein einfaches Modell soll hier kurz vorgestellt und zur Untersuchung der Trends genutzt werden. Es zeigt, worin die eigentliche Spannung liegt: Aus der Kommunikationswissenschaft werden drei verschiedene Kommunikationsebenen beschrieben, die sich auch als eine Art „Magisches Dreieck“ darstellen lassen. Die Inhaltsebene, die Prozessebene und die Beziehungsebene. (Wikipedia, 2013)
Übertragen auf ein Unternehmen ließe sich auch folgendes formulieren:
Abbildung 3: Magisches Dreieck in Unternehmen (eigenes Modell)
Jedes Unternehmen verfolgt Unternehmensziele, die sich als "Inhalte" definieren lassen: Das kann die Produktion eines Produktes sein, oder eine Dienstleistung. Beides findet beim Kunden dann einen Absatz, wenn der Kunde sich dafür begeistern kann. Der Kunde entwickelt zu diesen Inhalten eine Beziehung, wenn diese Inhalte seinen eigenen Prozessen unterstützend zur Seite stehen. Im Unternehmen gibt es Mitarbeiter, die tagtäglich den für die Erstellung des Inhalts notwendigen Prozessen folgen. Sie benötigen eine gut motivierte Beziehung zu den Prozessen, verfolgen dabei in der Regel ihre persönlichen Zielsetzungen von Eigenentwicklung, Status, Karriere, Gestaltungsmöglichkeiten und vielem anderen. Lassen sich diese Mitarbeiterziele mit den Unternehmenszielen vereinbaren, entsteht eine fruchtbare Zusammenarbeit.
Die Unternehmensführung (Administration) mit den Stabstellen hat die Aufgabe, die Prozesse zum Erreichen der Unternehmensziele zu perfektionieren. Dabei zeigt sich immer wieder, dass das individuelle Beziehungsgeflecht der dort ansässigen Mitarbeiter ausschlaggebend für die Qualität dieser Prozesse ist.
Die Darstellung dieser drei Bereiche in einem Dreieck ist deswegen hilfreich, weil sich dieses Dreieck auf alle Aufgaben, die ein Mitarbeiter ausführen soll, anwenden lässt. Gleichzeitig wird deutlich, mit welchen Schnittstellen er umgehen muss.
Abbildung 4: Einflüsse auf das Magische Dreieck (eigenes Modell)
1.6.1 Vier Steuerungsfaktoren
Der Unternehmensberater Adrian Beekman zeigte vier wesentliche Faktoren, mit denen Gesprächssituationen konkret gestaltet werden können. Dazu zählte er den
Einfluss des Ortes: Wie ist der Besprechungsraum gestaltet?
Einfluss der Zeit: Welche Tageszeit und Dauer?
Einfluss der Beziehung: Wer ist noch mit dabei? Sympathie oder Antipathie?
Einfluss des Geldes: Welches Geld wird dafür benötigt?
(Bekman, 1999)
Setzt man die drei Begriffe Ort, Zeit und Beziehung an jeweils drei Ecken des Dreiecks, so könnte man Ort mit Inhalten und Zielen des Unternehmens (unabhängig davon, ob es Dienstleistungen oder Produkte sind), Beziehung mit emotionaler Bindung von Mitarbeitern und Kunden und Zeit mit Prozessen zur Erreichung der Unternehmensziele gleich setzen. Gerät das Spannungsfeld zwischen diesen drei Polen aus dem Gleichgewicht, weil im Unternehmen Ziele, Inhalte/Orte, Beziehungen oder Prozesse nicht stimmig zueinander sind, tritt die vierte Dimension zutage: Es geht ins Geld. Unternehmen beauftragen scharenweise externe Berater, weil sie Unterstützung benötigen in der Entwicklung eines unternehmensspezifischen Gleichgewichtes dieses Magischen Dreiecks.
Das Modell wird deswegen als magisch bezeichnet, weil jeweils zwei Ecken die dritte Ecke mit wesentlichen Erkennungsmerkmalen versorgen: Das Zusammenspiel aus Zielen und Prozessen sagt etwas aus über die Beziehung, die dazu aufgebaut werden kann. Das Zusammenspiel aus Prozessen und Beziehungen sagt etwas aus, welche Ziele damit erreicht werden können. Und das Zusammenspiel aus Zielen und Beziehungen sagt etwas darüber aus, welche Rahmenbedingungen für die Prozesse gelten.
1.6.2 Auf der Suche nach Motivation
Aus dem gerade Beschriebenen lässt sich ableiten, dass die Beschreibung von Beziehungsqualität möglich wird, indem man die Ziele und Prozesse in Unternehmen untersucht. Die Frage ist jedoch berechtigt, ob man damit wirklich die Qualität einer Beziehung beschreiben kann.
Der Vormarsch von Limbic® und anderen neurowissenschaftlich mehr oder weniger fundierten Diagnoseverfahren in Unternehmen, ist ein Ausdruck für eine „objektivierte“ und damit versachlichte Vorgehensweise. Sie alle sind der Versuch, die unbewussten Einflüsse der Persönlichkeit unter dem Begriff „Motivation“ so messbar zu machen, dass daraus Handlungsoptionen für Marketing und Führung entstehen. sie wecken den Anschein, als können damit Prozesse so optimiert werden, dass die Beziehung und die Zielesetzung ein Höchstgrad an Effizienz erreichen.





























