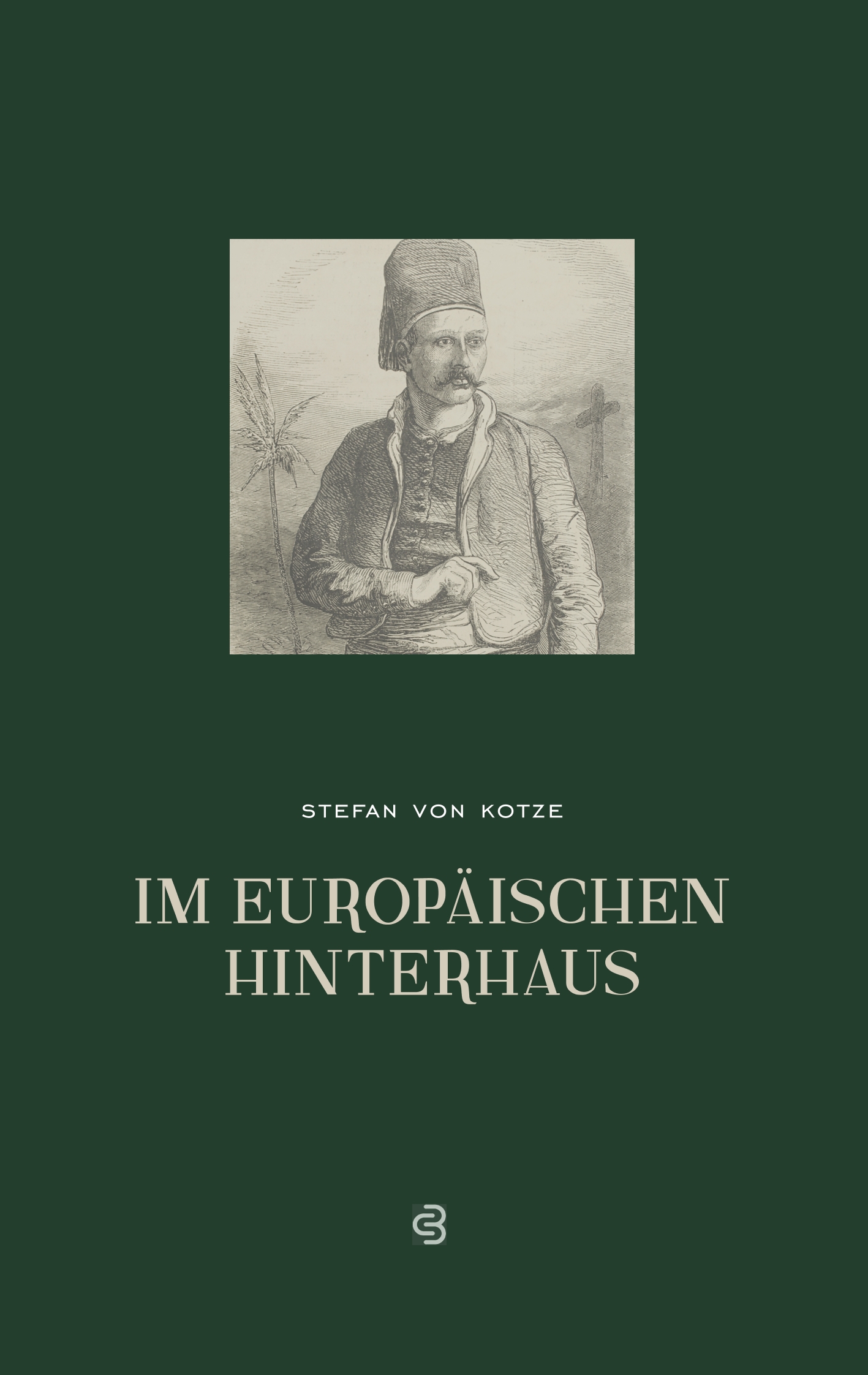
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Stefan von Kotze - bekannt für seine zynisch-heiteren Reisebeschreibungen - bereiste Anfang des 20. Jahrhunderts den Balkan und die Türkei. Schlechtes Wetter und unkomfortable Reisebedingungen treiben ihn zu immer neuen Spitzen an. Dabei zeichnet er aber auch ein ernstes Bild der damaligen gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse. Ein Lese-Muss für Reise- und Europaliebhaber.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Gefördert von der Stefan-von-Kotze-Gesellschaft
Inhaltsverzeichnis
Von Berlin zur Adria
In Montenegro
Von Ragusa bis Belgrad
Nisch und Sofia
Bukarest
Von Bukarest zum Bosporus
Konstantinopel
Die Süßen Wasser
Der Sultan Abdülhamid
Perikles Kallimachi
Die Bahnfahrt nach Eskischehir
Über Angora nach Konia
Konia
Die Bagdadbahn
Mit dem Orientexpreß zurück
KAPITEL I VON BERLIN ZUR ADRIA
Es ist nicht unerheblich, gleich am Anfang dieser wahrhaften Reisebilder zu bemerken, daß mir mein Notizbuch mit den 333 besten Witzen des Orients in Anatolien verloren ging – das sich infolgedessen wohl kaum wieder über allzu große Trockenheit zu beklagen haben wird. Und dies schien meinem bösen Schicksal gerade der beste Witz der 333. Ich aber finde die Pointe gar nicht erfreulich. Ich habe mir durch ein ernstes Studium der einschlägigen Literatur Ersatz zu schaffen gesucht, habe »1001 Nacht«, »Babel und Bibel«, Dr. Rohrbach und ähnliche Autoritäten gelesen, und mir die älteren Jahrgänge der »Fliegenden Blätter« gekauft. Trotzdem schmerzt mich der Verlust noch immer. Denn nunmehr bin ich gezwungen, den Osten mehr oder weniger ernst zu nehmen, was ganz und gar nicht meine ursprüngliche Absicht war. Ich hatte vielmehr an eine Art Humoreske gedacht, wie etwa die von Martin oder von Schweinitz – nur nicht unbeabsichtigt. Auch hat mich der serbische Generalkonsul in Konstantinopel (der damalige Ministerpräsident in Belgrad verschwor sich gerade) mit seinen mir versprochenen überaus scherzhaften politischen Ausführungen im Stich gelassen, und die urkomische rumänische Bodenreform war gerade mit etwas ernsthafterem Schießen beschäftigt. So sitze ich denn jetzt so ziemlich auf dem Pfropfen, und wenn die hier verzapfte Flüssigkeit danach schmeckt, ist es nicht meine Schuld.
Worob ich zu reisen anhebe. –
In Znaim behauptete der Pikkolo, der den verschlafenen Berlin–Wiener Schnellzug entlang eilte: Kaffee! Und da ich in Österreich war, hielt ich das für nicht unwahrscheinlich und bestellte mir eine Portion. Draußen war es schöneres Wetter geworden und niedlichere Uniformen. Und da ich nur ein paar Zigarren in der Hutschachtel über die Grenze geschmuggelt hatte, war auch mein Gewissen leicht.
Übrigens – eine Hutschachtel sollte niemand vergessen, der Zollgrenzen zu passieren hat, auch wenn er keinen Zylinder braucht. Eine Hutschachtel wird, wie ich hiermit erfahrungsgemäß feststelle, niemals revidiert. Und wenn sie gar einer Dame gehört, behandelt man sie mit solch scheuer Achtung, wie etwa ein Kohlenträger eine Meißener Porzellanfigur befingert.
Man nehme daher am besten auch eine Dame mit.
Von der Fahrt zwischen den beiden Kaiserstädten habe ich nur geringe Eindrücke erhalten, bis auf einige äußerliche, an denen die harten Coupékissen schuld gewesen sind. Denn es war Nacht und ich müde. Außerdem hätte auch Dresden nur an Lahmannsche Kost, und Böhmen an Pilsener Bier erinnert, die ich beide nicht leiden kann. Zudem beruhigte mich der Besitz von Meyers Reisehandbuch. Und so traf ich völlig unvoreingenommen in Wien ein.
Ich siedelte mich im Hotel Matschakerhof an, erstens des Stephansdoms wegen, und zweitens, weil die Etymologie des Namens auf mich einen gewaltigen Eindruck machte. Der Wirt teilte mir nämlich mit: »In uralten Zeiten hauste hier ein Ritter, der einst bei einem Trinkgelage, um noch vom Allerbesten aufzutischen, in den tiefsten Keller ging. Unten angelangt, erblickte er eine große Kiste und erstarrte vor Schreck, als er sie öffnete. Denn darin lag einer der fürchterlichsten Matschaker, die es je gegeben. Seitdem er dies gesehen, blieb der Ritter stumm sein Leben lang. Und davon heißt noch heute das Haus Matschakerhof.«
Bei meiner Abreise kam mir der Gedanke, daß »Matschaker« wahrscheinlich tschechisch oder magyarisch für »Rechnung« ist. Auch ich blieb stumm.
Leider hatte ich in meinen Reiseplan das Wetter nicht mit einbezogen. Zwar hatte ich die offizielle Prognose des Meteorologischen Instituts überflogen, aber gleich größeren Leuten vor mir das falsche Ende des doppelsinnigen delphischen Orakels zu fassen bekommen. Ich hatte auf einen warmen Frühling gehofft, als Gegenstück zu dem besonders harten Winter; und statt dessen pendelte die Quecksilbersäule am Gefrierpunkt umher, und Schnee und Regen peitschten durch die Gassen. Trübe saß ich im Gastzimmer und starrte den Stephansturm an, bis mir meine geschmuggelten Zigarren ausgingen und ich zu dem grausigen österreichischen Kanaster greifen mußte.
Ich habe mir redliche Mühe gegeben, mich an die Virginias zu gewöhnen. Denn von Beruf bin ich Kettenraucher, und Kautabak oder Pfefferminzpastillen schaffen mir keinen Ersatz. Aber schon die erste Begegnung mit dem landesüblichen Glimmstengel enttäuschte mich schwer. Die angebliche Zigarre erinnert zu unangenehm lebhaft an das qualmende Räucherstäbchen, das der fromme Chinese vor seinem Messinggötzen abzubrennen liebt. Dabei ist ihre korrekte Behandlung so schwierig zu erlernen wie ein gutes Cocktailrezept. Wenn man ihr das Rückgrat entzogen und sie auf dem kleinen Zündapparat über die Flamme gelegt, beginnt sie zu kohlen wie ein Mitglied des Reichsrates und übel zu riechen; aber wenn man sie in den Mund steckt (am anderen Ende natürlich), bemerkt man, daß sie keinen Zug hat. So man diesen durch qualvolles Stochern mit besagtem Rückgrat mühsam hergestellt, ist sie hohlgebrannt. Da inzwischen der Kellner die Flamme zum Nebentisch entführt hat, beginnt man mit Streichhölzern zu operieren. Drei Stück setzen sie wieder in Glut, aber diesmal nur äußerlich. Die Füllung scheint aus denaturierter Asbestfaser zu bestehen und nur stinken zu können. Endlich entdecke ich, als die zweite Schachtel Schweden geleert ist, daß man sie nur dann ohne Unterbrechung konsumieren kann, wenn man eine brennende Lampe vor sich hinstellt und sie fortgesetzt über den Zylinder hält. Unter solchen Umständen erscheint sie mir ein geradezu ideales Genußmittel für Insassen des Fegefeuers, die es ja auch schließlich verdient haben. Und dazu die Umgebung des Gastzimmers eines mittleren Hotels! Es stimmt die Seele trauriger als eine Leichenhalle und ist stilistisch anspruchsloser als ein Redaktionsbüro. Es besitzt für mein Empfinden eine gewisse symbolische Ähnlichkeit mit einem fettigen Tellertuch. Der Duft längst verflossener Mahlzeiten schwebt durch die graue Nachmittagsatmosphäre.
Finster starrte der Oberkellner durch das ungeputzte Fenster auf die leere, nasse Straße, während im Hintergrunde der Pikkolo mit der Serviette das letzte Menü von seinem Smoking zu reiben versuchte, um Platz für die Abendkarte zu schaffen. Auch das Bier schmeckte lebensmüde, alle irgendwie möglichen Ansichtskarten waren geschrieben, die Zeitungen von einer langweiligen Persönlichkeit für mich, da ich die angeführten Kommunalpolitiker und Tenöre nicht kannte – und dabei pladderte noch immer der Landregen von oben. Es war wirklich fad; und langsam versank ich in eine Art Lethargie, die nichts mit dem seligen Kef des Orientalen zu tun hatte, oder dem Nirwana des noch weiter Östlichen – die in mir nur ein Gefühl loslöste, als sähe ich in einem schmutzigen Tümpel eine ersäufte Ratte treiben.
Da ermahnte ich mich und ging mit einem Regenschirm auf dem Ring spazieren. Aber ach, der war einsam und verlassen, wie sein Namensvetter zur Strohwitwerzeit, und der Wind strich drüber hin.
Eine Orientierungsfahrt (als gewissenhafter Orientreisender) in den Prater erinnerte mich an die Beschreibung einer Polarexpedition; und abends bei »Maxims« lud mich eine leutselige und mitleidige Wiener Familie zu einem Glase Sekt ein, und überließ mir mit der bekannten österreichischen Liebenswürdigkeit die Begleichung der keineswegs unbedeutenden Zeche. Kurzum – es war nicht gerade lustig.
Rückblickend jedoch erscheint mir manches, das mich damals peinlich berührte, in versöhnlicherem Lichte. Die Zigarren und das Wetter wurden später noch schlechter, was man kaum für möglich halten sollte, und die Politik und das Sprachgewirr noch babylonischer. Auch die alldeutsche Idee fand eine Anzahl angenehmer Gegenstücke im Allserbentum, und Allbulgarentum, und bei den Großarmeniern, und in Großgriechenland. Das Trinkgelderwesen im einzigen Wien bereitete mich etwas auf den Backfisch – wollte sagen Backschisch des Balkans vor. Ich empfehle daher jedem Orientforscher Wien als Zwischenstation, wie man sich etwa Stirn und Brust befeuchtet, ehe man den Kopfsprung ins kalte Wasser wagt.
Nachdem ich mir eine Anzahl nötiger Empfehlungen besorgt, dachte ich ernstlich an die Weiterreise. Orientalen sah ich allerdings auch hier – Herr Lueger zeigte mir einige – aber der richtige Völkergulasch war es doch noch nicht. Wäre das Wetter besser gewesen und mir das apokryphe Weaner Madl gezeigt worden, hätte ich vielleicht meine Berichte vom Stephansplatz aus geschrieben. Aber ich fror, und die Sehnsucht nach der blauen Adria stieg in mir auf.
Aus meiner Versumpfung gerüttelt, wurde ich gewahr, daß der Schnelldampfer des Österreichischen Lloyd schon am folgenden Tage Triest zu verlassen drohte, und der nächste erst eine halbe Woche später abging. Das trieb mich zu äußerster Eile. Denn noch drei Tage Regenwetter in Wien hätten mich vollends schwermütig gemacht; Triest hingegen war mir für einen längeren Aufenthalt zu verteufelt italienisch. Wobei ich dankbar der großen amerikanischen Dampferlinien gedenke, die nach der Auswanderungsstatistik zu urteilen mit außerordentlichem Erfolge beschäftigt sind, das von der Natur so reich gesegnete Italien für kultivierte Menschen bewohnbar zu machen. Man stelle sich nur einmal Neapel ohne Neapolitaner vor und man wird Ballin segnen.
Meine Dringlichkeit hatte allerdings die unangenehme Folge, daß ich den Semmering bei Nacht passieren mußte. Gewisse Vorteile bringt eine Nachtfahrt durch Drei-Sternchen-Gegenden jedoch mit sich – wenigstens für den gewissenhaften Menschen. Fährt ein solcher bei Tag, so setzt er sich natürlich an das Abteilsfenster, das das Reisehandbuch ihm vorschreibt und ist nunmehr gezwungen, stundenlang, mit nur hier und da einem Glas Bier dazwischen, Landschaft in sich aufzunehmen, was mindestens so anstrengend ist, als ein Nachmittag in der Sezession, und gleichermaßen den Hals verrenkt. Und wenn man noch dazu ein hübsches Gegenüber hat, so scheint das Zölibat, durch Fasten verschärft, nur ein Kinderspiel dagegen.
Jedenfalls – ich bereue meinen damaligen Entschluß nicht. Ich mußte im weiteren Verlauf meiner Reise so viele Gebirgsbahnen beaugenscheinigen, von denen jede als die schönste Europas gepriesen wird, daß ich wahrscheinlich die Tunnel jetzt noch mehr durcheinanderwerfen würde, und in meinen Aufzeichnungen all die schönen Aussichten und kühnen Projekte nicht mehr zu plazieren gewesen wären. Außerdem hätten meine Adjektiva nicht gereicht.
Wie es war, habe ich so gut geschlafen, daß ich noch nicht einmal merkte, als unser Zug 2½ Stunden oben auf dem Semmeringjoch im Schnee stekken blieb. Und die Reue ist mir auch dann nicht gekommen, als ich am nächsten Morgen Peter Roseggers begeisterten Hymnus über »Unsern lieben Semmering« las; und ich hatte nur das mild nachsichtige Lächeln, das zufriedene, für eine Anekdote, die ich darin vorfand. Rosseger erzählt:
»Eines Tages bin ich von Wien aus mit einem Norddeutschen gefahren. Er wollte nach dem Süden. Er hatte ein Gelaß für sich genommen, um unterwegs schlafen zu können.«
»Schlafen? Über den Semmering schlafen?« fragte ich fast beleidigt.
Darauf er: »Pah, Berge! Solche habe ich auf meinen Reisen genug gesehen.«
Der Mann hatte nicht so unrecht – wenn ihn auch Rosegger nachher bekehrt haben will. Auch ich habe die Berge, wenigstens die hohen, nie leiden können. In körperlicher Beziehung sind sie meist unbequem. Und in geistiger eintönig. Sie sind gewaltig und dumm wie ein Preisringkämpfer. Sie imponieren Leuten, deren Seele kurzsichtig ist, die große Buchstaben brauchen, wie die Abc-Schützen der untersten Schulklasse, um lesen zu lernen.
Ich persönlich habe nicht 3000 Meter Granit nötig, um die Herrlichkeit der Schöpfung zu erkennen. Die lese ich lieber aus einem blühenden Kirschbaum. Und die paar grünen Fetzen, die im Sommer solch ein Steinriese aufzuweisen hat, intensivieren nur seine Lebensarmut, seine Ausdruckslosigkeit, erinnern mich der armseligen Balkongärten an der Front eines öden Wolkenkratzers. Aber meist ist er mit Schnee bedeckt, was ihm ein noch schlafmützigeres Aussehen gibt. Außerdem ist Schnee nur zum Sektkühlen und Rodeln gut. –
Morgens kam ich frisch gestärkt in Triest an. Das Wetter hatte sich ein klein wenig gebessert, aber bei weitem nicht in dem Maße, das ich glaubte beanspruchen zu dürfen. (Ich bitte im voraus um Verzeihung, wenn ich immer wieder auf das Wetter zu sprechen komme; aber es war nun einmal das Haupterlebnis meiner Fahrt.) Da der Reiseführer jedoch einen Mangel an zu besichtigenden Kunstschätzen verhieß, so war ich etwas sympathischer gestimmt. Museen, Kirchen, Ruinen und dergleichen wirken auf mich immer wie das lateinische Extemporale auf den Tertianer. Ich stolperte also den Hafen entlang, der in der Buntscheckigkeit seiner Typen wie eine ungarische Parlamentssitzung anmutete. Nur daß die Schiffer bessere Manieren hatten.
Besonders bei der Abfahrt – das Wetter hatte inzwischen von meiner Anwesenheit erfahren – machte die Stadt einen prächtigen Eindruck, Genua ähnlich, auch im Geruch. Die »Graf Wurmbrandt«, ein ganz neuer Schnelldampfer des Lloyd, überraschte angenehm von außen und von innen. Anfangs betrachtete ich den Neigungswinkel des Schornsteins und der Masten zwar mit Mißtrauen. Der soll nämlich bei harmlosen Gemütern den Eindruck wüster Schnelligkeit hervorrufen, wie kurze Röcke und lange Zöpfe der Andeutung von Jugend und Unschuld dienen. Doch diesmal stimmte es wirklich – mit der Schnelligkeit nämlich. 16 Seemeilen!
Etwas Koketterie war aber doch wohl dabei: Das merkte ich an dem Herausstreichen einer anderen Tugend, die wohlerzogene Küstendampfer auszeichnet: Pünktlichkeit. Als ich mich in Triest nach der Ankunft in Cattaro am nächsten Tage erkundigte, erhielt ich die verblüffend genaue Antwort: 11.25 a. m. Aber auch das stimmte so ziemlich.
Allerdings – ich erinnere mich eines Bekannten, der früher sehr lasterhaft lebte, und der ganz plötzlich eine unheimliche Pedanterie in bezug auf seine Zeitangaben entwickelte. Er verabredete sich z. B. auf 5 Uhr 7 Minuten 15 Sekunden und wartete hinter der Ecke bis genau auf den Schlag. Aber ich entdeckte bald, daß er nur mit seiner neuen goldenen Uhr protzen wollte, und als er die eines Tages versetzen mußte, war er genau wieder so bummelig wie zuvor. Doch das nur nebenbei.
Die Jahreszeit wurde vorübergehend gnädiger, je weiter wir nach Süden kamen. Unter den Passagieren bemerkte ich bei flüchtiger Durchsicht eine leibhaftige k. & k. Erzherzogin, zwei Kavalleristen in Sporen, ob deren den Kapitän beinahe der Schlagfluß traf, und eine Anzahl Touristen – leider! Denn wahrlich, die dalmatische Küste verdient es, unentdeckt von Stangen und Cook zu bleiben. Sie nimmt sich aus, wie Norwegen im Brautstaat der Riviera. An die 120 größere und kleinere Inseln sind dem felsigen Gestade vorgelagert, in das die Adria tiefe Fjorde geschnitten. Und über das scharfe Profil zieht sich versöhnend ein Frühlingsschleier von Granat- und Oleanderblumen und anderen, mir unbekannten, blühenden Gemüsen, gegen deren berauschende Düfte selbst die Knoblauchatmosphäre, die auf den Flügeln des Sirokko aus dem benachbarten Italien herüberschwebt, nicht anstinken kann – wenigstens nicht, solange man sich dicht unter Land hält.
Dieses taten wir auch. Denn der Dampfer legte recht reichlich an – in Pola, Zara, Spalato, Ragusa, ohne sich irgendwo länger aufzuhalten, bis wir in die berühmte Bocche von Cattaro einliefen. Die Einfahrt ist so schmal, und es geht so tief landeinwärts, oder vielmehr in den Fels hinein, daß man gar nicht mehr an Salzwasser glauben möchte, wenn man endlich die kleine Stadt am Fuße des Lovcen, eines der Schwarzen Berge, tief eingeschlossen liegen sieht, so tief, daß in den Wintermonaten die Sonne nur fünf Stunden täglich sichtbar wird (was immerhin noch mehr ist, als man von manchem Städtchen der Norddeutschen Tiefebene behaupten kann).
Mich wunderte, wie sich der Kapitän so sicher hineinfand durch das Labyrinth von Bassins und Kanälen, ohne anzustoßen; aber noch erstaunlicher schien es mir, daß auch die Bora, der eiskalte Nordwind der Adria, den Weg fand und eine empfindliche Wintertemperatur erzeugte, die durch schneegekrönte Bergspitzen im Hintergrund moralisch unterstützt wurde. Es weht eben nicht in Cattaro: Es zieht. Nötig ist das allerdings. Die Bora ist die Sanitätskolonne des Ortes.
Im übrigen ist die Bocche wirklich grandios. An den nackten Steinwänden kleben kleine Häuschen, die nur von sehr nüchternen Männern bewohnt sein können, und winzige Kirchen, deren Besucher sehr fromm sein müssen, ebenfalls Forts, deren Besatzung wohl nur selten um Spazierurlaub einkommt.
Die österreichischen Offiziere, die das Schicksal an die dalmatische Küste verschlagen hat, schimpfen fürchterlich. Fern von Weib, Wein und Wien kommen sie sich vor, wie die Angehörigen einer Kolonialarmee. Dafür tragen sie auch ihre alten Uniformen auf, noch dazu mit Röllchen, und wandeln mit Spazierstöcken in der Hand einher – so wenig stilgerecht für das preußische Auge, wie die beiden bespornten Herren an Bord des Dampfers. Aber vielleicht imitieren sie Friedrich den Großen (bis auf die Röllchen!).
Das einzig brauchbare Hotel war äußerst einfach eingerichtet, doch dementsprechend billig. Auch das Essen und das Bier waren leidlich, so daß ich die Mitteilung des offiziellen Führers: »In Cattaro wird im Bedarfsfalle das Übernachten an Bord der Schiffe ausnahmsweise gestattet«, zum mindesten für unnötig hielt.
Abends, nachdem die Stadttore fürsorglich gegen etwaige Beutezüge seitens Nikitas Untertanen (die vor Eintritt in die Stadt ihre Waffen ablegen müssen) geschlossen waren, ging ich zur Messe in die Kathedrale, die sich durch eine schöne Orgel, einen schlechten Chor und weiß gekalkte Innenwände auszeichnet, und die angefüllt war von Weibern und Wacholderrauch. Am Hochaltar hielten zwei Soldaten, die unter vielem militärischen Gestampfe regelmäßig abgelöst wurden, Wache, wahrscheinlich um den lieben Gott gegen die Montenegriner zu schützen. Denn die rauben bekanntlich alles.
Und um 8 p. m. blieb mir nichts übrig, als das Bett.
KAPITEL II IN MONTENEGRO
Wenn man in Berlin am ebenen Stammtisch s itzt, schimpft jedermann, der etwas auf seinen ästhetischen Ruf hält, über die Zunahme der Bergbahnen und Kunststraßen, die nicht nur die hehre Jungfräulichkeit der Mutter Natur verschandeln (dieser liebliche Widerspruch gehört auch zur Ästhetik), sondern hauptsächlich die heilige Einsamkeit mit einem barbarischen Gewirr von Touristen erfüllen, die lediglich nach Bier und Ansichtskarten schreien. Ich habe Leute gekannt, die sich irgendeines herrlichen Aussichtspunktes nur erinnerten, wenn man ihnen das Bräu nannte, das dort verzapft wird – eine Art Mnemotechnik der Gurgel. Die meisten hingegen sehen die Aussicht überhaupt nur auf der Ansichtskarte, weil sie während des kurzen Aufenthaltes keine Zeit finden, vom Schreibtisch aufzublicken.
Steht man jedoch in eigener Person am Fuße eines starken Aufstiegs, dann segnet man den Ikonoklasten, der ihn für Taxameterdroschken fahrbar gemacht hat und es solchermaßen dem Wanderer ermöglicht, seine Beine zuzuklappen und sich gänzlich den seelischen Genüssen zuzuwenden, soweit das die Mitreisenden gestatten.
Diese Leute zerfallen gemeiniglich in zwei Klassen: Touristen und Handlungsreisende. Man unterscheidet sie daran, daß der Tourist mit Damen reist, der andere mit Musterkoffern. Sonst ähneln sie einander sehr: Beide sind weiter in der Welt herumgekommen als ihr Zuhörer; kennen die Geheimnisse aller Großstädte von Singapore bis Lissabon; haben in ihrer frühesten Jugend schon jeden Witz gehört, der je gemacht wurde, von Adam bis auf Maximilian Harden; sind jederzeit bereit, gute Ratschläge zu erteilen, besonders wenn man sie nicht haben will, und präparieren sich darauf mit Hilfe des Reisehandbuches in der Verschwiegenheit der Toilette. Ja, manchmal greifen die beiden Kategorien sogar ineinander über, wie mir das in Cattaro passierte, wo sich mir zwei Herren, die sich auf einer geschäftlichen Tour befanden, zu einem Abstecher nach Cetinje anschlossen.
Das war jedoch sehr erfreulich für mich; denn dadurch wurde der Wagenpreis von 16 Gulden unter drei Börsen verteilt, und es blieb mehr für die Wegzehrung. Da die Fahrt 930 Meter hoch geht und etwa acht Stunden dauert, so erschien mir das außerordentlich wohlfeil. Aber ich hatte nicht mit dem Trinkgeld gerechnet! Und das ist doch bei einem braven Kutscher gerade die Hauptsache – wie das Bier beim guten Journalisten, und nicht etwa die Tinte, wie der Laie glauben dürfte. Wenn ich einmal genug Bier vorrätig habe, werde ich eine philosophische Abhandlung über die »Wichtigkeit des Nebensächlichen« schreiben. Immerhin, das exorbitante Trinkgeld verteilte sich ebenfalls auf drei, wenn auch gebeugte Häupter, und geteilter Schmerz ist drittel Schmerz.
Frühmorgens brachen wir in einem landauerähnlichen Gefährt auf, mit zwei wenig Vertrauen erweckenden Gäulen bespannt, die sich aber vorzüglich bewährten. Denn wir brauchten nur selten und verhältnismäßig kurze Strecken zu Fuß zu gehen. Die Serpentine ist eine milde, sozusagen eine ungiftige Schlange, und ganz hervorragend in Stand gehalten. Der Österreicher hat etwas Altjüngferliches an sich. Er entschließt sich schwer zu einem größeren Unternehmen; aber wenn er es einmal ausführt, muß alles blitzblank und rein und keine Fransen dran sein. Die Straße sah aus wie ein Paar Hosen, das eben mit frischen Bügelfalten vom Schneider kommt.
Aus der Porta Marina heraus ging es durch Olivenhaine zum Fort Trinita, wo die Aussicht anfängt, überwältigend schön zu werden, und je höher wir stiegen, desto mehr erweiterte sie sich (wie das allerdings bei allen ehrsamen Aussichten der Fall ist), bis die ganze Bocche und darüber hinweg die Adria sichtbar wurden. Auf ungefähr dreiviertel Höhe war die Schneegrenze erreicht, und während wir an einer steilen Stelle neben dem Wagen einherwandelten, pflückten wir Veilchen am Rande des Winters und fühlten uns wie ein höheres Töchterpensionat nach der Literaturstunde.
Leider hielten diese edlen Regungen nicht lange an. Teils der Schneeschmelze halber und teils, weil wir die Reichsgrenze überschritten hatten und uns in Montenegro befanden, wurde der Weg recht unangenehm, und selbst die Veilchen vermochten uns nicht über die nassen Füße hinwegzutäuschen. Die Haltestation Njegus auf der Paßhöhe wurde daher mit Freuden begrüßt. Und das Gasthaus am Wege enttäuschte uns nicht; es gab ausgezeichneten Schinken und einen sittlich mindestens ebenso hoch stehenden Likör. Ich habe so selten etwas Eßbares im Balkan gefunden, daß ich mich nicht enthalten kann, die Vorzüglichkeit von Njegus besonders zu erwähnen. Außerdem stammt der Fürst von dort.





























